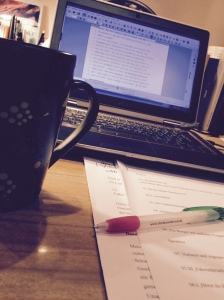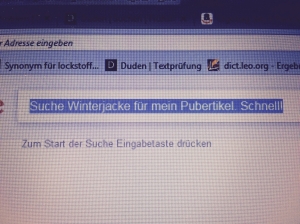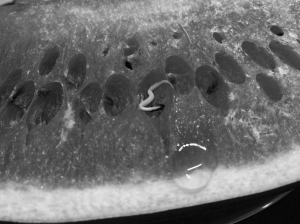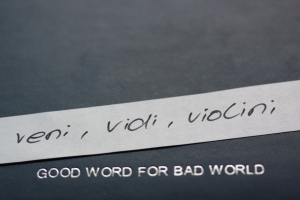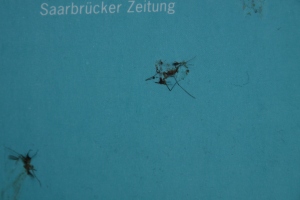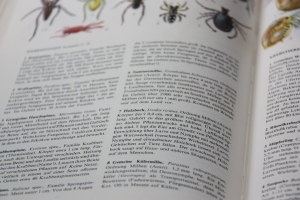Hallo ihr lieben Leute, die ihr letzte Woche so zahlreich und interessiert Anteil genommen habt, am Liebesdrama in unserem Gartenteich, bei dem sich eine Kröte in unseren guten, alten Koi-Fisch Hektor verliebt hatte. Die Kröte war ihm auf den Kopf gesprungen und hatte ihn in ihrem Liebeswahn stundenlang fest umklammert.
Leider muss ich euch mitteilen, dass genau das eingetreten ist, was Ludwig Tent vom Osmerus‘ Blog als das Schwärzeste aller möglichen Szenarien beschrieb: Unser liebenswerter, treuer, neugieriger, alter Hektor hatte bei der Tortour durch den verwirrten Froschmann so schwere Verletzungen erlitten, dass er diesen vier Tage später erlag.
Hektor folgt nun seiner Koi-Fischfreundin Lilly nach, die wir vor exakt einem Jahr beerdigt hatten. Die beiden teilten mehr als 40 Jahre lang Tisch und Teich und waren unzertrennlich.
Wir vermuten, dass Lilly ebenfalls einer Krötenorgie zum Opfer fiel.
Beide sind nun wieder vereint und ruhen nebeneinander unterm Apfelbaum.
R.I.P., lieber Hektor ❤️



Meine Bücher ❤️

Ich will Euch mal wieder einen vom Gärtnern erzählen!
Da schreckt schon gleich der 1. Satz ab – stimmt’s?
Mich auch. Handelt sich nicht um meine Kernkompetenz.
Nichtsdestotrotz machen wir seit Jahren in Tomaten. Im ersten Jahr dermaßen erfolgreich – meine Urlaubsvertretung versorgte die halbe Nachbarschaft.
Im Jahr darauf lief die Zucht genauso grandios, allerdings ging es mir zunehmend auf den Sack, dass sich wegen der riesengroßen Pflanzen ab Ende Juli die Markise nicht mehr schließen ließ. Vor allem zur Mittagszeit nervte die verdammte Hitze!
Also beratschlagten mein Mann und ich über einen alternativen Standort für die roten Schätze.
Und damit ging die Kacke eigentlich los …
Im Frühjahr ’20 zogen zarte Jungpflanzen ganz nach hinten unters Dach vom Holzstapel. Dort waren sie so weit ab vom Schuss: Ich vergaß, sie zu gießen. Aus den Augen, aus dem Sinn – leider nahmen sie das krumm.
Meine Leute ebenfalls und ich versprach, mich fürs Jahr ’21 zu bessern. Täglich mit der Kanne nach hinten zu latschen, das Versorgen in die Morgenroutine einzubauen, wie Vögel füttern: Das klappte schließlich auch.
Weil ich aber aufgrund der Schelte und der Missernte besonders motiviert war, beschloss ich: Ab jetzt züchte ich alles selber!
Schön aus winzigen Samenkörnern – von Anfang an dabei sein! –
da kriegt man einen ganz anderen Bezug!
Zwecks des Eisprungs befragte ich das Internet. Bei zu früher Aussaat bestünde die Gefahr, dass sie vergeilen.
Vergeilen? Hilfe!
Ich wühlte abermals im Netz und erfuhr, dass es sich dabei keineswegs um einen anrüchigen Zustand handelte, sondern dass man das bei Pflanzen so nennt, wenn es zu dunkel ist. Sie suchen dann mit lange, dünnen Triebe nach der Sonne, deswegen sei es ratsam, erst Anfang März zu säen.
Um auf Nummer Sicher zu gehen, dass die Samen mit der Erde zu kräftigen Tomatenbabys kopulierten, säte ich erst am 31. März aus.
Und dass auch nur, weil mich meine Mutter daran erinnerte.
Hätte sie das nicht früher machen können?
War jedenfalls alles viel zu spät, die ersten Tomaten reiften Ende Oktober – das war kurz vorm ersten Frost.
Wenn etwas schief geht, gebe ich aber nicht auf, sondern will es im nächsten Anlauf besser machen! Also nicht nur die Lücken schließen, sondern obendrein noch kräftig steigern.
Mittlerweile befinden wir uns im Jahr ’22: Mein Mann kaufte im Internet Samen von alten Sorten.
Bei alten Sorten spricht man von alteingesessener Nutzpflanzen, die sowohl klimatisch angepasst sind, als auch (und das vor allem!): samenecht. Man kann sie selber aussamen und sich so sein Saatgut für das kommende Jahr selber züchten. Schluss mit dem alljährlich Kauf von F1-Hybriden – unabhängig sein. So der Plan.
Jedenfalls orderte mein Mann einen Satz mit 100 verschiedenen Sorten. Eigentlich schon dämlich, wir betreiben ja hier keine Gärtnerei. Die Samen kamen in einem kleinen Päckchen mit der Post. Jede Sorte in einem winzigen Tütchen, mini-futzelige Bildchen drauf, 6 Samenkörnchen pro Stück.
Mir schwante es schon …
Ich legte bereits Ende Januar los. Damit in meinen Mini-Gewächshäusern auf den Fensterbänken kein Platz verschwendet wurde, schnippelte ich Eier-Kartons zurecht. Ich füllte Erde ein – und wo ich einmal im Rausch war: die Samenkörner gleich hinterher. Weil ich dem Internetkauf nicht traute, gab ich auch ein paar F1-Hybriden mit in den Mutterboden.
Um die ganze Vielfalt auseinanderhalten zu können, steckte ich kleine Schildchen in jede Mulde und malte zusätzlich noch Lagepläne. Für den Laien sehen Tomatenpflanzen ja alle gleich aus.
Zuerst lief auch alles prima. Nach zwei Wochen spitzen die ersten zarten Blättchen und so erblickte ein Pflänzchen nach dem anderen das Licht meiner Küche. Ich versorgte sie liebevoll, ich sprach mit ihnen, wie man das halt so macht mit kleinen Kindern.
Dann kam der Moment, da ihnen ihre Wiegen zu klein wurden.
Draußen war alles zugeschneit und es dauerte ein paar Tage, bis ich genügend Töpfchen ausgebuddelt hatte.
Weil die Laufställchen nun aber verdammt viel Platz benötigten, passten sie im Verbund nicht mehr in meine Küchenfenster. Andere geeignete Zuchtfenster besitze ich aber leider nicht. Bereits nach zwei Tagen ging das mit dem Vergeilen los. Schwippelige hellgrüne Triebe, eindeutig: Die brauchten Licht!
Glücklicherweise setzte draußen Tauwetter ein, die Sonne kam zurück. Tagsüber trug ich die kleinen Pflanzen nun an eine windgeschützte Stelle hinters Haus, nachts holte ich sie in die warme Stube. Bereits am 2. Tag brachte ich die Namensschilder der alten Sorten durcheinander, am 3. Tag dann zusätzlich noch die Trennung von alten Sorten und F1. Egal: Kinder sind allesamt Kinder.
Ab da lief es recht gut. Etwa die Hälfte der kleinen Pflanzen überlebte die Tortour und wuchs kräftig heran. Dann kam der Mai: Zeit sie ins Freiland zu entlassen. In Kübeln unters Dach auf die Längsseite vom Haus.
Wie die Zinnsoldaten standen sie nun zitternd tagaus, tagein vor der Haustür, in einer langen Reihe bis zur Garage.
Nun erschloss sich mir auch, warum es gut war, dass die andere Hälfte es nicht geschafft hatte: Platz ist endlich.
Und dann ging der typisch deutsche Sommer los.
Ein Sommer, wie in meiner Kindheit: kalt, nass, Regen. Regen.
Die Tomatenzüchter unter Euch wissen, was das bedeutet.
Machen wir es kurz: Braunfäule, Krautfäule – alles, was Tomaten befällt, wenn das Wetter ist, wie es war, machte sich auf meinen Pflanzen breit. Ich war jeden Abend lange damit beschäftigt, schadhafte Früchte rauszuschneiden und von den Pflanzen die kranken Stellen zu entfernen, bevor die sich ausbreiten konnten.
Aufgrund meiner Daily Routine schafften es trotz der feindlichen Bedingen ab und an Tomaten bis zur Reife.
Alles in allem konnte man die Ernte jedoch vergessen und ich erkannte: Alte Sorten scheinen auch nicht widerstandsfähiger zu sein als Neuzüchtungen.
Bis auf eine Ausnahme. Galina! Die verhielt sich vom ersten Sproß an anders. Die runden Blätter sahen aus, wie die einer Kartoffel. Der Stamm wuchs kerzengerade in die Höhe, die Blätter blieben auch beim Reiben geruchsneutral und verströmten nicht den Geruch von frisch aufgeschnittenen Tomaten. Außerdem gab es nur einen schlanken Haupttrieb, es war nicht nötig, wilde Triebe auszugeizen.
Als sich endlich Blütenansätze zeigten, legte sich auch meine Sorge, es habe sich ein Unkraut unter mein Potpourri aus dem Internet gemischt. Blockierten schließlich drei Kübel an der Hauswand.
Die Früchte klein und gelb, stramm an einer Traube, ähnlich Cocktailtomaten. Galina opferte der Braunfäule zwar ihre Blätter, verteidigte aber ihren Nachwuchs.
Ganz dem ursprünglichen Plan folgend, beschloss ich, Galina weiterhin anzubauen. Zum Samennehmen war trotzdem Eile geboten, nicht dass auch Galina noch überrannt wurde.
Ich spähte drei besonders kräftige Exemplare aus, leider waren die noch ein bisschen grün. Besser ich gab ihnen noch zwei Tage am Strauch.
So weit kam es aber nicht – am nächsten Nachmittag waren die drei verschwunden.
Auf der Stelle trennte ich die nächsten drei Tomaten von ihrer Nabelschnur – auch wenn sie kleiner von Wuchs und grüner waren. Ich nahm die drei mit in die Küche und versteckte sie hinter der Mikrowelle. Sicher ist sicher.
War nicht sicher genug, am nächsten Tag waren die drei ebenfalls weg.
Langsam wurde ich ärgerlich, zumal draußen nur noch grasgrüne Kullern hingen. Ungeeignet für Saatgut.
Ich sprach ein ernstes Wort mit meinen Mitbewohnern und erklärten ihnen lautstark, warum es wichtig war, dass sie meine Pläne nicht weiterhin durchkreuzten!
Mein Pubi fand das unnötig; mein Kleinstes meinte, es würde auch Gurken mit zur Schule nehmen. Nur mein Mann unterstützte mich.
Als letzte Woche endlich wieder drei Früchte nachreiften, passte eigentlich alles. Sonnengelb, kräftig und makellos trug ich sie vorsichtig in die Küche. Doch als ich gerade das Messer ansetzen wollte – klingelte das Telefon. Für den Rest der Woche war ich mit einem Job beschäftigt. Die Tomaten versteckte ich: An drei verschiedenen Plätzen im Erdgeschoss!
Jetzt hatte ich nun letzte Woche so konzentriert gearbeitet – ich erinnerte mich schlicht nicht mehr der sicheren Plätze. Nur eine Einzige ist wieder aufgetaucht!
Die liegt gerade neben mir auf der Tastatur!
Die begleitet mich jetzt so lange, bis ich mich gleich um sie kümmere!
Die lass ich jetzt nicht mehr aus den Augen!
Ich geh noch kurz mit ihr aufs Klo, dann stöpsel ich das Telefon aus und auch die Türklingel!
Selbst wenn Feueralarm losjault: Ich bin nicht da!


In Deutschland ist alles intensiv beregelt und selbstverständlich bleiben auch im Mülleimer keine Fragen offen. Wir sortieren in kunterbunte Eimer – Farblegende nebst Erklärung schenken wir uns, wir Bürger können das!
Die Familie meiner Kollegin geht sogar besonders sorgfältig vor: Die putzen ihren Müll, bevor sie ihn wegschmeißen! Da wird der Joghurtbecher gespült und der Aludeckel vom Plastik gezupft: Soll ja beim Recycling keine Verunreinigungen geben!
Im Moment überlegt die Kollegin allerdings, ob es nicht ratsamer sei, künftig gleich ganz auf Joghurt verzichten. Die Familie sammelt noch die Argumente.
Nun haben wir uns ein wenig auf den Stoff eingestimmt, kommen wir zu dessen Abfuhr. Auf die Zeiten ist Verlass, da muss schon höhere Gewalt passieren, damit was außer der Reihe läuft.
Oder was Entzückendes: Feiertage! (HURRA!) – da verschiebt sich’s auch schon mal. Dann allerdings geplant und anscheinend mit System, der kundige Müllmacher kann das irgendwo einsehen.
Also anscheinend, der Kundige und irgendwo!
Merken Sie schon: ich nicht. Kann die Pfingstsamstage gar nicht zählen, an denen ich früh aus dem Tiefschlaf gerissen aufrecht im Bett saß, weil die Müllabfuhr draußen die Tonnen durch die Gegend schmiss. Unsere nicht dabei: so eine Scheiße.
Indes wunderte ich mich immer mehr, wieso mein Nachbar das mit den Tonnen drauf hatte und seine immer passgenau auf Termin am Bordsteig platziert. „Musst du App runterladen, da steht alles drin!“, meinte er. „Oder du fragst mich.“
Ich entschied mich fürs Fragen, das ist auch geselliger.
In der Theorie klingt der Plan gut, praktisch scheiterte er daran, dass, wenn mir gar nicht in den Sinn kommt, dass ich eine Frage stellen müsste, ich die auch nicht anbringe. Ging also alles im gewohnten Trott weiter: Feiertag, Müllabfuhr – Mischpoke und Eimer pennen.
Jetzt werde ich aber auch älter und lerne dazu. Innerlich war ich fast bereit, mir die schlaue MüllApp aufs Handy zu ziehen – mir war nur nicht klar, wo ich die herkriege. Den Städtischen schien das Problem auch zu dämmern, denn eines Tages hing dieses durchdachte Erinnerungsschildchen an meiner geleerten Tonne, mit QR-Code für den direkten Zugriff:

Ich also flugs die App installiert. An den nächsten drei Wochenenden klingelten die mich jeden Sonntag früh um 7:00 wach, um mich zu erinnern, dass ich ja nicht vergessen sollte, Montag den Eimer an die Straße zu rollern!
Ey …
Das habe ich mir deswegen drei Ruhetage lang gefallen lassen, weil ich nicht fand, wo man das abstellen konnte. Jeden Sonntag – während draußen der Hahn plärrte – fummelte ich an einem anderen Knopp. Einschließlich „Stumm-Schalten“ – brachte alles nichts: Sonntag drauf, Schlag Sieben: neuer Terror.
Nach besagten drei Arbeiterfeiertagen war ich drauf und dran, die App wieder zu löschen. Natürlich unter reger Kommunikation mit der Familie, in deren Verlauf auch ein paar Beleidigungen ausgetauscht wurden, woraufhin sich mein Kleinstes der Signaltöne annahm.
Jetzt spricht die App jedenfalls nicht mehr. Optische Erinnerungen gab es schon vorher keine, jedoch kann ich jetzt gezielt nachlesen, wenn ich mir unsicher bin. Theoretisch war ich mit der halben App also nur einen winzigen Schritt weiter, in der Praxis hatte ich mich aber so intensiv mit dem feiertäglichen Sonderleerturnus befasst, dass ich es jetzt drauf habe: Ich gucke einfach immer, wenn ein Feiertag ansteht, ob sich was ändert!
Wäre ja nun eigentlich alles gesagt und man könnte meinen heutigen Beitrag als Werbung für die App der Städtischen betrachten …
Doch Montag trug sich Folgendes zu:
Die Müllabfuhr traf pünktlich um 8:00 Uhr zum Mülleimer-Halma ein. Es goss in Strömen und laut meiner WetterApp sollte das auch den ganzen Tag lang so bleiben. Ich also in der Kaffeepause kurz raus, gelbe Tonne von neben der Haustür unter den Arm geklemmt und damit zur Straße gesaust, um die Gelbe statt der Grünen dort zu lassen.
Die Braune würde zwar am nächsten Tag auch dran sein, aber das konnte ich später erledigen. Hauptsache schon mal einen nassen Weg erledigt!
Schnell wieder rein und genüsslich eine Runde den Hintern auf dem Schreibtischstuhl plattgesessen. Keine zehn Minuten später dürstete mich erneut nach einem Kaffee und ich begab mich zur Tränke. Während der eintröpfelt, schaue ich immer aus dem Fenster, weil Gucken ins Grüne entspannt die Augen. Auch die Nachbarn gegenüber hatten die Eimer schon gewechselt. Die grüne Tonne war von der Straße verschwunden, stattdessen standen die Gelbe und die Braune einträchtig nebeneinander im Regen. Ich beugte mich ein wenig vor, um weitere Häuser ins Blickfeld zu bekommen. Bei den schrägen Nachbarn rechts und links lümmelten auch komplett durchcolorierte Eimerreihen am Bordstein.
Da hatte ich gleich früh richtig schön für Stimmung gesorgt und den Nachbarn die Schrittzähler hochgescheucht.
Wohl weil das so nett von mir war, hörte es kurz darauf auf zu pissen.
Das freute mich, ich hatte einen Termin in der Stadt, jetzt konnte ich das Fahrrad nehmen. Packte also fix meine Plörren zusammen und schwang mich in den Sattel. Ich war schon den halbe Berg hinunter geritten, da fiel mir plötzlich auf, dass vor fast jedem Haus der gelbe und der braune Eimer standen. Hatte ich etwa die ganze Straße verrückt gemacht? Diese Woche beglückte uns doch gar keinen Feiertag. Oder doch? Seit wir Pandemie haben, weiß ich nicht mal, in welchem Jahr wir leben. Sollte ich umkehren und sicherheitshalbe auch meine Grünzeug-Tonne platzieren?
Mittlerweile war ich unten angekommen. Runter gehts halt schnell. Kurz vor der Kreuzung stoppte ich: die MüllApp befragen. Handy raus – kein Netz. So viele Leute konnten sich nicht irren! Also strampelte ich den Berg wieder rauf. Das dauerte eine Weile, die Sonne kam raus, ich schwitzte schön.
Vorm Haus im Wlan dann doch noch die App gecheckt: Abfuhr selbstverständlich erst morgen!
Hatte ich den ganzen scheiß Berg für die Katze bezwungen!
War ich vermutlich die Einzige, die meine Pisswetter-Aktion vom Morgen wirklich gestresst hatte.
Wo wir das Lehrbeispiel mit der Schadenfreude nun auch behandelt haben: Was will sie denn jetzt noch?
Leute, das ist halt immer noch nicht alles!
Heute kündet der Kalender jedenfalls von Dienstag: dem reguläre Abholtag der zwei strittigen Mülleimer. Ist auch schon ein paar Stunden her, dass die Müllabfuhr draußen randalierte.
Gerade wollte ich meine beiden Tonnen reinholen, was mussten meine Augen schauen?
Nur eine Tonne leer!
Die braune Tonne noch randvoll!!
Da hatte ich mich so intensiv mit dem Müllthema auseinandergesetzt, wie mit Sicherheit kein Zweiter hier auf meiner beschaulichen Straße – und dann lassen die Hornochsen ausgerechnet meinen Eimer stehen?
Es dankt einem einfach keiner. Am besten, ich lasse es wieder laufen wie früher.
Da rege ich mich auch weniger auf!

Hi Leute,
ich will Euch noch mal einen vom Gärtnern erzählen! Hatte mich ja letztens mit den Tomaten so schön ins Beet reingedacht. Außerdem muss man auch manchmal seine Standbeine neu kreuzen, kann ja nicht immer nur vom Fahrradfahren und vom Einkaufen erzählen. Per Dekret überstandene Pandemie hin oder her.
Ich esse nicht nur gerne Tomaten, ich mag auch gern Salat. Da ich nur ein Mal wöchentlich zum Shoppen aufbreche – und das noch dazu mit dem Fahrrad – liegt es auf der Hand, das Grünzeug selber anzubauen.
(Dass auch heute trotz thematischen Wechsels Fahrradfahren und Lebensmittelbeschaffung untergebracht sind, beschert mir im Herzen eine warme Zufriedenheit)
Konkret dreht sichs heute um Schnecken.
Wie man die aus dem Gemüsebeet fernhält, habe ich noch nicht herausgefunden. Der theoretischen Ansätze gibt es reichlich: Von Sägespäne ausstreuen oder Kaffeepulver, über Bierfalle, Zerteilen, bis hin zum Auslegen von Schneckenkorn. Von rückwärts betrachtet alles sehr brutale Unterfangen. Die Mittel hingegen, die keinem der Phlegmatiker an die Schleimhaut gehen, „helfen“ dafür nichts. Zumindest nicht, wenn sich solche Massen zum großen Fressen versammeln wie bei mir.
Ich jedenfalls kann keine Schnecke töten. Ich spreche sogar mit denen. Also ich schimpfe, während ich sie am Schlafittchen aus der Nervzone verfrachte, dass sie gefälligst Gras spachteln sollen.
Evolutionär ist das auch nicht zu viel verlangt, das begründet sich schon damit, dass Schnecken seit 500 Millionen Jahren über die Erde kriechen, hingegen sich erst 200 Millionen Jahre später der Mensch dazugesellte. Und da betrieb der noch lange keinen Ackerbau!
Mittlerweile haben uns die Schnecken dermaßen überrannt: Nicht mal mehr Schnittlauch und Zwiebeln gedeihen in meinem Hochbeet.

Doch der personalisierten Werbung in den sozialen Netzen sei es gedankt: Letztes Frühjahr las ich einen Artikel über die ultimative Schneckenbarriere: Eine Beeteinfassung aus Kupfer!
Kupfer könnten Schnecken angeblich nicht überwinden; wenn sie feucht drüber schleimen, würde ihnen das eine Art Mini-Stromschlag verpassen.
Klang logisch. Wenn man mit der Zungenspitze sacht gegen die Gießkanne titscht, kribbelt das auch so komisch.
Kupfer, das Fort Knox des Gemüsebeets!
Flugs dem Gatten erzählt und der stante pede recherchiert, wo man eine Einfassung aus der Wunderwaffe ohne Blutvergießen herkriegt.
Leider scheiterte das Unterfangen gleich während der nächsten Viertelstunde am Preis. Für 600 Oken ließe sich der Salat vermutlich für die nächsten Jahre bis auf den Küchentisch liefern lassen.
Doch dann fiel der Blick meines Mannes plötzlich auf unser Carportdach. Das ist rundherum mit Kupfer verkleidet. Konnte es etwas Passenderes geben?
Weil wir mal wieder im Lockdown lebten, graste ich im Internet nach schwarzen Maurerkübeln. Die sind viel günstiger als riesige Blumenkästen. Ich bestellte einen 10er Satz, der wurde auch zügig per Spedition geliefert. Eine Woche später kam die gleiche Fuhre noch einmal – weil der Rückversand aber so teuer gewesen wäre, durfte ich alle behalten.
Das freute mich, trotzdem wollte ich mich nicht gleich zu Anfang übernehmen und platzierte nur das Starterset auf dem Dach.
Die Beschaffung der Erde gestaltete sich ebenfalls schwierig: Pro Kübel gingen drei 40l-Säcke drauf. Ins Auto passten aber nur zwölf je Fahrt. Weil alles zusammen kräftig ins Geld ging, mischten wir die Befüllung selber. Unten rein kleingeschnittenen Zweige, dann eine Lage Grünschnitt und Kompost, gefolgte von einer dicken Schicht Mutterboden aus dem Garten und nur zuoberst, für die zarten Wurzelchen am Anfang, ein paar Zentimeter Blumenerde aus dem Sack. Samen in den Boden, fertig.
Alles klappte prima, selbst die zwei Freischwimmertage infolge des Unwetter vom Juni verkraftete mein buntes Salatgemisch besser als mein Keller.
Kurz darauf begann die Ernte und wir schwelgten bis zum Urlaub in den feinsten Salaten. Es gab Ruccola, Kopf-, Eisberg- und Pflücksalat und noch ein paar andere, deren Namen ich vergessen habe. Ein grünes Gedicht!
Pünktlich zu Urlaubsbeginn waren die Wannen abgeerntet. Als ich mit dem letzten Kopfsalat im Arm vom Dach steigen wollte und über die halb zugewachsenen Trittsteine balancierte, die zum Schutz der klassischen Dachbegrünung auf Höhe des Fensters liegen, knackte plötzlich etwas laut unter meinem Schuh. Klang wie das Haus einer Weinbergschnecke, fühlte sich auch so an. Mich durchzuckte es.
Sacht hob ich meinen Fuß. Die Szenerie glich einem Massaker: Die arme Schnecke total zermatscht. Das tat mir fürchterlich leid, wenigstens hatte sie nicht gelitten. Aber wie, zur Hölle, war die aufs Kupferdach gekommen??
„Wird vom Baum gefallen sein“, meinte mein Mann.
„Oder eine Krähe hat sie hingetragen“, überlegte mein Kleinstes.
In dem Moment rauschte mein Pubi in die Küche, er war auf Nahrungssuche. „Wo wir gerade beim Thema sind! Du könntest die Schnecken auch kochen. Aber würz gescheit!“
Das Kleinste schüttelte sich. „Ich will keine Schnecken essen!“
„Muscheln isst du doch auch! Schlabberzeug zwischen harter Schale. Ist auch nichts anderes.“
„Die gucken aber nicht so süß.“
„Wenn die Mutter nicht wieder am Salz spart, schmecken die bestimmt lecker!“
Nach den Sommerferien kletterte ich erneut aufs Dach und vollzog die Nachsaat: prognostiziertes Ernteglück für in sechs Wochen .
Weil es unterdessen ständig regnete, sodass ich mir das Gießen sparen konnte, kümmerte ich mich nicht. Lediglich nach vierzehn Tagen spitzte ich kurz von der Leiter, ob die Samen aufgegangen waren. In sämtlichen Maurerwannen sprießte es gleichmäßig zart und grün: Mir tropfte im Voraus der Zahn.
Irgendwie hatte ich dann mal wieder eine Menge um die Ohren und erst nach mehr als zwei Monaten fiel mir der Salat wieder ein!
Mitten im Satz sprang ich vom Schreibtisch auf, schnappte mir in der Küche eine Schüssel und kletterte aufs Dach. Voll der Vorfreude.
Wohl weil ich den Job gedanklich mitgezerrt hatte, peilte ich das Übel erst, als ich mit der Schere in der Hand vor der ersten Wanne niedergekniete. Die war voller Schnecken!
Die zweite auch!
In allen Wannen! Kriechende Heerscharen!
Mit Haus und ohne! Kein einziges grünes Blatt!
Kupferblech hält jedenfalls keine Schnecke auf!
Das habe ich gerne für Euch ausprobiert, Leute ❤


Gestern habe ich früh mal wieder kräftig prokrastiniert. Anstatt mich mit einer Neuausrichtung auseinanderzusetzen, schwatzte ich online mit meiner Freundin Sonja.
Wir tauschten uns interdisziplinär auf Threema aus und zur Verdeutlichung ihres Standpunkts schickte sie mir irgendwann ein Foto, auf dem sie die wichtigsten Passagen eines Textes mit grünen Pfeilen markiert hatte.
Ich war überrascht. „Wie hast du das mit der Bildbearbeitung hingekriegt? Das will ich auch können! Erklär mal!“
„Hä?“, fragte Sonja. „Ich verstehe nicht, was du nicht verstehst.“
„Ich kann Bilder nur über Whatsapp verzieren.“
„Na und? Reicht doch.“
„Nein, reicht nicht! Ist umständlich.“
Danach passierte erst mal eine Weile nichts, Sonja schien abgetaucht.
War sie aber nicht! Ein halbe Stunde später – ich hatte endlich in meine Arbeit gefunden – rumpelte meine Telefonzelle. Eine Meldung nach der anderen rauschte rein: Sonja hatte mir eine detaillierte Dokumentation erstellt!
Im Geiste sah ich mich sogleich als jubilierenden Crack der Threema-Bildbearbeitung! Ich schickte Sonja 1000 Küsse durchs www.
Gleich nach meiner Liebesbekundung probierte ich den Leitfaden aus.
Funktionierte aber nicht. Ich konnte keinen einzigen Screen umsetzen.
Sonja reichte es schließlich. „Du mit deinem bescheuerten IPhone! Kauf dir endlich was Gescheites!“
Wir debattierten kurz, das lasse ich aber weg – bei Handys kommt es eben darauf an, welchem Lager man angehört.
Sonja wäre nicht Sonja, hätte sie nicht noch einen weisen Ratschlag für mich gehabt. Einen, den ich wirklich gar zu gern in die Tat umsetze! „Schreib einen Blogbeitrag und frag deine Leute! Die wissen immer Rat!“
So wende ich mich nun vertrauensvoll an Euch.
Liebe Leute,
Kann mir einer erklären, wie ich bei Threema ein Bild befummele, ohne es vorher umständlich einem aus der Familie per Whatsapp zu schicken? Das führt nämlich häufig zu Missverständnissen, gerne schlimmer. Meinem Pubi habe ich beispielsweise letztens eines in die Schule gesandt. Während der Mathe-Klausur. Das regte ihn ziemlich auf, vor allem aber den Lehrer. Zusätzlich sorge ich mich nun auch noch ums Zeugnis …
Kann mir jemand helfen?

Mein Pubertikel fährt seit einer Weile jeden Morgen mit dem Auto nach Düsseldorf. Wie das bei jungen Menschen häufig ist, braucht er viel Schlaf. Deshalb reizt er seine Abfahrtszeit bis zum Gehtnichtmehr aus. Gerne auf unter Null – aber das muss er selber wissen, er ist alt genug.
Weil er nun frühmorgens so gestresst ist, frühstückt er im Stau. Eine Schale Müsli mit viel Milch – lagert während der Fahrt im Flaschenhalter der Konsole. Wegen der Balance eignet sich dafür nicht jede Schüssel: Es muss eine mit einem kleinen Standfuß sein! Dann schwappt das auch in der Kurve nicht über. Außer bei Vollbremsung – gegen so viel Schwung ist kein Fuß gewachsen.
Weil mein Youngster es außerdem als überflüssig ansieht, abends seine Tasche mit rein ins Haus zu nehmen, hat er morgens auf dem Weg zum Parkplatz schwer zu schleppen. Tagesaktueller Buchbedarf, Brotdose, unterm Arm zwei Trinkflaschen- oben auf dem Turm trohnt sportlich die Müslischale.
Da geht schon mal was schief. Kurz vorm letzten Lockdown fiel dem Knaben alle paar Tage eine runter. Wir kamen porzellanmässig zwar noch klar, aber weil ich mich sorgte, erstand ich am allerletzten offenen Tag in einem Ramschladen, als ich noch eilig Acrylfarben für das Kleinste einkaufte, zwei Schüsseln. Erst mal nur zwei, sollte sich stilistisch ja in unseren Haushalt einfügen.
Daheim angekommen kriegte ich bald einen zuviel. Die dickärschigen Hochwänder passten mit den Füßen nicht in das Nest vom Flaschenhalter – und was noch viel schlimmer war: deren moderne Schlammfarbe ganz und gar nicht zu meiner alten Holzküche!
Ließ sich aber leider nicht mehr korrigieren, die Läden waren ja nun alle dicht.
Nichtsdestotrotz veränderte mein Pubertikel nichts an seinen Lastenwegen und so schrumpfte unsere Schüsselbestand weiter zusammen. Das ging so weit, dass der Bengel eines Morgens die Lieblingsschüssel vom Gatten aus der Spülmaschine fischte.
„Was wird das?“, ranzte der ihn auch sogleich an.
„Du willst ja wohl nicht, dass ich in der Schule vor Hunger nicht denken kann!“, blaffte der Knabe zurück.
„Wehe du schmeißt meine Schüssel runter!“ Villeroy & Boch übrigens, Farbe Tannengrün.
„Doch. Am besten ich werf sie zum Auto!“
Der Gatte ließ ihn trotzdem ziehen, Eltern fühlen sich eben für den schulischen Erfolg ihres Nachwuchses verantwortlich. Ging auch alles gut, bis zum Abend.
Der Scheinwerferkegel schwenkte in die Einfahrt, mein Pubi stieg aus und suchte seine Plörren zusammen. Er stapelte seinen obligatorischen Turm, den trug er so, dass er die Schüssel unterm Kinn festklemmen konnte.
Er schwankte zur Tür und kriegte auch den Schlüssel heil aus der Hosentasche gefummelt. Dann machte er mit ausgestrecktem Arm einen Schritt auf den Abtreter zu – als plötzlich etwas schrill aufkreischte. Gleichzeitig spürte mein Pubi einen scharfen Schmerz in der Wade.
Erschreckt sprang er aus der Gefahrenzone, weswegen er mit der Schulter gegen den Türrahmen krachte, woraufhin es auch sogleich heftig schepperte und klirrte. Modell Tannengrün und der Löffel, beide mehr oder weniger im Eimer. (Die schwarze Nachbarskatze ist seitdem auch noch nicht wieder aufgetaucht!)
Ich tat jedenfalls so, als hätte ich nichts mitbekommen; der Vatter des Knaben weilte, Gott sei es gedankt, noch beim Broterwerb.
Am nächsten Morgen fuhr mein Pubi hungrig zur Schule.
Aber nur für eine Stunde. Den übernächste Sitznachbarn ereilte die Pandemie und so war es das erstmal für meinen Sohn.
Wohl weil ich das mit den Schüsseln to drive eh nicht hätte lösen konnte, machten die die Bildungsanstalt zu.
Die Institutionen meiner restlichen Familienmitglieder auch und so frühstückten wir nun jeden Morgen gemeinsam zu Hause. Müsli gab es aus Suppentellern oder wer wollte, gleich aus der Salatschüssel. Je nach Befindlichkeit und Fassungsvermögen der Personen.
Und dann geschah etwas für mich Unerwartetes.
Ich guckte mir die beiden vom kürzlichen Fehlkauf schön!
Jeden Morgen gefielen mir die Schlammfarbenen nun besser. Nach der vierten Woche fühlte ich mich dermaßen verzückt, dass ich zu meinem Mann sagte: „Wenn der Lockdown vorbei ist, fahr ich als allererstes wieder in den Ramschladen! Dort kaufe sämtliche Schüsseln auf, die die noch haben! Alle nehm ich!“
Hätte ich das mal besser für mich behalten!
Oder hätte ich mich zumindest wegen der Mengenangabe sozialer geäußert und dabei solidarisch an die Mitmenschen gedacht, denen sich unterm Lockdown ebenfalls ein Bestandsproblem an Müslischalen entwickelt hatten!
In der folgenden Nacht brannte der Laden nämlich ab!
Lichterloh!
Der ganze Gebäudekomplex!
Traurig betrachtete ich am nächsten Tag die Bilder vom Brand in der Tageszeitung. Weiter hinten lag ein Prospektbeileger drin. Ein einziger nur, lohnte sich ja im Moment nicht. War die Printreklame von ebenfalls einem Ramschladen, aber einem für Restposten. Weil der auch Lebensmittel im Sortiment hat, blieb der auch während des Lockdowns offnen. Gepriesen im Prospekt wurden Leinwände und Mist – ich interessierte mich nur für das Erste. Muss ja immer an Beschäftigungsnachschub für mein Kleinstes denken.
Ich also freudig in den Laden gesaust – hatten die sämtliche Regale mit Malerplane verhüllt. Nur die Lebensmittel im Eingangsbereich und mit Flatterband markierte schmale Gänge zu den Angeboten waren frei zugänglich.
Schnell ratterte ich mit meinem Einkaufswagen bis ganz nach hinten zu den Leinwänden. War ich aber die Einzige, Kunst ist eben nicht jedermanns Sache.
Auf dem Rückweg mit den Dingern ließ ich mir dann Zeit, die Schlange an der Kasse reichte bis weit in den Laden hinein. So kam es, dass ich auf eine gelupfte Malerplane aufmerksam wurde. Sie hing halb offen zwischen Gang und Flatterband, so als wenn einer sein Tippi zum Durchlüften aufgesperrt hätte. Was war hier los? Ich bückte mich, um reinspähen zu können:
Drei Müslischalen! Kunterbunt! Ganz allein! Aus Steingut!
Mein Herz machte einen freudigen Satz!
Wenn das kein Zeichen war!
Vorsichtig angelte ich die Schalen raus und setzte sie in den Einkaufswagen. Dann schön gemächlich damit zur Kasse gerattert, nicht dass noch was kaputt ging.
„Wo haben Sie die denn her?“, fauchte mich die Kassiererin an. „Das ist verboten!“
„Die Plane war offen, ich hab nichts gemacht!“, verteidigte ich mich erschrocken.
„Dann hat jemand anders die Plane aufgerissen. Ist aber trotzdem verboten. Darf ich Ihnen leider nicht verkaufen, junge Frau.“
„Aber ich brauch die so dringend. Mein Sohn hat alle paar Tage eine fallen gelassen. Wir haben keine einzige mehr! Und die Läden sind doch schon ewig zu“, brach es aus mir heraus.
„So einen habe ich auch daheim! Packen Sie sie schnell ein, damit das keiner mitkriegt!“
Ich hätte die Kassiererin küssen können! War aber ebenfalls verboten. Vielleicht hol ich das nach, wenn der ganze Spuk vorbei ist.
Die Schalen jedenfalls: ein Gedicht. Fügen sich farblich harmonisch in meine alten Küche ein, Standfuß genau im richtigen Flaschenhalter-Durchmesser fürs Auto – als gehörten die schon immer zu unserem Interieur.
Normalerweise wäre hier jetzt Ende gewesen, sind ja alle zufrieden.
Doch das neue Schuljahr hat begonnen. Und mein Pubi tuckert morgens wieder nach Düsseldorf. Als er heute Morgen am Fenster vorbeifuhr, stand die Müslischale auf dem Autodach …
Wenn der Bengel heute heimkommt! Dem zieh ich die Hammelbeine lang!


Kann die eigentlich auch mal von was Anderem erzählen als vom Fahrradfahren und Einkaufen?
Kann die.
Wird aber eher mau, passiert ja immer noch nicht wieder so viel.
Bis auf letzten Feiertag, da war hier fett was los!
Los ging es damit, dass die WetterApp auf einmal 100% Gewitter verkündete.
Ich voll den Schreck gekriegt! Alle paar Minuten erneut das Wetter gecheckt: Nichts tat sich. Auf dem Bildschirm blieb es dabei: ab 22:00 Uhr Blitze und Schiffstauregen, die ganze Nacht lang.
Ich kriegte das Flattern und mein Mann sagte den Grillabend mit seinen Jungs ab. Meine Freundin Moni fragte irritiert, weswegen wir uns so übers Wetter aufregen würden. Gewitter wären doch eine gemütliche Naturerscheinung, sofern man im trockenen Haus säße.
Doch genau da hakt es bei uns!
Trotz dass wir auf einem Berg wohnen, laufen hier in den umliegenden Häuser bei Unwetter die Keller voll. Das Wasser, das drinnen landet, stürzt nicht etwa als Lawine durchs Fenster – nein: Es kommt von unten. Aus der Kanalisation, aus den Kabelschächten, den Wänden …
Woran liegt das?
In unserer beschaulichen Stadt wird das mit dem Abwasser offensichtlich von Schildbürgern geregelt. Eine grüne Fläche nach der anderen wird bebaut und versiegelt. Schön mit Häusern, Garagen und Nebengelass und drumherum alles gepflastert, wie man das heute gerne hat. Das Niederschlagswasser, das ursprünglich im Boden versickerte oder sich sonst wo seinen Weg suchte, wird schön geordnet der Kanalisation zugeführt.
Die Abwasserrohre sind in weiten Teilen aber noch die der urspünglich spärlichen Besiedelung der Gegend. Bei Starkregen ist die maximale Durchflussmenge in den Rohren schnell erreicht – und dann drückt das Wasser eben da raus, wo der Widerstand geringer. Wir und unsere Nachbarn sind somit Teil der städtischen Kläranlage, oder vielleicht werden wir auch als eine Art Staustufe betrachtet. Wenn zu viel da ist, wird bei uns zu Hause zwischengelagert, bis die Städtischen wieder genügend Platz haben. Ehrenamtliche Maßnahme, versteht sich.
Aber lassen wir das Theoretische mal beiseite und finden wir uns gemütlich zur Show in meinem Kellergeschoss ein!
Das letzte heftige Unwetter lag schon ein paar Jahre zurück und wir waren leichtsinnig geworden. Wir hatten zusätzliche Wohnbereiche in den Keller verlagert: Mit dem Schlafzimmer waren wir runter gezogen (Im Sommer ist das megageil!) und mein Mann hatte seinen Probenraum in den breiten Flur verlegt. Die Kinder werden eben größer, die freuen sich über mehr Raum alleine unterm Dach. Gibt Dinge, die will man als Eltern auch besser nicht mitkriegen!
Jedenfalls setzte an jenem Feiertagsdonnerstag mit einer halben Stunde Verspätung stürmischer Regen ein. Er peitschte an die Fenster, er drosch aufs Dach – weil aber kein Blitz zuckte und auch kein Donner krachte, flätzten wir relativ relaxt auf dem Sofa. Nach einer Weile ging mein Mann die Kellerräume überprüfen.
„Alles ruhig“, kam er kurz darauf zurück und nahm sich ein Bier.
„Muss das sein?“
Mein Mann nickte und entkronte die Flasche.
Der Regen drosch weiter ungebremst aufs Land. Plötzlich befahl mir eine klare Stimme im Kopf: „Marsch, in den Keller!“
Normalerweise höre ich ja nicht, wenn mir einer was anschafft – aber beim Keller krieg ich das große Rennen!
Zuerst sauste ich in die Waschküche. Da ist wenig zu tun, das geht schnell: Teppich einrollen, der da zum Höhenausgleich über der Sickergrube liegt; Bügelbrett und Bügeleisen raus auf die Kommode und zum Schluss die riesige schwarze Baumarktwanne so unterm Waschbecken positionieren, dass sie das überlaufende Wasser auffängt!
Anschließend in den Vorratskeller!
Da lagerte alles – schön wie beim Sitzkreis – auf dem Fußboden.
Ich stieß einen fäkalen Fluch aus. Solchermaßen motiviert begann ich dann eilig, Türme aus Sport- und sonstigen Taschen zu schichten, die meine Leute – einschließlich meine Wenigkeit – für gewöhnlich dort bis zum nächsten Gebrauch zwischenlagern. Es galt, so viele textile Behältnisse wie möglich aus der bodennahen Gefahrenzone in Sicherheit zu schaffen!
Im Lauf der vergangenen Unwetter hat sich bei uns eine Routine im Handling der Situation eingespielt: Während ich mit den Plörren im Keller beschäftigt bin, beobachtet mein Mann die Straße. Sobald sich die Wassermassen, die rechts und links am Bürgersteig den Berg heruntergeschossen kommen, in der Straßenmitte vereinigen, begibt man sich besser mit allen verfügbaren Mann, bewaffnet mit Eimern, Schüsseln und Lappen, runter. Hatte ihm der Nachbar gleich nach der feuchten Feuertaufe in unserem ersten Sommer hier verraten.
Mir ist solche Beobachterei zu meditativ – zumal die Straße nachts stockfinster liegt.
Ich achte stattdessen lieber auf die Geräusche im Haus.
Gurgelt der Küchenabfluss, bleiben noch exakt drei Minuten, bis es zur Sache geht.
So auch dieses Mal.
Das Spülbecken rülpste. „Gleich kotzt es!“, rief mein Mann runter.
„Habs gehört!“, rief ich rauf.
Während ich noch geschwind die Fließbarrieren aus alten Bademänteln auslegte, die sich in der Vergangenheit bewährt hatten, damit sich die Suppe nicht unkontrolliert im ganzen Kellergeschoss ausbreitet, baute mein Mann seinen Proberaum ab. Weil ihm das so früh einfiel, quoll das Wasser bereits aus der Wand, als er gerade mal die am tiefsten stehenden Gerätschaften auseinandergenommen und in den Heizungskeller bugsiert hatte. In drei Minuten schafft man halt nicht viel.
Wie es dann in seinem Reich weiterging, weiß ich nicht genau, denn in der Waschküche setzte Plätschern ein!
Das Waschbecken lief über. Gleichzeitig richtete sich ein Springbrunnen aus der Sickergrube auf – ein echt schönes Schauspiel. Romantisch wie in Sanssouci, fehlten nur die Fanfaren.
Ich hielt es für besonders pfiffig – im Nachhinein entpuppte es sich als ziemlich doof: Diesmal wollte ich das Wasser daran hindern, die komplette Waschküche zu fluten und legte die schwere Mantel-Fließbarriere knapp hinter der Fontäne aus.
Schnell stieg der Pegel an und ich begann zu schöpfen. Mit der Rührschüssel in zwei Eimer, schnell waren beide voll.
Ich hievte sie auf und watete durch den Flur zur Treppe. Im Erdgeschoss kippte ich den ersten Eimer ins Klo – da lief die scheiß Brühe nicht mehr ab! Im Gegenteil!
Es kam noch mehr von unten hoch!
Braune Suppe!
Bis zum Schüsselrand!
HILFE!!
„WOHIN MIT DEM WASSER?“, brüllte ich. Zur Haustür raus ging nicht, davor stand es ebenfalls zentimeterhoch. Hatten wir bei unserer allerersten Überschwemmung nämlich mitleidig hereingelassen.
„Kipp in den Wirlpool! Wird der wenigstens endlich mal genutzt!“
Ich schleppte meine Ladung also wieder nach unten und watete den Gang nach hinten. Als ich die Sauerei auf Höhe der Waschküche blickte, erkannte ich, dass der Kampf dort eh verloren war und entschied, meinen Mann im vorderen Teil zu unterstützen, denn dort kam Wasser aus drei Räumen an. Deshalb ließ sich dort auch besser schöpfen, denn hinter dem künstlichen Bademantelstaudamm sammelte sich das Wasser 10 cm hoch.
Schnell hatten wir zu optimalen Arbeitsteilung gefunden. Mein Mann schöpfte und ich schleppte. Zwischen den dicken Mauern ist halt wenig Platz. Wir schwitzten beide wie die Tiere.
Endlich, als der Whirlpool schon eine gute Füllmenge aufwies (wäre das Wasser klar gewesen, hätte man nach getaner Arbeit gut darin baden können), hörte das Plätschern in der Waschküche auf. Der Springbrunnen im Waschbecken beruhigte sich und auch der in der Sickergrube nickte ein.
Nach einer weiteren halben Stunden floß auch bei uns im vorderen Teil kein Wasser mehr nach und wir inspizierten die restlichen Räume. Im Vorratskeller standen die üblichen Pfützen, zum Glück war der ehemalige Kühlraum – in dem meine hochgeschätzte und seit Generationen weitervererbte Weihnachtdeko lagert – wie gewöhnlich trocken geblieben. Heizungskeller und Schlafzimmer ebenfalls.
In der Waschküche war das Wasser mittlerweile durch die Sickergrube abgeflossen – die Eisentür zum Kriechkeller hielt mein Mann geschlossen: „Auf die Schweinerei hab ich heute keinen Bock mehr, da guck ich erst morgen rein!“
Mich freute das, denn normalerweise ergoss sich beim Öffnen von dort eine Schlammlawine.
Es war mittlerweile halb zwei Uhr, wir waren durch …
Am nächsten Morgen waren wir dermaßen mit Aufräumarbeiten und erweitertem Informationsaustausch mit der Nachbarschaft beschäftigt: Wir vergaßen den Kriechkeller völlig. Erst am 3. Tag fasste sich mein Mann ein Herz!
Die nur einen Meter dreißig hohe eiserne Tür, die sich unter der Treppe befindet, kreischte und schrappte fürchterlich. Sie ließ sich nur mit vollem Körpereinsatz bewegen. Feuchtmoderiger Gestank aus zehn Verliesen schlug uns entgegen. Nicht bloß ob des wallenden Dunstes hielt ich die Luft an!
„Das gibt es doch nicht!“ Mein Mann riss mir die Taschenlampe aus der Hand.
„Liegt einer drin? Sind Fische mitgekommen?“ Entsetzt versuchte ich, an meinem Mann vorbei zu spähen. Ich konnte nichts erkennen, sein zusammengefalteter Körper füllte den Hohlraum unter der Treppe nahezu vollständig aus. „Jetzt sag schon! Was siehst du??“
„Das machen wir jetzt immer so!“ Mein Mann schraubte sich aus dem Hohlraum. “Das Wasser ist weg, kannst deine Eimer wieder wegstellen.“
Manchmal gibt es eben nichts Besseres, als der alten Weisheit zu folgen: „Lass’ liegen, erledigt sich von selbst!“
Trotzdem ist uns mal wieder klar geworden: Wir müssen uns besser vorbereiten! Mein Mann hat nunSandsäcke geordert und eine Tauchpumpe.
Sandsäcke hatten wir zwar schon nach der letzten Überschwemmung gekauft – finden wir aber nicht wieder.
Dieses Mal werd ich sehr gut darauf aufpassen!
Bleibt bloß noch die Frage: Wohin dann mit den gefüllten Sandsäcken? Wo lagern wir die in Friedenszeiten?
Jetzt fällt es mir auch plötzlich wieder ein …
Genau das war der Grund, warum die letzten verloren gingen!

Ich war mal wieder Grundnahrungsmittel shoppen. Muss ich von erzählen, passiert ja noch nicht wieder so viel!
Jedenfalls ich zur wöchentlichen Schlacht in den Laden geschneit. Ging auch alles recht flott – ich hab’s eben raus, wann nicht so viele Mitbewerber draußen rumtouren.
Bis ich mich an der Kasse anstellte!
Vor mir fünf Leute – offensichtlich alle mit weniger Fressern daheim als ich: Sämtliche Wägen waren nicht mehr als bodenbedeckt gefüllt. Wegen des Mindestabstands reichte die Schlange aber bis zum Bier. Ich mich unauffällig beim Frankenheimer eingereiht und still verhalten. Quatschte auch ansonsten keiner, ist ja wegen der Aerosole immer noch gefährlich.
„HIER STIMMT WAS NICHT!“, kreischte plötzlich eine schrille Stimme.
Ich fuhr zusammen und peilte aus der Deckung die Lage. Besser man ist vorsichtig, man weiß ja nicht, was nicht stimmt. Zwischen Überfall, Klima und Ungeziefer explodiert einem schon mal die Phantasie.
War jedenfalls alles nicht richtig, die Kundin an der Kasse fuchtelte mit ihrem Bon: „Ich habe ja wohl nicht für 19 EUR eingekauft!“
„Zeigen Sie mal her!“ Hilfsbereit beugte sich die Kassiererin aus ihrem Plexiglasverschlag und streckte die Hand aus.
Die Dame wich erschrocken einen Schritt zurück. „19 EUR! Zählen Sie immer das Datum mit?“ Trotzdem rückte sie mit spitzen Fingern den Bon raus. Schön auf Abstand, Corona und so.
„Butter 1,49; Milch 1,10; Spargel 8,99 …“
„8,99? Nix da! Ich habe extra gefragt! Ihre Kollegin sagte 3,79!“
„Wenn ich den Spargel übers Kassenband ziehe, kostet er 8,99.“
„Das zahle ich nicht! Ihre Kollegin sagte: 3,79!“
„Da muss sich die Kollegin geirrt haben.“
„Mir egal, ich zahle das nicht!“
„Gut, dann nehme ich den wieder raus.“ Sie drückte den Knopf des Sprechfunkgeräts an ihrem Gürtel und bat um Schützenhilfe von der Chefin. Fingerabdruck einscannen, oder was die da immer authorisieren müssen, damit an der Kasse was rückboniert werden kann.
Nun dauert das natürlich ein Weile, bis so eine Authorisatorin bis zur Kasse vordringt. Ich vermute, sie ist im Markt noch mit anderen Aufgaben betraut und dreht nicht bloß Däumchen, bis mal einer schellt.
Die Wartezeit nutzten die Dame und die Kassiererin für ein kleines Pläuschchen. „Ich kauf doch keinen Spargel für 8,99! Letztes Jahr hat der 2,99 gekostet!“
„Gegen Ende der Spargelsaison kann das durchaus vorkommen. Aber, schauen Sie, jetzt beginnt die Ernte gerade erst. Da wollen alle Leute Spargel essen und es gibt noch nicht so viel. Jetzt verkaufen wir den natürlich nicht so billig!“
„Halsabschneider!“
In dem Moment tauchte leider die Chefin auf: „Tach!“ Die Kasse machte freudig „Pling!“ und die Kassiererin zählte 8,99 ab. Sie drückte der Dame die Münzen in die Hand und wendete sich mit einem freundlichen „Hallo!“ an den nächsten Kunden. Ganz Profi – ich könnte nicht so schnell umschalten.
Die Dame jedenfalls auch nicht, denn sie wetterte los: „Hallo? Was ist denn jetzt mit meinem Spargel? Ich gehe hier nicht ohne Spargel raus!“
„War Ihnen doch zu teuer.“
„Will ich heute Mittag kochen!“
Der Herr vor mir stöhnte und pochte auf seiner Uhr herum; die ältere Dame noch eins weiter vorne verlangte energisch nach einer zweiten Kasse.
Nun ist der Kassenbereich dort im Laden seit der Pandemie künstlich dermaßen verengt – selbst wenn ich mich bemüht hätte, wären die zwei Drängler nicht vor mir an der anderen Kasse drangekommen. Unsere Warteschlange ließ sich einfach nur nach hinten abstückeln und in den nächsten provisorischen Absperrgang zwischen süße Quängelware reinstopfen.
So kam es, dass ich, die ehemals Letzte, dann als Erste draußen vorm Laden stand – hingegen die Spargelliebhaberin weiter an Kasse 1 ihr Vorhaben darlegte.
Nun zieht sich das manchmal ein paar Tage, bis ich eine Story fertiggeschrieben habe und tageslichttauglich auffrisiert. Im Konkreten sprossen bereits zwei weitere Spargel-Saisonwochen ins Land, es waren eben etliche Feiertage zu verschlafen und ausgiebig Fahrradfahren will ich ja dann schließlich auch.
Gerade eben blätterte ich durch die Tageszeitung. Rechts unten preist eine Eckfeldanzeige: Spargel zum Schleuderpreis!
2,99!
Endlich!
Ich bin jetzt voll erleichtert!
Endlich wird die Dame mit Sack und Pack den Laden verlassen!
Endlich kann sie heimgehen und kochen!
Und nächstes Jahr wartet sie vielleicht einfach ein bisschen geduldiger.
Ende der Spargelsaison: jährlich am 24.6.!
Haut rein, Leute! ❤

Hauptsach gudd gess!

Lassen Sie mich mal wieder einen aus dem Cycler-Alltag erzählen, das macht die Stimmung hier immer so schön heimelig!
Wir leben ja im zweiten besonderen Jahr. An meiner Mobilität hat das nichts geändert: Die meisten Wege erledige ich schon immer mit dem Esel – auch die Einkäufe für meine vierköpfige Familie. Weil ich wöchentlich nur ein Mal losreite, können Sie sich bestimmt vorstellen, wie schwer bepackt ich heimwärts den Berg raufschnaufe.
Auf dem Hinweg geht es noch. Da flitze ich als dynamische junge Bikerin auf der Straße. Im Laden altere ich um 50 Jahre und deswegen schleiche ich dann wie eine orientalische Gewürzkarawane auf dem Weg durch die Wüste meiner Hütte entgegen. Ich und meine Säcke schwanken auch so ähnlich.
Versteht sich von selbst, dass ich dabei die Straße meide! Will ich schließlich auch nicht, dass – wenn ich schon mal das Auto nehme – vor mir ein altes Mütterchen auf der Straße lang japst und dabei fast das Zeitliche segnet!
Auf dem Heimweg vom Laden muss ich auch ein paar Kreuzungen mit Fußgängerampeln überwinden. Im April ’20, also mitten im ersten Lockdown, fiel mir auf, dass eine Fußgängerampel nach der anderen vom symbiotischen Schaltzyklus sämtlicher Verkehrsampeln abgekoppelt wurde und am Schaft einen gelben Anforderungstaster erhielt.
Jetzt habe ich schon immer etwas dagegen, solche Tatsch-Dinger anzufassen. Ich finde das ekelig, auch ohne Corona!
Selten draufzuhauen, kann ich mich ja noch überwinden – aber pro Fahrt zigmal so ein Ding abzufingern: Das schaffe ich nicht.
So verlegte ich mich zuallererst einmal aufs Warten, im Vertrauen darauf, dass die Ampel sich von selber ihres ehemals normalen Zyklus erinnerte. Tat sie nicht.
Als ich kalte Finger kriegte, hielt ich nach weiteren Passanten Ausschau. Fußgänger wären auch willkommen gewesen.
Passierte aber ebenfalls nicht. (Das liegt daran, weil ich als dauerhaft Homeoffice-Schaffende es raus habe, wann sich die wenigsten Mitbewerber draußen rumtreiben.)
Heim kam ich irgendwann trotzdem, behalte das Procedere aus Gründen aber für mich.
Wo ich nun selber bekennende Fahrradfanatikerin bin, zwinge ich natürlich auch meine Kinder, den Drahtesel zu benutzen. Ob die das wollen oder nicht: Bei Wind und Wetter wird Fahrrad gefahren! (Also fast bei Wetter! Bei Wolkenbruch, Schneefall und Blitzeis habe ich ein Einsehen. Kommen aber zum Glück alle drei Sachen selten vor – Klimawandel hat halt auch was für sich.)
Letztens goss es bei uns im Pott mal wieder heftig. Es war Freitagnachmittag und bereits den dritten Tag am Schiffen. Das Kleine war mit der Freundin zum Shoppen geradelt, denn im weiteren Verlauf des Nachmittags wollten sie backen. Sie besorgten eilig die Zutaten und befanden sich durchgeweicht auf dem Heimweg. Voll der Vorfreude.
Doch zwischen den Mädchen und der Küchensause lag voraus noch eine große Kreuzung. Hochfrequentiert, Freitagnachmittag noch mal mehr als unter der Woche. In Fahrtrichtung geht es zweispurig drauf zu, im Kreuzungsbereich verbreitert sich das bergan um zwei weitere Spuren für die Linksabbieger. Dort sortieren sich auch grundsätzlich fast alle ein, denn geradeaus weiter geht es zur Stadt. Was will man schon da?
Befindet man sich mitten auf der Kreuzung und hat die erste Insel mit den schönen, immergrünen Sträuchern hinter sich gebracht, kommen noch ein paar Spuren aus anderen Richtungen und ein paar hochfrequentierte Ausfahrten aus Sammelparkplätzen hinzu – ein heilloses Durcheinander! Weil das so unübersichtlich ist, bin ich mit dem Fahrrad noch nie über diese Kreuzung gefahren. Das ist mir zu gefährlich! Stattdessen biege ich immer einen Kilometer früher in die Pampa ab. Ich bike ja eh gerne.
Nun war das Ziel der Mädchen aber die Küche der Freundin! Mein Prärieweg machte da fahrtechnisch keinen Sinn. Deswegen beschlossen die kleinen Damen, die Kreuzung vermittels Fußgängerampel zu queren.
Sie verließen also den Radweg, rollten hintereinander um die Fußgängerampel herum und stellten sich ordentlich nebeneinander auf. Eine drückte auf den Taster, dann warteten sie.
Wie sie da so standen, scherte plötzlich ein Polizeiauto aus dem fließenden Verkehr aus. Es hielt auf dem Bürgersteig an, ein Polizist stieg aus: „Was treibt ihr denn hier? Was soll das denn hier werden?“
„Wir waren einkaufen, wir wollen heim.“ Sind halt ehrliche Mädchen und brave noch dazu.
„Aber doch wohl nicht auf dem Bürgersteig! Das ist verboten!“
„Wir haben Angst, über die große Kreuzung zu fahren.“
„Ab dem neunten Lebensjahr müssen Radfahrer die Straße benutzen! Ihr seid ja wohl schon lange älter als neun! Wer Fahrrad fahren will, muss sich an die Regeln halten!“
„Ist gut.“ Hätte ich an der Stelle auch gesagt.
„Das will ich nicht noch einmal sehen!“ Die Fußgängerampel schaltete auf Grün, der Polizist wendete sich zu seinem Auto, die Mädchen stiegen auf. „UND ÜBER DIE AMPEL WIRD GESCHOBEN!“
Natürlich hat der Polizist recht: Das Angetatsche am Schalter zur Grünforderung gehört sich echt nicht!
Gerade jetzt in Pandemiezeiten gilt es das dringend zu vermeiden!
Am sichersten wird es sein, ich mache das wieder wie früher: Ich chauffiere die Kinder einfach wieder überallhin mit dem Auto!

Genetisch stamme ich aus einer Familie von Fahrradfanatiker, das erzählte ich ja bereits. Die Einzige, die bei uns aus der Art schlägt, ist meine Mutter. Sie kann nicht einmal radfahren. Weil es jedoch ansonsten ganz gut passt mit ihr, stört sich keiner daran.
Jetzt verhält es sich aber so, dass noch nie einer von uns beim Fahrradfahren was gerissen hat. Keiner von uns strampelte jemals Tour de France mit, auch keiner bei der Friedensfahrt. Letztere verfolgte ich dafür aber frühere genauestens in der Zeitung. Und da landen wir auch stante pede beim Grund meines lebenslangen Freizeitradler-Statuses: Die Helme – früher auch viel treffender Sturzkappen genannt!
Breite Riemen aus Schwartenleder waren das damals, die längs und quer um den oberen Teil der Murmel rumgeschnürt die Kopfform solchermaßen eingequetscht betonten, dass ich immer an einen hölzernen Schraubstock in einem Folterkeller denken musste. Die Rennfahrerhelme meiner Jugend sahen total bescheuert aus!
Vor allem kannte man die bei uns im Städtchen in ganz anderem Zusammenhang! Fernab vom Radfahren trugen solche Dinger nämlich auch die Klienten des Hauptarbeitgeber des Städtchens – in der Geschlossenen.
Seit frühester Jugend hatte ich solche Bilder im Kopf: Ich durchquerte das Krankenhausgelände, um meinen Opa von seiner Arbeit in der Küchenverwaltung abzuholen. Manchmal standen in den Gebäuden vergitterte Fenster offen. Schon von weitem hörte man dann Schreie, die nicht von dieser Welt zu stammen schienen. Wenn das mit den Schreien war, wäre ich am liebsten umgekehrt, wusste ich doch, dass, wenn die mich drinnen entdeckten, wieder einer seinen Kopf gegen die Gitterstäbe hämmern würde. So lange, bis ihn ein Pfleger wegzog.
Wie die Lederhelme in der Psychiatrie aussahen, wusste ich deshalb so genau, weil meine Mutter den Friseurladen fürs Krankenhaus betrieb. Auch meine Mutter besuchte ich öfter in der Arbeit. Das war halt bei uns auf dem Land so. Einmal komm ich da hin, da wäscht sie gerade einer Patientin den Kopf. Der Kopfschutz liegt abgeschnallt daneben auf dem Frisiertisch. Ein Riemen baumelt ins offene Fach mit den Alulockenwicklern. Normalerweise begleitete ein Pfleger die mit Helm, weil sie unberechenbar waren. Heute hatte wohl keiner Zeit. Ich streckte den Kopf zur Tür rein, meine Mutter fauchte: „Geh heim!“
„Wieso denn?“ Gab ja keinen Grund abzuhauen und ich wollte von was Ungerechtem aus der Schule berichten. Gerade ließ ich mich in den Drehstuhl unter die Trockenhaube fallen, da entdeckte die unter der Brause mich. Ohne Vorwarnung tickte sie aus: Brüllte los wie am Spieß, drosch mit der Stirn auf den Waschtischrand, Blut spritzte, dann riss sie die Fäuste hoch und rannte mit Anlauf gegen den Spiegel. Die ganze Spiegelwand krachte runter, es klirrte und schepperte fürchterlich und in die Detonation hinein riss mich meine Mutter nach draußen auf die Straße. In ihrem weißen flatterdünnen Kittel sauste sie den Berg rauf zur Krankenhauspforte, Hilfe holen. Es war Winter.
Für mich sahen jedenfalls alle Helme gleich aus – bis auf die Farbe:
Die der Patienten waren braun, die der Radrennfahrer schwarz.
Meinen ältesten Freund Franky hielt der Broterwerb seiner Mutter als Krankenschwester im Ortsansässigen jedoch nicht davon ab, eine Karriere beim Radsport zu starten. Jungs sind modisch eben weniger anspruchsvoll.
Allerdings gab Franky sofort nach der Schule den Radsport dran, andere Dingen waren ihm wohl auf einmal wichtiger.
An der Stelle ein öffentlicher Appell an meinen alten Freund: Franky, befrei endlich Vatters Esel aus dem Keller!
Ich habe ihn damals beneidet, denn nur offizielle Radsportler gelangten an Rennräder. Für mich gab es bloß das Damenrad meiner Oma.
Sofort nach der Wende habe ich mir dann aber ein Rennrad im Katalog bestellt! Ein Traum von einem Rennrad – der Rahmen mit grün-gelb-blauem Regenbogen-Farbverlauf – ich taufte es Arpat.
Leider blieb Arpat und mir nicht viel gemeinsame Zeit – er ist mir in München gleich nach ein paar Monaten geklaut worden.
Weil ich deswegen – neben der Trauer! – von jetzt auf gleich ziemlich immobil im Münchener Stadtverkehr abhing, schenkte mir mein heute Angetrauter seinen schicken roten Faggin-Flitzer. Aus dem war er rausgewachsen und ich bin nun mal ein ganzes Stück kleiner als er. Trotzdem war mir das Rad etwas zu groß und so kaum es, dass ich im Lauf der nächsten Jahre ständig unter leichtem Nackenunwohlsein litt – weswegen ich die Rennradleidenschaft irgendwann in eine frischen Mountainbike-Liebe eintauschte.
Hielt 20 intensive Jahre – doch im letzten Jahr schwand mir die Lust …
Ich befürchtete schon, ich käme ins Alter, was mich echt mitnahm.
Eines Nachmittages – ich wollte mich eben zu meiner rituellen Radrunde um den See quälen – das Garagentor fuhr hoch und ein einziger leuchtender Sonnenfinger zeigte genau auf den roten Flitzer, der eingestaubt und verlassen an der Wand hing.
Augenblicklich durchflutete mich ein warmes Gefühl. Das floß mir vom Herzen direkt in den rechten Arm und ich wischte mit der bloßen Hand zwanzig Jahre Spinnweben und Vogelscheiße vom Rahmen. Was ein Zeichen! Das Rad blitze und funkelte im Sonnenlicht, es glich einer Wonne, es zu betrachten. Vorsichtig hob ich es aus der Halterung, pumpte Luft auf – und vom Tag an hat mich wieder die Leidenschaft gepackt!
Nun ist es jedoch so, dass die Technik auch beim Fahrrad im Lauf der Jahrzehnte Fortschritte macht. Die Laufräder drehen reibungsärmer, die Bremsen bremsen besser und die Schaltung zickt nicht nur weniger bei Temperaturunterschieden, man kommt überhaupt auch leichter an die Hebel, weil die nämlich umgezogen sind: vom Rahmen an den Lenker.
Das erzählte mir mein Mann alles, nachdem ich die ersten begeisterten Ausritte hinter mich gebracht hatte.
Wollte ich aber nicht hören, ich bin halt treu.
Nach einer Weile stellten sich meine vergessenen Nackenprobleme wieder ein – Gottseidank kam dann der Winter, da pausiere ich sowieso immer.
Im Frühjahr war ich mit meinem neuen Buch zu beschäftigt für regelmäßige Runden – bis ich wieder täglich aufs Rad stieg, wurde es Sommer. Aber dann gab ich Gas!
Weil wegen des Lockdowns der Kontaktsport meines Mannes flach fiel, fuhren wir nun täglich zusammen eine Trainingsrunde. Währenddessen, und vor allem hinterher, war ich zwar voll fertig – mein Mann fuhr trotzdem scheiße schneller als ich! „Das liegt an deinem alten Rad! Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen?“
Wissen Sie, wenn man täglich seine Wadl-Schwäche vor Augen geführt kriegt: Irgendwann wurde ich weich. „Okay“, gab ich eines Tages klein bei, „lass uns nach einem neuen Rennrad umschauen.“
„Hab ich längst!“ Mein Mann feixte. „Wie findest du das hier?“ Er reichte mir sein Tablet.
Ein schwarzer Traum aus Carbon, ich sage Ihnen weiter nichts!
„Willst du mal Probe fahren?“
Angefixt nickte ich.
„Dann komm mit!“
Ich war auf eine längere Autofahrt gefasst, nahm meine Jacke vom Hacken und griff nach einer Wasserflasche.
„Brauchst du nicht.“ Mein Mann sah zur Uhr. „Schlappen reichen!“ Er drückte den Aufmacher der Garage, das Tor fuhr hoch –
da stand, eng geduckt an meinen roten Blitz: ein rabenschwarzer Puma. Also, ein Fahrrad, nicht dass wir uns da falsch verstehen!
Mein Mann hatte jedenfalls die ganze Zeit Recht gehabt: Das neue Rennrad ist der Hammer! Ich fuhr nun viel schneller als vorher. Mit dem alten kam ich nur auf ein Mittel um 23,7 kmh – jetzt fahre ich die Vergleichsstrecke mit mehr als 28, wenn ich gut drauf bin.
Und weil ich jetzt viel weniger Zeit brauche, fahre ich weiter. Die kleinste Runde misst 23 km; eine normale 40 und sonntags gerne auch mal 50, da heize ich zum Baldeneysee. Hinterher tut mir aber auch dermaßen kräftig der Arsch weh, meine Beine brennen und meine Schulterblätter fühlen sich krank an: Da rühre ich den Rest des Tages keinen Finger mehr. Ich fläze dann fett auf der Couch und freue mich, wenn mir einer einen Kaffee vorbei bringt. Coronamäßig ist das auch ideal: Ich komme gar nicht mehr auf die Idee, unter Leute gehen zu wollen.
Aber kommen wir auf die Helme zurück!
Ich bin ja, wie eingangs aufgeschlüsselt, strikter Oben-ohne-Fahrer. Daran hat auch das neue Rennrad nichts geändert. Nun ist es jedoch so, dass sich mein Mann von seinem Umfeld hat beeinflussen lassen: ‚Oben ohne fährt die Fahrrad? Das geht absolut gar nicht!!‘
Mir ist solches Geschwätz ja egal, meinem Mann aber nicht.
Nachdem ich also den neuen Esel angenommen hatte, lag zwei Tage später ein Helm auf dem Sattel. Weiß und hellblau, farblich nicht ganz so passend. Ein wenig hatte mich das hysterische Gesülze auch unsicher gemacht: Ich setzte also probehalber den Helm auf.
Ging aber schon gleich damit los, dass ich nicht wusste, wohin mit meinen Haaren! Die binde ich nämlich aus Temperaturgründen immer am Hinterkopf zusammen, flechte den Schwanz zu einem langen Zopf und wickele den um den Gummi zu einem Vogelnest. Hält super fest und fühlt sich hitzetechnisch an wie eine Kurzhaarfrisur. Mit Helm läuft das aber nicht!
Da bräuchte es schon eine Dachluke, um das Nest rausbaumeln zu lassen!
So würde das jedenfalls nichts werden. Ich den Helm also kurzerhand an eines anderen Fahrrads Lenker gehängt – und ohne Helm losgesaust.
Am nächsten Tag verzichtete ich schlau auf mein Vogelnest und flocht mir stattdessen eine Boa, die ich gleich noch kuschelig mit um den Hals legen konnte. Im Hochsommer! Wer von Ihnen schon mal einen dicken Zopf im Nacken trug – und sei es nur zum Fasching – der weiß, wie verdammt fett der einem das Genick wärmt.
Mann, ich hatte schon gleich keine Lust mehr zu fahren!
Schleppte mich trotzdem in die Garage – Lust kommt beim Fahren! – setzte den Helm auf, guckte in den Spiegel: Dachte ich, mich tritt ein Pferd! Auf meinem Kopf ein großer Pilz! Schmaler Fuß mit lebhaften braunen Augen, riesiger Schirm obendrüber – Ich fahr doch nicht als Schwammerl durch die Gegend!
Ich das Ding also wieder an den anderen Lenker gehängt – und wieder oben ohne losgesaust.
Weil wir uns gerade zwischen zwei Corona-Lockdowns befanden, spielte mein Mann nun fast jeden Tag wie verrückt Fußball und ich fuhr wieder schön alleine.
Nach drei Wochen fragte mich der Gemahl beim Abendessen: „Wie kommst du mit deinem Helm klar?“
„Setz ich nicht auf.“
„Wieso? Was funktioniert denn nicht?“
„Sieht scheiße aus.“
Mein Mann zeigte mir einen Vogel. „Ohne Helm fährst du jedenfalls nicht!“
Ich lancierte ebenfalls einen ornithologischen Gruß in der Stirnmitte und verließ den Tisch.
Am nächsten Tag schmiss ich mich nach Feierabend eilig in megadünne Sportschale und stürmte in die Garage. Mit der rechten Hand wollte ich wie gewohnt das Rennrad aus seiner Halterung heben – blockierte da was. Ich beugte mich nah an die Führungsschiene, zu sehen, wieso das klemmte: Hatte so ein Depp das Rad an der Wand festgekettet!
Die Intention hinter der Maßnahme war mir schon klar – deckte sich aber nicht mit meiner Zielsetzung. Doch rechtzeitig, ehe ich mir ob des verschwendeten Afterwork-Ritts die Haare raufen konnte, durchzuckte mich ein roter GeistesBlitz! Den schnappte ich mir auch unverzüglich und düste los.
Mach ich nun schon seit ein paar Wochen so. Ich bin jetzt also wieder mit 23km/h unterwegs.
Man muss sich nur zu helfen wissen!


Hi Leute!
Zu keinem unserer freudigen Einheitsanlässe war es mir bisher gelungen, Euch diese alte Kriminalgeschichte rechtzeitig zu präsentieren! Genaugenommen war es mir schlicht überm Feiern entfallen.
Aber beim 30-Jährigen, da switchte mir der Fall rechtzeitig auf dem Schirm!
Schlummert seit fast 20 Jahren in meinen Dateien … 🙂
Ist bisschen ungewohnt länger, also legt die Füße hoch! ❤
Und frohen Feiertag übrigens! ❤
Die Brüder Kallauch
- I. Henning
Seit einer Stunde hockte Henning nun schon im Bad und starrte vor sich hin. Ruhig war es, aber nicht still. Durch das gekippte Fenster drang Kälte und der Fernsehlärm von nebenan. Dumpf ließen sich Stimmen aus anderen Wohnungen vernehmen; ab und an das laute Röhren eines Trabis – im Plattenbau wurde es niemals still.
Doch das nahm Henning kaum wahr. Er dachte an frühere, bessere Zeiten. Als er ein Lehrer war und es leidenschaftlich liebte, wenn die Schüler ihre eigenen Ideen entwickelten und sich vom Stoff des Lehrplans lösten. Einmal, kurz vor den Weihnachtsferien, hatte er ihnen ein Aufsatzthema gestellt: Das gefällt mir nicht, an der DDR. Seine achte Klasse war nach anfänglichem Zögern über sich hinausgewachsen. Wirklich alle schrieben sie fleißig. Vielfach klang noch ihr bedauerndes Och! in seinen Ohren, welches mit dem Pausenklingelzeichen ertönte. Einige Zeit später erschienen zwei Herren der Staatssicherheit und nahmen ihn mit. Sie ließen ihn nicht wieder gehen – für ganze vier Jahre nicht. Obwohl sein älterer Zwillingsbruder aktives Parteimitglied und für irgendein Ministerium tätig war. Erich hatte ihn nicht ein einziges Mal während der langen Haftzeit besucht. Naja, sicherlich sorgte ihn seine Karriere. Vermutlich konnte er es sich nicht leisten, mit einem politisch umtriebigen Bruder engen Kontakt zu pflegen. Spitzel gibt’s eben überall…
„Henning!“, rief plötzlich die Mutter aus dem Wohnzimmer, „Henning!“
„Ja?“ Henning gab mechanisch Antwort. Er wollte sich nicht von seinen Gedanken lösen. Heute morgen hatten SIE ihn plötzlich entlassen. Einfach so, ohne Vorankündigung. Einer der Aufseher war in seine Zelle gekommen: „Backn Se Ihre Siemsachn, Kallauch, in ner halbm Stunde ham Se’s überstandn!“ – Und dann stand er tatsächlich vor dem Tor.
Doch was sollte nun werden? Mit seiner Akte könnte er bestenfalls noch als Hilfspacker im VEB NARVA unterkommen.
„Schnell!“ – Die Mutter schrie: „Im Fernsehen!“
Henning betätigte den Spülknopf, zog die Hose hoch.
„Der Schabowski…“ – wieder die Stimme seiner Mutter. Im Treppenhaus wurde es lebendig. Eine Wohnungstür flog krachend gegen die Wand, Jubelgeschrei, Anfeuerungsrufe wie MACH HIN! und BEEIL DICH DOCH! waren zu vernehmen, schwere Schuhe donnerten den Flur entlang, die Treppe hinab. Ein schrilles WARTE! direkt vor der Wohnungstür. Henning schenkte sich das Händewaschen. Er stürzte ins Wohnzimmer. Die Mutter saß starr vor dem Fernseher. „Die Grenzen sind offen“, sagte sie fassungslos. „Schau doch… wir können rüber.“
Das Leben kam in sie zurück. Sie sprang auf, umhalste Henning. Widerstandslos wie eine Marionette ließ er es geschehen, starrte unverwandt auf die Mattscheibe. Dann riss er sich los. „Ich muss das selber sehen!“ – ratschte die Jacke vom Hacken und stürmte aus der Wohnung. Im Treppenhaus sechs Stockwerke Drängeln und Schieben nach unten – für gewöhnlich traf man hier weniger Nachbarn. Nicht einer der runterwärts Strebenden kam Henning bekannt vor – lange war er weg gewesen. Der Fahrstuhl steckte mit geöffneten Türen und einem Leib voller Menschen zwischen drittem und viertem Stock. Wohl dem, der laufen kann. Vorwärtsstrebende Menschen auf der Straße. Wie zur Maikundgebung oder zur Ferienzeit. Sie drängten Richtung Westen – glückliche, erwartungsfrohe Gesichter. Henning lief mit. Die Grenzen offen – sollte es sich um einen Scherz handeln oder einen Test und jeder, unterwegs zum goldenen Westen, würde einkassiert? Der nächstgelegene Grenzübergang hieß Oberbaumbrücke. Geschickt umrundete Henning eine Frau mit Kinderwagen; ältere Menschen und Leute mit kleinen Kindern kamen langsamer voran. Noch waren unterschiedliche Geschwindigkeiten möglich. Je näher die Grenze kam, desto dichter wurde der Menschenstrom. Aus Hauseingängen kamen sie, aus Nebenstraßen – von überall her drängten sie auf die Sonnenallee. Die Fahrbahn war mit laufenden Menschen verstopft. Scheinwerfer, Hupen – Autos kamen nicht weiter. Manch einer ließ sein Fahrzeug stehen wo es stand und lief mit. Schneller, schneller, ich will zuerst drüber sein. Hier hätte man zur Oberbaumbrücke abbiegen müssen. Es war unmöglich, aus der Masse auszuscheren. Der Mob walzte vorwärts. Henning mittendrin. Weiter vorn kam die Mauer in Sicht. Hell angestrahlt, wie es schien von beiden Seiten der Grenze. Darauf und davor herrschte Volksfeststimmung. Hunderte von Menschen vor der Mauer und nicht ganz so viele obendrauf. Sie lagen sich in den Armen, tanzten, weinten, lachten, tranken Sekt, schwangen Bierflaschen, stießen Victory-Zeichen in die Luft. Das war kein Test: Das war real! Sie halfen einander die Mauer zu erklimmen – eigenartig mühelos sah das aus. Hie und da fiel einer wieder herunter – gar zu dicht war das Gedränge auf dem Grat. Immer mehr Menschen strebten auf die Mauer. Bereitwillig halfen die Umstehenden. Langsam, ganz langsam, wurde Henning an das Bollwerk gegen den Kapitalismus herangeschoben. Zwei junge Mädchen neben ihm kreischte unaufhörlich. Andere auch, aber die standen nicht so dicht an Henning gepresst. Er versuchte, mit der linken Hand sein Ohr zu schützen. Fast schaffte er es nicht, die Hand zum Kopf zu führen – da war kein Raum. Die Schleife von Hennings rechtem Schuhband löste sich im Gedränge. Träge schliff der Schnürsenkel über den Boden – Henning beachtete es nicht. Eng wie in einer prall gefüllte Reisetasche ging es zu. Endlich erreichte er die Mauer. Die linke Hand vom Ohr zur Mauer führend, berührte er ungläubig den rauen Putz. Es wurde gedrückt und geschoben – wie einen Stützpfeiler drückte er den Arm gegen die Mauer: Abstand halten! So nahe… Er hätte nicht geglaubt jemals bis hier vorzudringen. Ein hilfreicher Arm streckte sich ihm von oben entgegen. Ein zweiter. Dankbar nahm er die anonymen Arme, die zu lachenden Gesichtern gehörten. Ein starker Arm packte ihn am Jackenkragen, zog nach oben. Seine Füße stemmten kletternd gegen die Barriere. Von unten wurde er geschoben. Hände pressten kräftig gegen seinen Hosenboden. Jemand stützte sein linkes Bein im Räuberleiter-Griff. Er schaffte es. Erst auf die Knie… dann aufrichten – Vorsichtig! – bloß nicht zu weit über den Rand beugen. Jetzt stand Henning gerade. Unfassbar! Die zuckende strahlend fremde Stadt lag ihm zu Füßen. Da erfasste ihn die Ekstase der anderen. Ihnen gleich, riss er jubeln die Arme in die Höhe, seine Beine tanzten den Rhythmus des Nachbarn. Von links wurde ihm eine Flasche König-Pilsener gereicht. Siegestrunken setzte er die Flasche an. Das Bier lief ihm rechts und links am Mund vorbei. Es störte ihn nicht. Als er die Pilsflasche weiterreichte, empfing er den Schlag einer freudentaumelnden Flasche Rotkäppchensekt zwischen den Schulterblättern. Er ruderte mit den Armen, wollte das rechte Bein austarierend in die Höhe werfen – allein das Bein ließ sich nicht abspreizen. Hennings linker Fuß stand auf dem offenen Schuhband. Wie festgebunden ruderte Henning und fiel ganz langsam kopfüber in den Westen.
Manchmal scheint das Schicksal einen nicht entrinnen lassen zu wollen. Die Menschenmasse im Westen hätte seinen Sturz abfedern müssen, wie Peter Gabriels legendäre Stage-Divings während seiner Konzerte – aber genau da, wo Henning herunterkrachte, teilte ein rechtwinklig von der Mauer weglaufender schmiedeeiserner Zaun, mit Lanzen als Spitzen, die Jubelnden. Henning starb am 10. November 1989 in einem Kreuzberger Krankenhaus.
- II. Erich
Sie riefen ihn zurück. Ohne eine endgültige Beurteilung abgeben zu können, sollte er Ungarn verlassen. Pflichtbewusst wie immer gehorchte er: brach seine Zelte ab und saß nun mit zwei Koffern im Express der Reichsbahn nach Berlin. Er hatte ein erster Klasse Ticket gelöst. Im Abteil der ersten Klasse reisten für gewöhnlich wenige Touristen. Weiter vorn saß eine Frau mittleren Alters, sicher Ungarin. Auffällig geschminkt, mit langen schwarzen Locken, die fast vollständig die Kopfhörer auf ihren Ohren verbargen. Sie schien zu schlafen. Im Abteil hinter ihm ein würdig aussehenden älterer Herr. Er saß bereits im Zug, als Erich im letzten Moment in Budapest zustieg. Geübt war Erichs Blick über die ausgebreiteten Unterlagen des Herrn geglitten. Deutscher; irgendetwas hatte er mit Wismut Gera zu tun. Über der grafischen Darstellung einer Bodenprobe stand die Adresse. Vermutlich sollen neue Uranvorkommen erschlossen werden, dachte Erich gleichgültig. Sein Magen knurrte – er hatte seit dem Frühstück nichts gegessen. Weitere Fahrgäste gab es nicht.
Erich machte es sich bequem. Er löste den oberen Knopf seines Hemdes und lockerte die Krawatte.
Ursprünglich war er gegen Ende des Frühjahres zur Diplomatenschule nach Budapest gerufen worden. Es galt, die hoffnungsvollsten Abiturienten unter die Lupe zu nehmen und Nachwuchs für das Ministerium zu rekrutieren. Um seiner Arbeit ohne besonderes Aufsehen nachkommen zu können, reiste er offiziell als Austauschlehrer für Geschichte. Reibungslos, wie immer, hatte das Ministerium dafür gesorgt, dass der Lehrer, welcher den Posten sonst innehatte, zum Austausch an eine Oberschule nach Dresden geladen war. Bald nachdem er seine Arbeit aufgenommen hatte, waren Karawanen von ostdeutschen Touristen gen Ungarn gezogen und der Run auf die westdeutschen Botschaften in Prag und Budapest begann. Erich konnte das nicht verstehen und ein großes Hassgefühl schwelte in ihm. Hass auf all die Flüchtlinge. Wovor flohen sie; was glaubten sie, im Westen zu finden? Meinten sie, wenn sie in Konzernen ausgebeutet würden, fühlten sie sich freier? War es der Überschwang, der sie lockte? In der DDR gehörte alle Macht dem Volke. Den Arbeitern und Bauern, den Kindern und den alten Leuten. Das war die Zukunft. Da konnte man Leben und sich frei fühlen. Da war Platz zum Entfalten und die Sicherheit um das Sein. Eine starke Grenze schützte dieses blühende Land. Eine starke Grenze und starke Soldaten. Sie verteidigten sein Leben, das der anderen Bürger und auch das dieser undankbaren Flüchtigen gegen die Angriffe des Kapitalismus. Die Lage war prekär. Waren es zu Anfang nur einzelne gewesen, die über die grüne Grenze flüchteten, sammelten sich die Ausreisewilligen bald zu Hunderten in den Botschaften. Seine Schüler versuchten wiederholt, mit ihm über die Vorkommnisse zu sprechen, doch er blockte. Zu Anfang tat er die Geflohenen als charakterlose Subjekte, vom Klassenfeind Verblendete, ab, dann, als ihrer Zahl mehr wurden, beschloss er, die offizielle Stellungnahme des Ministeriums abzuwarten. Akribisch notierte er derweil die Äußerungen der zu Überprüfenden und verwahrte sie in seinem roten Aktenordner. Die Stellungnahme blieb aus – es existierte kein Problem. Stattdessen war er heute abberufen worden. Zwei Telegramme brachte ihm die Sekretärin am Morgen in seine Unterrichtsstunde. Das erste vom Ministerium, er solle sich unverzüglich im Hauptquartier einfinden. Nicht ganz zehn Minuten später klopfte die Sekretärin erneut mit einem Telegramm zwischen den Fingerspitzen mit den abgekauten Nägeln: Das Telegram war von seiner Mutter. Er hatte es stirnrunzelnd gelesen, zusammengekniffen und in seiner Jackettasche verschwinden lassen. IN KÜRZE ERREICHEN WIR USTI! – ertönte die stark akzentuierte Stimme des Zugführers. Erich machte sich bereit. Gleich würden die tschechischen Zöllner kommen, er würde seinen Diplomatenpass vorweisen, der Zöllner würde ein wenig zusammenfahren und ihm pflichtschuldig und unterwürfig seinen Pass zurück geben. Erbarmungslos kniff der Hunger in Erichs Magenwände. Der Mitropa-Waggon war kurz nach Bratislava abgekoppelt worden, irgendein technischer Defekt.
Der Zug hielt am Transitgleis. Erich überlegte, ob er den Halt nutzen, einen Kiosk aufsuchen könnte. Er vertagte es – am Bahnsteig drängten dicht die Reisenden. Auch das 1.-Klasse-Abteil füllte sich. Vor Erich ließen sich vier mit Louis-Tränker-Rucksäcken beladenen langhaarige Typen nieder. Drei Männer und eine Frau. Sie trugen zerrissenen Hosen – in Allem recht ungepflegte Erscheinungen. Erich wollte gerade mit unmissverständlichem Ton auf die hintere 2.-Klasse verweisen, als die vier ihr anscheinend während des Einsteigens unterbrochenes Gespräch fortsetzten.
„Dat hasse wirklich im Fernseh gesehen, dat der Rene et geschafft hat?“
Das waren westdeutsche Klänge, die Erich vernahm. Da war er sicher. Nur in der Bestimmung des Dialektes nicht ganz. Ruhrgebiet, vermutete er. Schlagartig stellte er jedoch seine Überlegungen ein, als er die Frau antworten hörte: „Klar, Man, heute in’ner Tagesschau war et, dat war so ein Ausschnitt, dat war die Flucht vom Rene, wie er vor dem Kameramann durch dat Maisfeld rennt, bis nach Österreich rein…“
„Wat war’n dat für’n Kameramann?“ fragte einer der Langhaarigen dazwischen.
„Dat war einer von NBC. Der hat den Rene vor de Botschaft in Budapest angesprochen und zur Flucht angestachelt.“
„Und dat weisste sicher, dat dat der Rene war?“, fragte ein anderer.
„Dat war eindeutig. Dat war der gekringelte Zopf und der dämliche sächsische Dialekt.“ Die vier lachten.
Erich verhielt sich still und lauschte angestrengt. Einer kam ihm zu Hilfe. „Wat macht’n jetzt der Dynamo Dresden, wenn sich der hoffnungsvolle Nachwuchsspieler in’n Westen verdrückt?“ Erneutes Gelächter.
„Dat nächste Freundschaftsspiel gegen MSV-Duisburg verlieren!“ Sollte es sich um Rene Gobel handeln? Erich ließ sich gegen die Lehne fallen.
„Ihre Fahrkarte, Bitte!“ urplötzlich war die Schaffnerin neben ihm aufgetaucht. Mechanisch zog er seine Fahrkarte aus der Jackettasche. Ohne dass er es merkte, fiel dabei das Telegramm der Mutter zu Boden. Lächelnd reichte die Schaffnerin Erich das gelochte Ticket. Sie ging weiter zu den Langhaarigen. „Sie haben nur eine Fahrkarte für die zweite Klasse gelöst!“, hörte er die Kontrolleurin streng sagen. „Sie müssen Nachlösegebühr zahlen!“ – Die Langhaarigen warfen ihren ganzen Charme ins Zeug und begannen mit der amtlichen Person zu verhandeln. Erich hörte nicht mehr hin. Er hatte das auf dem Boden liegende Telegramm entdeckt. Unauffällig hob er es auf und faltete es zwischen seinen Händen geschützt auseinander. „Henning kommt raus STOP Amnestie STOP M. STOP“ Unter viel Gelächter brachen die Langhaarigen in die 2.-Klasse auf. An der Tür prallten sie mit einer Herde grölender Halbtrunkener zusammen, die in einer Freudenpolonaise durch den Zug rumpelten. Erich konnte nicht verstehen, was sie jubelten, so heiser waren sie. Er schnappte den letzten am Kragen und bellte: „Was gibt’s zu feiern?“
Der Kerl wand ihm das Gesicht zu. Erich sah blutunterlaufene Augen, Speichelreste spritzten ihm ins Gesicht, als der andere zurückkrächzte: „Die Grenzen sind offen, Kumpel, wir können rüber!“ Er umarmte Erich mit zwei bärenstarken Greifarmen, riss seinen Kopf zu sich und klatschte ihm zwei gewaltig feuchte Schmatzer auf beide Wangen. Anschließend schob er den erstarrten Erich kumpelig brutal von sich, wamste ihm die halbvolle Bierflasche gegen die Brust „Nimm, Kumpel!“ schrie er ihm ins Ohr und zog torkelnd den anderen hinterher. Erich sackten die Knie weg.
- III. Eins
Beladen mit Umzugskartons und einer Rolle blauer Säcke stieß er die Tür zu Hennings Zimmer auf. Ungelüftet roch es hier und staubig. Am Fenster vorn stand eine vertrocknete Sansevieria. Die ehemals dickfleischigen Blätter hingen braun und plastisch gebogen über den Topfrand.
Erich zwängte sich durch die Türöffnung und blieb mit seiner Ladung an der nur angelehnten Tür des Kleiderschrankes hängen. Quietschend zog er die Türe hinter sich auf. Ohne sich umzuschauen, gab er ihr einen Tritt mit der Hacke. Die Tür federte kurz ins Schloss, prallte elastisch wieder ab und landete in seinem Kreuz. Erich fluchte leise. Energisch wand er sich der Tür zu, schlug kraftvoll davor und ehe sie wieder aufschnippen konnte, presste er die rechte Handfläche dagegen. Zwei Schritte bis zum Fenster. Auf der Fensterbank lag ein Zettel: „Nur das Zeug mitnehmen! Möbel hier lassen!“ – Kein Gruß. Das Fenster klemmte. Erich riss am Griff. Plötzlich gab der Rahmen den beweglichen Teil des Fensters frei. Ein Windstoß hob den Zettel an und führte ihn mit sich fort. Erich schaute der schaukelnd der Erde zuschwebenden Anweisung nach. Sie trudelte über dem Parkplatz. Aus dem hellblau-beigen Trabbi-Teppich mit den roten, weißen und hellgrünen Wartburg-Tupfen war ein aufgelockertes Gewebe aus bunteren Autos geworden. Auch silbergraue und schwarze gab es jetzt, gelbe- und lilafarbene. Die Trabbis, Wartburgs und die vereinzelten Ladas waren verbannt – Opel, VW und Audi, BMW und Mercedes, Mazda und Nissan… so hießen jetzt die Mobile die unten standen.
Am Abend zuvor hatte die Mutter bei Erich angerufen. Er erkannte ihre Stimme fast nicht, so anders klang sie. Ganz anders als sie geklungen, als sie ihm vor vier Jahren die Tür wies. Die Stimme schien ihm belegt vom Tabak und eine beginnende Alterserschlaffung der Stimmbänder glaubte Erich herauszuhören. Nach anfänglichem Schweigen hatte die Mutter ihn gallig aufgefordert, Hennings Zimmer auszuräumen. Sie wolle das nicht selbst erledigen, er könne sich wenigstens dieses eine Mal nützlich machen – sie würde es nicht verkraften, die Sachen ihres einzigen Sohnes weg zu schaffen, aber sie müsse die Wohnung verlassen, sie könne sich die Miete nicht mehr leisten. Außerdem, so sagte sie, verfüge er ja über genügend Zeit – hier wurde ihre Stimme deutlich hämisch – Aufgaben gäbe es für ihn wohl keine wichtigen. Sie erwarte also, dass er morgen mit der Arbeit beginne. Den Schlüssel fände er unter der Matte. Er brauche sich nicht zu sorgen, ihr über den Weg zu laufen, fügte sie noch hinzu, sie quartiere sich für das Wochenende bei Tante Erna ein. Erich hatte aufbegehren wollen. Wenigstens dieses Gefühl der Nutzlosigkeit, mit welchem er seit der Wende existierte, wollte er nicht auch noch von ihr bescheinigt wissen. Seit das Ministerium nicht mehr bestand, mussten es bald hundert Bewerbungen sein, die er verschickt hatte. Zu Anfang bewarb er sich noch als Lehrer – bis er das wütende Antwortschreiben des Konrektors einer Schule in Sachsen erhielt, er solle sich schämen, bei seiner Vergangenheit auch nur den Versuch zu unternehmen, sich um die Erziehung von Jugendlichen zu bemühen. Dann verlegte er sich auf Sachbearbeiterstellen aus den alten Bundesländern und schließlich waren es auch Hilfsarbeitergesuche, welche er beantwortet. Egal was, er wollte eine Arbeit. Aber es war unmöglich.
Lange war Erich nicht im ehemaligen Kinderzimmer gewesen. Er schaute sich um. Links das Bett, rechts gegenüber der Schreibtisch, bis zur Tür auf beiden Seiten hohe Schränke. Früher stand in dem Schlauchzimmer anstelle dieses Single- Bettes das Doppelstockbett, welches er sich mit Henning teilte. Natürlich residierte Erich oben. In den fünf Jahren seit Hennings Tod hatte er die Wohnung nur noch zweimal betreten. Das eine Mal zur Beerdigung und das andere Mal am darauffolgenden Weihnachten.
Erich war Familie nicht so wichtig. Er war ein Einzelgänger geblieben, wie schon in der Kindheit. Sentimentales Geschwätz lag ihm nicht. Familienfeier waren ihm von jeher verhasst. Wenn sich die engere und die weitere Familie an der Kaffeetafel von Tante Erna einfand und dann über die ferngebliebenen Verwandten herzog, sich gegenseitig nett verpackte Gemeinheiten unterjubelte oder sich in seltenen Momenten des Einvernehmens erinnerungsduselig über ferne Kindheitserlebnisse austauschte, dann hatte sich Erich meistens unter einem Vorwand erfolgreich aus der Stube zu entfernen vermocht. Waren es überraschende Bauchschmerzen oder ein unerwarteter Sturz in den flachen Bach hinter dem Haus – Erich flüchtete, wo es ging. Da war es allemal netter, in dem Ameisenhaufen weiter oben am Waldrand herumzustochern. Ganz spannend war es, wenn die Ameisen so aufgescheucht durcheinander rannten und ihre übergroßen weißen Puppen durch die Gegend schleppten, auf der Suche nach Sicherheit. Einmal war dann auch Henning mitgekommen. Henning, dem es sonst in der Kaffeerunde gut gefiel. Erich hatte ihm vom Ameisenhaufen erzählt. Losgegangen war Henning auf ihn, als er mit einem Stock den Haufen durcheinanderwirbelte und die Tannennadeln und Aststückchen durch die Gegend flogen. Henning sprang ihn von hinten an. Beide kippten in den Ameisenhaufen. Die sowieso schon wilden Arbeiterinnen stürzten sich auf sie und traktierten sie mit ihrer brennenden Ameisensäure. Überall am Körper bildeten sich rote Quaddeln. Drei Tage danach juckte und brannte die Haut noch immer. Jener Nachmittag hatte Hennings Leidenschaft für Ameisen geweckt. Erich trat vor das abgeräumte Klappbett. Um die Wand des Bettes hingen Bilder und Schautafeln der Roten Waldameise. Auf die schien Henning sich in den letzten Jahren spezialisiert zu haben. Neben dem grafischen Querschnitt durch einen Bau, war, in einem Glaskasten aufgefüllt, das Innere eines Ameisenbaus platziert. Die Kammern mit den Eiern, den Larven und den Puppen gruppierten sich über dem Bereich der Königin. Dazwischen saßen in Gängen die Arbeiterinnen, als wollten sie jeden Moment loswimmeln.
Die überdimensionale Abbildung des Körpers einer Roten Waldameise hing über dem Schreitisch. Darunter baumelte – vormals vermutlich nur provisorisch mit einer Reißzwecke an die Wand gepinnt – ein angegilbter Computerausdruck. Erich riss ihn herunter. Die Reißzwecke sprang durchs Zimmer. Der Inhalt handelte erwartungsgemäß von Henning Leidenschaft.
Eine Million Waldameisen wiegt 3,5 Kilogramm.
Die natürlichen Feinde: Schwarz-, Grün-, und Buntspecht, vor allem aber der Wendehals... und so weiter. Der Zettel schwebte in den Müllsack.
Hennings Schreibtisch war, wie alles im Zimmer, in vorbildlicher Ordnung. Die Ordnungsliebe war so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit, die sie beide hatten. Erich setzte sich auf den Drehstuhl. Außer einer eingestaubten Stiftschale – spartanisch mit einem Bleistift, einem Kugelschreiber und einem angekauten roten Filsstift ausgestattet – lagen auf dem Schreibtisch nur noch eine Schutzunterlage mit Globusmotiv und darauf eine schwarze Mappe, die zwei Gummibänder straff zuhielten. Erich blies darüber, wartete nicht ab, bis sich der graue Wirbel wieder beruhigte und schlug die Mappe auf. Zuoberst fand er Hennings Entlassungszeugnis aus der Haftanstalt. Darauf stand nicht viel. Henning sei ein vorbildlicher Häftling gewesen, der in der Gefängniswäscherei pünktlich seinen Aufgaben nachkam; aufgrund der politischen Amnestie werde er entlassen und man wünsche ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensweg. Erich blätterte um. Es folgten Sozialversicherungsausweis, Impfausweis, Diplom und Schulzeugnisse, eine handvoll Briefe von Studienkollegen und ein wie neu aussehendes schwarzweiß Foto von Hennings Freundin aus Uni-Tagen. Ihres Namens konnte Erich sich nicht mehr entsinnen.
Hier am Schreibtisch hatte Henning damals gesessen: Heilig-Abend 1984. Der Vater lebte noch. Erich hielt sich bei den Eltern im Wohnzimmer auf. Der Vater und er stritten über Politik. Das war nichts Neues. Einer der Gründe, warum Erich seine Familie selten besuchte. Der Vater war ein Sturschädel, mit dem ließ sich einfach nicht reden. Fing immer wieder von den alten Zeiten der jungen DDR an: Wie gut es doch mit Wilhelm Pieck gelaufen sei und Walter Ulbricht, der war auch noch okay. Aber seit der Honecker das Sagen hat… Erich war diese ewigen Diskussionen leid. Erleichtert erfüllte er da die Bitte der Mutter, Henning zum Essen zu holen. Heiligabend gab es immer Heringssalat. Das hielten schon die Großeltern so, wie man nicht müde wurde zu beteuern auch deren Vorfahren, und nun bestand die Mutter auf dieser Tradition. Henning fühlte sich wohl bei den Eltern – bei der Wohnungsknappheit bekam er sowieso keine Wohnung, außer er heiratete und na ja, die Richtige fand er eben nicht. Ohne anzuklopfen war Erich in das ehemalige Kinderzimmer gegangen. Henning saß über einen Stapel Hefte gebeugt. Wie gewöhnlich war er mit einem dunkelblauen Flauschpullover und einer engen Jeans bekleidet. Erich hatte sich hinter Henning auf dem Bettrand niedergelassen, sorgfältig seine Hosenbeine nach oben gezogen und dabei „Ich soll Dich zum Essen holen“, gesagt. Henning knurrte abwesend und schaute wie gebannt auf das, was da vor ihm auf dem Tisch lag. Wie weggetreten kaute er dabei langsam aber kraftvoll auf seinem roten Filzstift. Erich war hinter Henning getreten, hatte ihm mit der Faust freundschaftlich auf den Oberarm geboxt und wollte eben den Heringssalat loben, als er erfasste, worauf Henning stierte. In einem aufgeschlagenes Heft, dessen Zeilen der Doppelseite eng mit säuberlicher Tintenschrift gefüllt waren, stand das Thema unterstrichen: „DAS GEFÄLLT MIR NICHT, AN DER DDR“ Erich begann den Text zu studieren. „… ich lebe nicht gern in einem Land, in welchem man eingesperrt wird. Diese Grenze, sie schützt uns nicht nach außen, sondern ist mit Selbstschussanlagen nach innen ausgestattet. Wir sollen gehindert werden, andere Teile der Welt kennen zu lernen. Wer es dennoch wagt, bezahlt mit seinem Leben oder er stellt einen Ausreiseantrag und wandert in den Knast – auch hier ist das Leben vorbei – es sei denn, der Westen kauft einen frei…“
Wie damals sah Erich diesen Text vor sich.
„Was ist das?“ Fast tonlos hatte er die Frage gestellt. „Deutschunterricht Klasse 8“, lautete Hennings abwesende Antwort.
Erich hatte nach Luft geschnappt und dann mühsam gestammelt: „Ich geh’ nach Hause… fühl’ mich krank.“
Erich legte die schwarze Mappe in einen Umzugskarton. Dann leerte er die Fächer des Schreibtisches. Mit ihnen war er schnell durch: Büromaterial, welches sich weiterverwenden ließ.
Er wendete sich dem Kleiderschrank zu. In der linken Schrankseite lagen zuoberst fünf blaue Flauschpullover. Hennings Lieblingspullover – voneinander nur durch den Grad ihres Verwaschenseins zu unterscheiden. Sie waren eine Weile das obligatorische Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk von Tante Erna gewesen. Auch ihn hatte sie mit diesen Pullovern bedacht – nicht begreifen wollend, dass sie nicht seinem Kleidungsstil entsprachen. Erich bevorzugte Anzüge und Kombinationen aus Sakko und Bundfaltenhose. Und blau sowieso nicht, er mochte es gern braun. Braun in allen Variationen. Im Fach darunter die Jeanshosen. Unterwäsche, Socken, ein einziger guter Anzug – den trug Frank zur Diplomübergabe. Und auch auf Vaters Beerdigung, wo er für einen Tag Freigang erhielt. Erich hatte damals kein Wort mit Henning gewechselt, nur verstohlen grüßend die Hand gehoben und Henning hatte blass und irgendwie ängstlich zurückgenickt.
Bademantel, Winterjacke, Erich kam gut voran. Ganz zu unterst, unter dem dunkelblauen Rucksack mit Rückengestell, fand er Hennings Fotoalbum. Erich begann zu blättern. Die aufgeteilten Seiten der Kindheitsjahre unterschieden sich nicht wesentlich von seinem eigenen Album. Pausbäckige Jungen in karierten Hemden und kurzen Hosen, barfuss in Tante Ernas Garten stehend. Der eine mit einem Stock bewaffnet und verkniffen zu Boden schauend, der andere, mit einem Buch unterm Arm, zufrieden in die Kamera grinsend. Zwei gleich gekleidete Zuckertütenträger beim Fotografen. Sogar er, der kleine Erich, heiter, vollmundig lachend. Es fiel ihm wieder ein: wie die grell geschminkte Fotografin unter: WO-IST-DAS-VÖGELCHEN und CHEESE rückwärts gegen einen ihrer Scheinwerfer gestoßen war, das Ding beachtlich schwankte und endlich zielsicher auf den Papageienkäfig kippte. Der grüne Vogel ließ sich nicht beruhigen, zeterte den Rest der Session auf das Schrillste. Die Fotografin, sichtlich genervt, wollte abbrechen, aber Mutter bestand darauf, die Fotos zuende zu bringen – „Die Jungen noch mal sauber hierher kriegen?“, hatte sie zur Fotografin gesagt, wobei sie sich die Ohren zuhielt – „Wo denken Sie hin!“
Es folgten ein Klassenfoto und ein brüderliches Faschingsbild: Henning als Naturforscher und er als Polizist verkleidet. Weiter hinten wartete ein Häuflein Fotos auf das Einkleben, die Erich nicht kannte. Fotos aus der Studienzeit und einige von Hennings gemeinsamen Kletter-Urlaub mit Frank Meyer in der Sächsischen Schweiz. Auf einem Bild hockten beide um einen einflammigen Campingkocher vor einem schiefen kleine Zelt und rührten in ihrem blechernen Kochgeschirr. Erich las die Bleistiftnotiz auf der Rückseite: Basislager, am Tag bevor es der Sturm zerstörte. Fürs Klettern hatte Erich noch nie etwas übrig gehabt. Er klappte das Album zusammen, steckte es in den Karton und erhob sich. In acht Umzugskartons verstaut, stand Hennings Habe ihm zu Füßen. Vorerst wollte er die Sachen in seinem Keller lagern.
Kurz nach zwanzig Uhr drehte Erich den Schlüssel im Schoß seiner Wohungstür. Er holte eine geöffnete Flasche Rotwein aus der Küche und ließ sich mit einem sauberen Glas in den Fernsehsessel fallen. Gegen seine Gewohnheit blieb der Fernseher ausgeschalten. Nachdenklich drehte Erich den Stiel des Weinglases zwischen den Fingerspitzen. Dann ging er zum Schreibtisch. Neben dem Papierkorb stand eine der Umzugskisten. Erich klappte sie auf. Oben lag das Fotoalbum. Er nahm es heraus, legte es beiseite. Was er suchte, befand sich ganz zu unterst. Endlich fand er die schwarze Mappe. Mit dem Weinglas in der Hand saß er vor der geschlossenen Mappe. Laut und gleichmäßig vernahm er das Ticken der Wanduhr. Er gab sich einen Ruck und klappte den Deckel auf. Erich las. Ohne den Blick von seiner Lektüre zu wenden, zog er nach einer Weile die untere Schublade des Schreibtisches auf und entnahm ihr einen Block weißen Papiers. Seite für Seite den Inhalt der Mappe umblätternd machte er sich Notizen. Als er geendet hatte, holte er seine Reiseschreibmaschine aus dem Schlafzimmer. Auch wenn er sie in den letzten Wochen weniger benutzt hatte, so war sie doch genauso staubfrei und sauber, wie alles in seiner Wohnung. Erich nahm den Deckel ab und spannten sorgfältig einen Bogen frischen Papiers ein. Zügig klapperten die Tasten über das Papier. Es war weit nach Mitternacht, als Erich den Deckel wieder auf der Maschine befestigte und sie an ihrem Platz unter seinem Bett verstaute.
Ungefähr zwei Wochen waren verstrichen, als Erich eines Morgens einen Brief des Schulamtes Gera in seinem Briefkasten fand. Schnell rannte Erich die Treppen bis in den vierten Stock nach oben. Gleich hinter der Wohnungstür riss er hastig den Umschlag auseinander. „Sehr geehrter Herr Henning Kallauch, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können…“ Dann verschwamm alles vor Erichs Augen. Zwei Freudentränen der Erleichterung machten seinen Blick unscharf. Erich schnäuzte sich, bevor er weiter las. Man freue sich, ihm den Posten des Schulleiters der Käthe-Kollwitz-Schule in Jena zur Verfügung stellen zu können. Und man fühle sich geehrt, einen vom DDR-Regime solchermaßen drangsalierten Lehrer im Kollegium begrüßen zu dürfen. Man lade ihn herzlichst zur baldigen Revision nach Jena ein. Den Test zur Eignung als Schulleiter würde Erich ohne Schwierigkeiten bestehen, das wusste er. Trotzdem machte er sich sofort auf den Weg in die Stadtteilbibliothek. Je früher er begann, die Paragrafen des Schulalltags auswendig zu lernen, desto sicherer blieben sie ihm haften. Er würde wieder Fuß fassen. Endlich!
Wie Erich erwartete, war es fast eine Leichtigkeit, die prüfende Lehrerschaft von seiner Qualifizierung als Rektor zu überzeugen. Mit scharfem Verstand und unbeirrbarer Genauigkeit bestach er. Am Abend reiste er mit dem Intercity nach Berlin zurück – den Vertrag mit dem Schulamt in der Tasche. Er würde seine Wohnung auflösen und alle Brücken in Berlin abbrechen. Ein neues Leben wollte er in Jena beginnen. Frei von den Ketten der Vergangenheit, beschloss er, noch einmal von vorn zu beginnen. Die Mutter fiel ihm ein. Es würde sie nicht schmerzen, den einzig verbliebenen Sohn zu entbehren. Das hatte sie ihm unmissverständlich am Weihnachtsabend im Jahr nach der Maueröffnung klar gemacht. Er sei schuld am Tod des Vaters und Henning laste extra auf seinem Gewissen. Hysterisch war sie geworden: Warum er nicht, wie jeder rechtschaffene Mensch, mit anständiger, ehrlicher Arbeit sein Geld habe verdienen können. Dann hatte sie die Tür aufgerissen, den Arm wie eine Keule Richtung Treppenhaus geschleudert und mit versteinertem Zeigefinger hart hinausgewiesen. „Raus!“, war es eisig leise von ihren Lippen geklirrt. Er hatte etwas sagen wollen, sie am Arm berühren, erklären, doch sie wiederholte nur dieses gefrorene Raus! Da war er gegangen – bereit, niemals wieder zu kommen. Er hatte sich nicht umgesehen, hatte geglaubt, das Gewicht der Haustür unten zum letzten Mal am Oberarm zu spüren.
Viel war es nicht, womit er nach Jena umzog. Auf Reisen im Staatsdienst verdiente er zwar genügend – aber seine heimliche Leidenschaft war das Wetten. Während der Studienzeit begann es. Ein kleiner Kreis Auserwählter setzte auf alles Mögliche. Kleinigkeiten zu Anfang. Morgens: Die Farbe von Sylvias Kleid, ob sie überhaupt eins trug oder ausnahmsweise doch in Hosen kam; ob die Temperatur unter 22 Grad sänke; wie viele Autos während einer Zigarettenlänge passierten. Zu Anfang war es harmlos. Um Groschenbeträge ging es. Dann steigerten sie sich auf einstellige Marksbeträge. Zu Ende des Studiums, mit beginnendem Größenwahn, wechselte schon mal ein Fuffi den Mann. Henning war nie mit von der Partie – aber Erich liebte den Spaß mit der harten Zocke. Später dann die Pferde und das Glücksspiel – in den meisten seiner Einsatzländer waren die Bestimmungen nicht so eng. In Ungarn zum Beispiel, versetzte er während eines Pokerabends sein Motorrad. Nach der Wende sprossen auch in Berlin die Spielhallen aus dem Boden. Erich wurde zum Stammkunden. Was ging versetzte er in der Pfandleihe am Potsdamer Platz.
Die Schulsekretärin hatte ihm ein kleines Appartement in einem Altbau im ehrwürdigen Jenaer Damenviertel besorgt. Schräg gegenüber vom Botanischen Garten. Für den Anfang, sagte sie leicht verlegen am Telefon. Jena sei eine Baustelle. Erich war froh, dass er nur wenige Besitztümer sein eigen nannte, mehr brächte er hier nicht unter. Zwei Zimmer, schräge Wände – alles zusammen nicht mehr als 40 Quadratmeter.
Am Montag machte er sich gutgelaunt zu Fuß auf den Weg zur Schule. Sie lag unterhalb der Kernberge, die Jena wie eine Schlucht nach allen vier Himmelsrichtungen einkesseln. Es war noch eine dreiviertel Stunde Zeit bis Unterrichtsbeginn, als hinter Erich die eisenbeschlagene Eichentür krachend ins Schloss schlug. Kaum ein Schüler hielt sich zu dieser frühen Stunde im Gebäude auf. Die beiden Fensterhocker weiter vorn waren sicher Fahrschüler, aus einem der umliegenden Dörfer. Auch Lehrer sah Erich keine. Eine Putzfrau ließ gemächlich den Wischmopp über den ausgetretenen Steinstufen kreisen. Auf Erichs schneidiges „Guten Morgen!“, fuhr sie zusammen. Wie es zum Sekretariat ginge, fragte Erich. Nuschelnd zeigte sie nach oben: „Zweiter Stock“ Erich nahm zwei Stufen auf einmal und langte vor der Tür zum Sekretariat ein wenig schnaufend an. Fit-sein ist Alles! – das war Hennings Lebensmotto. Erich nahm sich bereits bei der Abfahrt in Berlin vor, es zu seinem eigenen zu machen. Forsch, ohne anzuklopfen, riss er die Tür zu seinem künftigen Büro auf. Es folgten ein dumpfer Schlag auf Holz und ein fraulich geknurrtes „Scheiße!“ aus der Richtung des Schreibtisches neben einer zweiten, gepolsterten Tür. Da tauchte auch schon der Kopf einer hübschen Frau unter dem Schreibtisch hervor. Sie hielt sich mit der rechten Hand eine Stelle am Hinterkopf.
„Guten Morgen!… Henning Kallauch, mein Name, – ich bin der neue Direktor.“ Das Gesicht der Frau nahm einen unnatürlichen Rot-Ton an – sie kam um den Schreibtisch herum und streckte ihm die Hand entgegen. „Herr Kallauch, ich bin Isolde Meinhard, die Sekretärin.“ Erichs Blick glitt zum goldberingten Ringfinder ihrer rechten Hand. „Kommen Sie“, forderte ihn die Sekretärin auf und nahm das tragbare Telefon von der Wand. „- Ich zeige ihnen die Schule.“ Sie ging voran. Erich konnte sie betrachten. Er schätzte sie auf Anfang dreißig, blonde lange Locken, nicht groß, ein runder Apfel-Hintern, – eine Frau, die den Beschützerinstinkt im Manne wecken konnte… „Hier im zweiten Stock sind unsere Grundschulklassen untergebracht“, riss sie ihn aus seinen Überlegungen. Erich räusperte sich. „Sehr schön“, antwortete er.
„Und in der Mitte befindet sich vorübergehend das Lehrerzimmer… Wir wollen sehen“, fügte sie nach einer winzigen Pause hinzu, „ ob schon einer der Kollegen anwesend ist.“ Sie erzählte vom Mauerschwamm, der sich im eigentlichen Lehrerzimmer ausgebreitet habe, was bei einem solch alten Gebäude nicht weiter verwunderlich sei. Man könne froh sein, dass lediglich zwei Räume im Erdgeschoss betroffen seien und man den Schädling rechtzeitig entdeckte. Unterdessen erreichten sie das Lehrerzimmer. Sie öffnete die Tür. Ein furchtbar verqualmter Raum, in dem milchigweiße Schwaden standen, tat sich auf. Mit einer einladenden Handbewegung ließ sie ihm den Vortritt. Mehrere Tische waren U-förmig zusammengestellt, Tischdecken und Blumenvasen sollten dem Raum vermutlich eine entspanntere Atmosphäre verleihen. Auf jedem Tisch protzten mindestens zwei Aschenbecher. Die Sekretärin öffnete das nächstgelegene Fenster, wobei sie demonstrativ mit der linken Hand vor dem Gesicht wedelte.
„Wissen Sie, Goethe ist bei den Jenaer Naturschützern in Ungnade gefallen.“ – Sie winkte ihn ans Fenster.
„Was hat er denn angestellt?“, fragte Erich irritiert.
„Früher waren die Kernberge kahl“, sagte sie lächelnd. „Nackt und hell. Nichts wuchs auf dem kargen Muschelkalk.“ Ihre Hand beschrieb einen ausladenden Bogen, den Horizont entlang. „Vor ungefähr 200 Jahren brachte Goethe von einer seiner Reisen nach Italien eine Schwarzkiefer mit. – Eine einzige nur. Und die vermehrte sich explosionsartig. Sehen Sie!“ Sie zeigte erneut auf die Berge: „Alles grün.“
Da ertönte plötzlich eine laute Stimme hinter Erich:
„Mensch, Kallauch, Du hier?“
Erich drehte sich abrupt um. Er sah in ein bebrilltes Gesicht mit dunklen kurzen Haaren.
„Ich wüsste nicht…“, fing Erich vorsichtig an.
Da haute ihm der Bebrillte mit der flachen Hand auf den rechten Oberarm.
„Kennst Du mich nicht mehr?“ Der Fremde machte eine Drehung auf der Stelle. „Ich bin der Meyer.“
Erich dämmerte es noch immer nicht, doch geistesgegenwärtig schlug er dem anderen fast ebenso enthusiastisch auf den Oberarm und sagte: „Na klar, Meyer, wie kommst Du denn hier her?“
„Meine Stellenzuweisung, direkt nach dem Studium, führte mich nach Jena.“
Jetzt dämmerte es Erich. Das war sein Studienkollege und Hennings Freund Frank Meyer. Der vom Foto in den Bergen. Erichs Herz begann hart und schmerzhaft zu schlagen. Früher sah Meyer anders aus. Lange Haare, keine Brille, irgendwie dicker war er auch. Was dachte Meyer, welchen der Brüder er vor sich hatte? Meyer legte vertraulich eine Hand auf den Arm der Sekretärin: „Hat unsere Isolde schon versucht, Dich für den NABU anzuwerben?“ Erich holte tief Luft. „Und von ihrem Zorn auf Goethe hat sie Dir sicher auch schon erzählt“, fuhr Meyer schmeichlerisch die Sekretärin umschlingend fort. Unwirsch schüttelte sie seinen Arm ab. In diesem Moment klingelte ihr Telefon. „Ach, Frau Hutschenreuther“, sagte sie erstaunt in den Hörer und ging zwei Schritte abseits. Da sagte Meyer leise: „Ich fand es sehr Schade, dass wir uns aus den Augen verloren haben.“ Erichs Knie begannen zu zittern, er fühlte, wie seine Hände feucht wurden. Mehr als ein einsilbiges „Ja.“ brachte er nicht hervor. Zum Glück erlöste ihn die Sekretärin. „Die Französisch-Lehrerin, Frau Hutschenreuther hat sich für heute krank gemeldet“, sagte sie. „Könnten sie ihre Vertretung übernehmen?“, fuhr sie an Erich gewandt fort.
Ohne Nachzudenken antwortete Erich „Aber sicher. – Wann beginnt ihre erste Stunde?“
„In 10 Minuten… Klasse 5, ich bringe sie hin.“
„Dann bis später.“ Mit Schwung warf Meyer seine Aktentasche auf einen der Tische.
‚Für wen hält der mich bloß?’, dachte Erich nervös und folgte der Sekretärin. Eine Welle von Übelkeit stieg in ihm hoch. Ob Meyer von Hennings Tod wusste? Wie lange dauerte es, bis er alles aufdeckte?
„Dann wünsche ich Ihnen viel Glück“, sagte plötzlich die Sekretärin in seine Überlegungen hinein. Blass und schwitzend betrat Erich die Klasse.
Irgendwie brachte Erich diesen ersten Arbeitstag herum, ohne Meyer noch einmal zu begegnen. Die erkrankte Französischlehrerin hatte einen vollen Stundenplan. Als Erich nach Hause ging, fiel sein Blick auf den Vertretungsplan im Treppenhaus. Meyer befände sich bis Freitag auf Fortbildung, prangte auf einem gelben Notizzettel. Erich musste sich setzen. Wo er stand, ließ er sich auf den kalten Steinstufen nieder. Mit dem Handrücken wischte er sich über die schwitzige Stirn. Diese Galgenfrist ließ ihn etwas freier atmen. Der große Klumpen, der seit dem Morgen pausenlos schmerzhaft in der Magengegend drückte, löste sich etwas. Erichs Haltung sackte leicht ein. Die Anspannung des Tages hatte ihn ungewöhnlich ermüdet. Damals, als er Henning in seinem Zimmer mit den Aufsätzen überraschte, da fühlte er sich ähnlich. Dann war er stundenlang spazieren gegangen. Allein, durch die eisige Nacht. Alleinsein, das war es, was er jetzt brauchte – die nächsten Schritte überdenken. Erich verließ die Schule.
Am Abend schellte es an seiner Wohnungstür. Wer konnte das sein? – Nicht öffnen. – Vielleicht der Hauswirt? Erich öffnete. „Ich freue mich so, dass Du hier bist!“ Ein strahlender Frank Meyer riss ihn in die Arme. Erich fühlte einen starken Schwindel im Kopf. Bloß keinen Fehler jetzt. „Komm rein“, sagte er matt zu Meyer. „Ich fühle mich nicht so gut.“
„Was ist los?“ – Meyers Gesicht nahm sofort einen mitfühlenden Ausdruck an.
„Nichts.“ Erich winkte ab. Seine Hand zitterte. „Willst Du einen Rotwein?“
Meyer pfiff durch die Zähne. „Oho – früher standest Du nicht auf dieses Zeug.“
„Wir werden eben alle reifer“, meinte Erich achselzuckend. Wer bin ich für Dich?
„Klar… Dann gib mir eben einen Rotwein.“ Sein ‚Rotwein’ klang leicht angewidert. „Ne, gib mir lieber gleich eine Flasche – aus Gläsern schmeckts nicht.“ Erich ging voran in die Küche.
Unaufgefordert ließ sich Meyer am Küchentisch nieder. „Ich habe noch mal nachgedacht“, begann er langsam. Erich schaute ihn aufmerksam an.
„Damals… im Zelt… es tut mir leid.“
Erich ließ ein unbestimmtes „Hm“ vernehmen. In einem Zelt waren er und Meyer niemals gewesen.
„Ich bereue… Und es vergeht kein Tag, an welchem ich mir nicht ausmale, was hätte geschehen können.“
Wovon sprach er?
„Steht Dein Angebot noch?“
Hatten die beiden ein krummes Ding geplant?
„Ich kann verstehen, wenn Du nichts mehr mit mir zu tun haben willst.“
Sehr richtig!
Meyer stand auf und kam um den Tisch herum. Er blieb vor Erich stehen. Mit beiden Händen strich er langsam an Erichs Armen nach oben. Erich konnte sich nicht rühren. Die Hände erreichten seinen Hals. Erichs Haltung war erstarrt – im Sprung eingefroren. Zärtlich fuhren die Handrücken über seine Wangen. „Mir wird schlecht“, platzte Erich heraus und stürzte ins Bad. Er lehnte sich von innen an die Tür und schnaufte tief. Henning schwul? Nicht möglich! Wieso hatte er nicht bemerkt, dass mit Henning etwas nicht stimmte? … Zugegeben, Hennings Kleidung war für Erichs Geschmack immer etwas zu eng und auch zu sportlich gewesen, und dass er nie Frauenbesuch zu haben schien war auch merkwürdig, aber musste man deswegen gleich vom anderen Ufer sein? Sein Leben hatte auch lange keine Frau gestört, das änderte aber doch nichts an seiner Einstellung zum Weiblichen.
Von draußen klopfte Meyer gegen die Badezimmertür. „Henning, ist alles in Ordnung?“
Mit einem Mann im Bett – Erich ekelte sich vor seiner gestohlenen Existenz.
„Henning, was ist los?“
Erich betätigte den Knopf der Toilettenspülung.
„Kann ich Dir helfen? Soll ich einen Arzt holen?
Mein Bruder – in Erichs Kopf kreiste es, er ließ sich an der Badezimmertür nach unten in die Hocke gleiten.
„Henning?“ – Meyer wummerte mit den Fäusten gegen die Tür.
„Es geht schon“, sagte Erich lahm. „Geh nach Hause, wir sehen uns morgen.“
„Ich lass Dich in Deinem Zustand nicht allein!“
Wenn er doch endlich ginge.
Einen letzten Versuch wollte Erich noch wagen, eher er diese unglaubliche Erkenntnis würde akzeptieren müssen: „Ich dachte, Du stehst auf die Meinhard…?“
„Alles nur Schau“, antwortete Meyer mit beruhigender Stimme – „Was meinst Du, was passierte, wenn hier auch nur einer vermutete, dass ich schwul sei? Da könnte ich meinen Job gleich an den Nagel hängen.“
Wie wahr, dachte Erich. Henning, ein Schwuler. Ein Schwuler Lehrer in der DDR. „Geh nach Hause, Meyer, wir sehen uns morgen.“ Kurz drauf fiel leise die Wohnungstür ins Schloss.
Erich saß noch eine Weile im Badezimmer am Boden, ehe er aufstand, seine Jacke vom Hacken nahm und die Wohnung verließ.
Ziellos lief er durch die Altstadt. Kleine enge Gassen, alte, halbzerfallenen Häuschen, Baustellen an jeder Ecke. Die obligatorischen Döner-Buden teilten sich die ehrwürdigen Patrizierhäuser mit den Studentenkneipen. Ein fußballfeld-großer, mit Waschbetonplatten ausgelegter Platz, über dem ein gigantischer zeitgenössischer runder Turm wachte, der zum Zeiss-Werk gehörte. Erich hatte während der Fahrt gründlich im Reiseführer gelesen. Die Flanken des Platzes bildeten parkähnliche, teils mannshoch bewaldete Grünanlagen, unter deren nachgebildeten elektrischen Gaslaternen trotz der Herbstnacht vereinzelte Studentenpärchen auf Holzbänke turtelten.
Unterhalb des Turmes, fast vollständig durch Ebereschenbüsche verdeckt, blitzten Erich sehr vertraute bunte Lichter entgegen. Die blinkenden Lämpchen lockten, zogen ihn magisch an. Erich sträubte sich. Versuchte Abstand zwischen sich und das kokettierenden Licht zu bringen, indes wurde der eher geringer. Unsichtbare Seile ließen Erich unter all dem Blattwerk zielsicher die Eingangstür zur SPIELOTHEK AM MARKT aufstoßen. Er trat in einen spärlich erleuchteten Raum, mit einem unglaublich weichen, den Füßen in den harten Straßenschuhen schmeichelnden Teppich. Rechts und links der Eingangstür verführten zwei Reihen einarmiger Banditen weiter in den Raum hinein. Vor einem seltenen asiatischen YIMSA hockte ein Mann in abgetretenen Schuhen – in Reichweite seines angewinkelten Armes Aschenbecher und Bierflasche. Weiter hinten, vor einer goldgestrichenen Wand, wie auf einem Altar platziert, entdeckte Erich einen alten ROTINA. Die Front war mit hellgelbem Linoleum bezogen. Erich klopfte vorsichtig mit dem Knöchel des rechten Zeigefingers gegen die mintgrün-lackierte Außenwand: dünnes Holz. Bislang hatte er lediglich Bilder dieses Prachtstückes gesehen. Erregt zog Erich sein Kleingeld aus der Hosentasche. Er legte es in das an der Wand eingelassene goldene Schälchen. Dann setzte er sich und warf ein Fünf-Mark-Stück ein. Er zog den altertümlichen Startschalter oberhalb der Symbolfenster. Die Bildchen begannen sich zu drehen. Für das Spielen mit erhöhtem Risiko befanden sich kleine schwarze Kippschalter auf einer mit winzigen Leuchtdioden gespickten Konsole. Maximales Risiko: Erich legte sie alle um. Dann zog er den Stopper. Es gab ein schleifende Geräusch und die Bilderrollen kamen zum Stillstand. Glocke, Pflaume, Glocke. Neues Spiel…. Erich starrte gespannt auf den Farbfilm der drehenden Symbole. Er ergab ein schmutziges gelb. Jetzt STOP ziehen… – wieder nichts.
Es dauerte nicht lange und das alte Schätzchen verlangte nach neuem Futter. Ein weiteres Fünf-Mark-Stück wanderte in den Geldschlitz. Das Glück ward Erich nicht hold. Er zwang sich aufzustehen und verließ den Spielsalon. Draußen sog er tief die frische Nachtluft ein. Wenige Pärchen waren auf den Bänken verblieben. Ohne sie weiter zu beachten ging Erich die kleinen Pfade ab, die ihn an den Bänken vorbei führten. Plötzlich rief eine leise Stimme hinter ihm: „Henning?“ Erich ging weiter. Die Stimme rief eindringlicher. Erich wendete sich um. Das Gesicht dem Licht abgewandt saß dort eine dunkle Gestalt, die eine glimmende Zigarette in der Hand hielt. „Was tust Du hier?“, fragte die Gestalt und nahm die Zigarette an die Lippen. Der Zug brachte das glimmende Ende zum Leuchten – Erich sah in das Gesicht Frank Meyers. „Zu Hause rauche ich nicht“, sagte Meyer entschuldigend und blies den Rauch aus. „Wo kommst Du her?“ Erich antwortete nicht. Er stieß hörbar die Luft aus.
„Hab ich Dich da gerade aus der Spielhalle kommen sehen?“ Meyer zog erneut an der Zigarette.
„Ja, und?“ fragte Erich gereizt.
Einen Moment sagte Meyer nichts. „Nun“, er stand auf und trat die Zigarette mit dem Absatz aus, „früher hast Du es verachtet, wenn Dein Bruder Zocken ging.“ Dann drehte er sich um und verließ die Grünanlage Richtung Johannistor. Erich schaute der schmalen schwarzen Gestalt eine Weile hinterher. Die harte Kralle des Kopfschmerzes nistete sich oberhalb seines Nackens ein und begann, langsam die Schädeldecke hinaufzukriechen. Erich schloss für einen Moment die Augen. Sein Mund war trocken. Er stöhnte.
Meyer suchte seine Wohnung auf, die in Sichtweite zu jener Parkbank lag. Es war zweiundzwanzig Uhr. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schob einen Stapel Hefte beiseite. Wieso war Henning nur so komisch? Konnte man sich in fast zwanzig Jahren derart verändern? Er schien entgegen seiner früher so vehement vertretenen Ideale zu leben. Dabei hatte er, Frank Meyer, sich so gefreut, als er Henning heute morgen gegenüberstand. Er hatte geglaubt, nun endlich seine Unentschlossenheit von damals wett machen zu können und auf eine – wenn auch heimliche – Zukunft mit Henning gehofft. Meyer schaute blicklos auf seinen Schreibtischkalender. Vor seinem Mathematiker-Auge separierten sich plötzlich ein paar Zahlen: In einem halben Jahr stünde ihre zwanzig-jährige Examens-Feier an. Meyer seufzte. Er zog die oberste Schublade auf und kramte sein privates Telefonbuch hervor. Mit einem Studienkollegen stand Frank in lockerem Telefonkontakt. Das hatte sich eher zufällig ergeben. Götz Bauer, so hieß der Kollege, hatte vor vielen Jahren eine Freundin in Jena und wollte zu ihr ziehen. Da man in der DDR aber nicht einfach umziehen konnte, außer, jemand tauschte mit einem den Wohnort, dachte er an Meyer und bot ihm an zu tauschen. Jena gegen Berlin. Frank hatte lachend abgelehnt. Er sei hier so glücklich, wie niemals zuvor in Berlin. Götz war nicht sauer. Mit der Freundin zerschlug es sich bald – sie war ihm zu anspruchsvoll. Endlich fand Meyer die Nummer. Er schaute zur Uhr, befand die Zeit für ein solch wichtiges Anliegen angemessen und wählte. Es dauerte eine Weile bis am anderen Ende abgehoben wurde. Ein verschlafener Stimme fragte: „Hallo?“
„Götz, Guten Abend… hier ist Frank Meyer aus Jena“
Im Hintergrund ließ sich undeutlich eine Frauenstimme ausmachen.
„Ist ja gut, Schatz, schlaf weiter…. „ Götz’ Stimme klang wie durch Watte, sicher hielt er die Hand vors Mikrofon. „Einen Moment“, sagte er dann in den Hörer. „Ich gehe ins andere Zimmer.“
„Es tut mir leid, dass ich störe… Soll ich lieber Morgen noch mal anrufen?“
„Quatsch“, knurrte Götz. „Jetzt bin ich wach… Was willst Du Nachteule?“
„Im Juni vor zwanzig Jahren haben wir unser Examen gemacht.“
„Na und?“ Götz gähnte. „Deswegen musst Du mich doch nicht mitten in der Nacht aus dem Bett holen.“
„Das müssen wir feiern! – Was wohl aus den anderen geworden ist?… Die alten Nasen…“
Götz wurde langsam lebendig. „Zwanzig Jahre schon?“ Er pfiff durch den Spalt seiner etwas auseinanderstehenden oberen Schneidezähne.
„Wir müssen die anderen ausfindig machen!“, entgegnete Meyer. „Bei Henning Kallauch können wir uns das sparen, der ist seit heute an meiner Schule.“
Götz gähnte wieder herzhaft. Plötzlich unterbrach er die unüberhörbare Sauerstoffzufuhrübung seines Gehirns und sagte abrupt: „Henning Kallauch? … – Der ist doch tot!“
„Mumpitz!“
„Klar, Mann… der ist von der Mauer gefallen.“
„So ein Humbug!“
„Ich werd’s wohl wissen – Ich war auf der Beerdigung… Das war einen Tag nach der Grenzöffnung… So was vergisst man nicht.“
Meyer fühlte sein Herz schmerzhaft schlagen.
„Und wer ist dann der Henning…?“ Er nahm den Hörer in die andere Hand.
„Sollte…“, Götz atmete hörbar ein, „…sollte etwa der Bruder sich für Henning ausgeben?“
„Erich?… Der war doch eine STASI- Socke! Den nimmt keiner mehr als Lehrer.“
„Eben!… Drum… Mit einem solchen Lebenslauf macht kein Wendehals mehr eine Mark im Schuldienst.“
Einen Weile schwiegen beide. Dann gab sich Meyer einen Ruck
„Götz… Du hast Recht…. Er hat sich wirklich merkwürdig verhalten…“ Er strich sich entgegengesetzt zum Wuchs über das kurzgeschorene Haar. „Vorhin… da habe ich ihn erwischt, wie er aus der Spielhalle kam…. “ Meyer rückte seine Brille zurecht, seine Stimme wurde leiser, kaum noch wahrnehmbar: „Das ist Erich Kallauch…“
Grußlos ließ er den Hörer auf die Gabel gleiten. Dann saß er reglos, sein Atem ging oberflächlich, hektisch. Zwischen den Fingern knetete er die Telefonschnur.
Nach einer Weile griff Meyer erneut zum Hörer.
Erich war nach Hause und zu Bett gegangen. Morgen wollte er sich weiter mit seinen Problemen befassen – heute ließ sich nichts mehr bewegen. Einmal darüber geschlafen und die Sache erschien heller. In dieser Nacht plagten Erich heftige Träume. Gegen Morgen träumte er von der Verhaftung seines Bruders. Vollkommen realistisch zog das Geschehene an ihm vorbei. Mit einer winzigen Ausnahme: Erich war nur Zuschauer. Er sah sich durch das weihnachtlich geschmückte Berlin laufen – ziellos, mit starrem Blick. Vor einem Schaufenster, durch dessen Auslage eine Modelleisenbahn langsam kreiste, blieb er stehen, betrachtete sein Spiegelbild und begann nach einer Weile ein Zwiegespräch mit seinem Abbild.
„Was soll ich tun?“
„Halt Dich an die Dienstanweisung!“
„Aber er ist mein Bruder.“
„Die Dienstanweisung lautet: Anzeigen des staatsfeindlichen Subjektes!“
„Mein Bruder ist kein Subjekt!“
„Aber staatsfeindlich!“
„Soll ich ihn schützen?“
„Es kommt sowieso raus!“
„Aber nicht durch mich.“
„Zeig ihn an!“
„Was weißt Du schon.“
„Es ist Deine Pflicht!“
Das Schaufenster spiegelte den Kampf in Erichs Gesicht.
Dann wandte er sich ab und schlug den Weg zur Normannenstraße ein. Als er sich an seinem Dienstschreibtisch das Protokoll über Henning ausfüllen sah, erwachte Erich schweißgebadet. Sein Herz raste und der Schlafanzug klebte am Körper. Erich setzte sich im Bett auf. Der Schwindel, welcher ihn schon am Abend heimgesucht hatte, bemächtigte sich erneut seines Kopfes. Erich presste die Kuppen der Zeigefinger gegen die Schläfen und schloss die Augen. Er zwang sich, tief und gleichmäßig zu atmen. Der Druck und die Drehbewegungen seines Gehirns ließen etwas nach. Erich öffnete die Augen wieder und starrte auf das Fußende seines Bettes. Genauso hatte es sich abgespielt. Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages waren dann zwei Herren aus der Normannenstraße erschienen und hatten Henning mitgenommen. Erich saß reglos. Hätte er sich doch nie an die Dienstanweisung gehalten!
Draußen ratterte eine Straßenbahn, als Punkt sechs Uhr morgens die unbarmherzige Türklingel losbrüllte. Erich schleppte sich im Schlafanzug zur Tür. Er war nicht erstaunt, zwei zivile Kripobeamte dort vorzufinden.
„Erich Kallauch? … Ziehen sie sich etwas über und kommen sie mit!“

Meine Freundin Moni flüstert mit Bäumen. Sie beschäftigt sich esoterisch mit Baumwissenschaften. Kennt Ihr?
Der Lehre nach besitzt jeder von uns seinen Partnerbaum. Also einen, der ihm wesensgleich ist. In meinem Fall – meint Moni – sei das der Apfelbaum!
Da muss sie sich irren, weil wenn ich einen Apfelbaum betrachte, regt sich bei mir wenig. Handelt sich um einen Baum – genau wie der sich vermutlich denkt: Oha, ein Mensch, der mich leer frisst.
In Wallungen gerate ich aber bei Birken und bei Fichten!
Rauschende Birken, deren lange Wedel wie Besen vom Himmel baumeln, und romantische Märchenwaldfichten mit leckerer Pilzpfanne darunter. Einfach herrlich, da geht mir das Herz auf!
Vermutlich liegt meine Resonanz daran, weil‘s rund um mein Elternhaus so ausschaut. Wir thematisierten das ja schon des Öfteren: Ich kenne Fuchs und Hase in der zigsten Generation persönlich.
So, wat soll dat denn nun mit der langen Einleitung?
Hier beißt sich die Katz nämlich in den Puschel!
Ich wohne nun schon eine Weile nicht mehr bei den Eltern. Es war, wie das bei vielen Landeiern schon immer der Fall war: Wir schnürten ein Bündel und machten uns auf den Weg zu den big Jobs! Zu allem Übel verliebte ich mich dann auch noch unterwegs – na und so kam halt eines zum anderen.
Weil es meinem Ausgeguckten nach einer Weile kräftig auf die Zwiebel ging, dass ich ihm bei jeder Gelegenheit ins Ohr lamentierte, wie sehr ich meine Bäume vermisste – suchte er nach angemessener Zeit einen baumreichen Stellplatz für uns. Gleich neben einem Fichten-Paar schlugen wir unser Zelt auf.
Zwei 🌲🌲 übrigens, von denen der Tannenfreund träumt: schlanke Gestalt, gerader Wuchs und lange Wedel mit feine Zapfen zur Weihnachtszeit. Katalogisiert als was Serbisches – während der Eiszeit hatten die sich nach dorthin in Sicherheit gebracht.
Die Bäume und ich: Vom ersten Kontakt an lief das super mit uns! (Ich meckere seitdem auch viel weniger über andere Dinge.)
Klingt alles fein? Aber jetzt mischt Dramatik rein!
Im trockenen Sommer vor drei Jahren, als auch hier in meiner beschaulichen Pott-Gegend das Fichtensterben begann, schwor ich meinen Tannen: „Ab jetzt gieße ich Euch! Wer keinen Durst leidet, der kämpft besser! Euch holen diese Scheißviecher nicht!“
Die ersten beiden Jahre lief alles glatt. Meine Schönen: frisch und grün, eine Augenweide. In diesem Frühjahr war es aber so, dass ich ein Projekt hatte. Die Deadline nahm mich so in Anspruch, ich kam wochenlang kaum noch vor die Tür. Je heißer es draußen wurde, desto heißer wurde meine Arbeitsphase. Ich ging nicht mehr nur nicht raus, ich vergaß auch alles außerhalb meines Schreibtischradiuses. Leider vergaß ich auch mein Versprechen …
Meine Schützlinge müssen nach mir gerufen haben – Bäume schreien nämlich im Ultraschallbereich, wenn sie Durst haben! – ich hörte sie nicht.
Eines Tages – endlich hatte ich meine erste Abgabe hinter mich gebracht – trat ich blinzeln nach draußen ins Sonnenlicht. Mann, war das grell!
Meine Tannen litten, das erkannte ich auf den ersten geblendeten Blick.
Schnell füllte ich aus dem Teich zwei Gießkannen, die sie gierig austranken. Weil mir selber klar war, dass eine popelige Kanne pro Baum nicht reichte, holte ich den Schlauch. Bei der Gelegenheit entschuldigte ich mich ehrlich für die Vernachlässigung. Obenrum wirkten sie gleich ein wenig frischer. Die Stämme schauten auch kräftig aus – noch mal Glück gehabt!
Warum ich mich dann ins Dickicht schlug, weiß ich auch nicht, es muss wohl Intuition gewesen sein. Jedenfalls zwängte ich mich zwischen Brombeergestrüpp und anderem fleischfressenden Grünzeug rein und in dem Augenblick, wo sich zwei so dämliche Ranken um meine linke Wade würgten, um mich gemeinsam von den Füßen zu zerren, entdeckte ich am Stamm der Rechten ein paar kleine Löcher. Knapp darunter hatte ein winziges Spinnennetz gelbbraunes Pulver aufgefangen, sah aus, als hätten die mit Kurkuma gewürzt. Weiter oben das Gleiche. Da lag eindeutig Sägemehl! Geschockt scannte ich den kleineren der Bäume – sah so ähnlich aus.
In dem Moment kam mein Mann von der Arbeit nach Hause. „Was machen wir denn jetzt??“, wetterte ich los.
Mein Mann winkte ab: „Quatsch, die haben nichts, die sind beide grün!“
Nun ist mein Mann nicht bloß ein Mann, er ist obendrein Städter …
Ich gab aber sofort Ruhe, ich wollte gar nicht recht behalten!
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen! Auf der Stelle korrigierte ich deshalb meine To-do-Liste! Auf Prio 1 – in Rot und fett! – blinkten jetzt statt des Jobs meine Tannenbäume! Täglich 2 x goss ich sie fortan. Frühmorgens und am Abend.
Nach drei Tagen fingen meine Lieblinge an zu nadeln. Normal, eine monatelange Durststrecke steckt man nicht so einfach weg. Ging mir ja selber auch so. Indes nahm die Erderwärmung weiter zu und es wurde draußen fürchterlich heiß. Die Bäume schwitzen auch mega und schmissen so heftig viel Nadelkleid von sich, dass ich die Terrasse fegte. Sehr zum Ärger des kleinen Spechts, der ein paar Tage zuvor in meine Weihnachtsbäume eingezogen war. Der Kleine kriegte bald einen Herzinfarkt, als ich meinen Besen zückte. Damit er seine Arbeit tun konnte, ließ ich das mit dem Fegen wieder sein.
Machen wir es kurz ….
Trotz der extremen hochsommerlichen Temperaturen schneite es nun fett bei uns im Garten. Ohne Unterlass segelten grüne Flocken vom Himmel und deckten alles zu, was draußen stand.
Ganze drei Wochen hat die Belagerung gedauert, dann war es vorbei …
Heute kommen die Gärtner 😢
 Ein Buchdrucker ist nicht nur ein Buchdrucker – er kann auch Borkenkäfer sein! 🙀
Ein Buchdrucker ist nicht nur ein Buchdrucker – er kann auch Borkenkäfer sein! 🙀
P.S.: Ich hoffe sehr, dass sich das mit den Borkenkäfern so verhält, wie das mit den Buchsbaumzünslern der Fall war: Eines Tages waren die einfach wieder verschwunden! 💪🏼
P.P.S.: Und wer neugierig ist und wissen möchte, welches geheime Projekt das war, das mich meine Fichten vergessen ließ, der schreibt mir gerne eine Mail: send2goodword@gmail.com
Zumindest der Teil ist mir nämlich gelungen! 🙂

Moin Leute!
Ich habe da eine Wissenslücke. Dreht sich um Brillen, da kenne ich mich nicht aus. Bei uns daheim trägt nämlich keiner eine. Ich nicht, Kinners nicht, Großeltern nicht – alle linsen verstärkerfrei. So die Situation zumindest bis vor einer Weile.
Doch eines Tages erreichte mein Gemahl ein Alter, wo man sich beim Lesen gerne zwei dieser intelligenten Käuzchenlupen auf den Nasenrücken zwickt. Der Gatte hätte das auch seinlassen können, ließen sich seine Arme teleskopisch verlängern. Weil das biologisch nicht vorgesehen ist, suchte mein Mann nach angemessener Leidenszeit einen Optiker auf. Der bastelte ihm ein schickes Nasenfahrrad zurecht; das stand ihm wirklich ausgezeichnet!
Nun ist das aber auch schon wieder eine Weile her und mein Mann bräuchte in mancher Lesesituation zusätzlich zum Zwicker wieder seine Teleskoparme. Vor allem abends und bei schummeriger Beleuchtung. Also wurde er erneut beim Optiker vorstellig. Diesmal einem anderen, der alte war in Rente gegangen.
So und jetzt kommt der Punkt, wo ich nicht weiter weiß!
Als ich blutjung war, guckte ich regelmäßig fern. Ich war so richtig mit den Werbeblöcken vertraut. Später produzierte ich die Spots selber mit – darüber verlor ich allerdings die Lust am Fernsehgucken. Seitdem gucke ich nichts mehr. Außer Tatort. Aber der kommt öffentlichrechtlich und deswegen werbefrei.
Jedenfalls ist mir aus meiner aktiven Glotzzeit ein nerviges Kind in Erinnerung geblieben. Ein vorlauter Bengel mit einer riesigen Zahnlücke und einer noch viel größeren grasgrünen Froschbrille im Gesicht. Der brüllte von der Mattscheibe, dass sein Papa keinen Cent dazubezahlt hätte.
Was die im Fernsehen erzählen stimmt immer. Das darf man ungefragt glauben. Mein Mann also auch in den Laden reingeschneit. Was aber echt sonderbar: Die präsentierten ihm eine fette Rechnung!
Woran liegt das denn? Liegt das daran, weil er selber bezahlt?
Was ist das nun wieder für eine Form der Diskriminierung?
Kann doch nicht sein, dass nur Leute nix bezahlen, wo der Vatter mitkommt!
Oder liegt das am Alter?
Hätte er mehr rumbrüllen müssen?
Ich könnte das alles natürlich auch schön still für mich allein im Kämmerlein herausfinden. Aber ich frag lieber Euch, das ist geselliger! Außerdem habt Ihr viel bessere Ideen als sämtliche Infoseiten im Internet zusammen! ❤
Was empfehlt Ihr denn? Wie händelt man denn nun das mit dem Altersleselicht am wirtschaftlichsten?

Hi Leute!
Na, wie schaut es aus? Geht es Euch allen gut?
Ich habe länger nichts mehr erzählt – ich war mit einem großen Projekt beschäftigt.
Habe ich nun alles schön beendet und abgeliefert 📇 – und auf einmal eine Menge Zeit. 🙂
Könnte ich gut hier mal wieder was zur Unterhaltung beitragen!
Seid Ihr denn überhaupt noch alle da?
Ihr geschätzten Leser, Ihr liebreizenden Kommentatoren, Ihr eloquenten Blogger?
Ich frag besser erst nach, weil ob sichs lohnt … ❤
Mit frühherbstlichem Sonnengruß,
Eure Anke
P.S.: Liebe Mailabonnenten, bitte verzeiht den Traffic in Euren Kästen – ich fand leider kein Knöpfchen, Euch mit dem Lebenszeichen zu verschonen. 🙂

Weisheit des Konfuzius

Am Freitag wollte mir meine Arbeit nicht recht von der Hand gehen und so vertrieb ich mir die Zeit mit Hausarbeit.
Zuerst kratzte ich Unkraut aus den Pflastersteinen vorm Haus und weil es danach nicht besser um meine blitzgescheiten Ideen stand, wässerte ich die Bäume.
Immerhin ist es heiß und da trinken alle viel.
Ich kniete mich am Teich nieder und wie ich gerade die Gießkanne unter Wasser döppte, durchfuhr meinen kleinen Finger ein heftiger Schmerz.
Was war das??
Hatte sich die blöde Kanne etwa gewehrt und mich gebissen?
Die sollte sich mal nicht so anstellen, ich hole seit Jahren auf die Art Gießwasser aus dem Teich.
Doch dann sah ich es: Eine Wespe hatte mich gestochen!
Das Viech musste sich genau so erschrocken haben wie ich, denn es war ins Wasser gefallen und strampelte wild.
Nun bin ich ja ein herzensguter Mensch.
Augenblicklich vergaß ich mein eigenes Leid und hatte nur noch die Rettung des zappelnden Lebens im Sinn.
Eilig tauchte ich also meine schmerzende Hand in die Dreckbrühe, entfaltete sie unter der Wespe wie eine Rettungsinsel, zog raus: Da stach das Scheißvieh mich noch einmal!
Diesmal in den Ringfinger!
Herrschaftszeiten, tat das weh!
Brüllen und Vieh abschütteln war eins!
(Ich möchte mich an der Stelle aufrichtig bei meinen Nachbarn entschuldigen!)
Das Viech landete abermals in den Teich – es konnte mich jetzt am Arsch lecken.
Gerade wollte ich in die Küche eilen, um mir aus Erste Hilfe-Gründen eine Zwiebel aufzuschneiden – da kriegten meine Fische die Sache spitz.
Der dickere von beiden, Lilly genannt, dümpelte wie ein Hai von unten heran und sperrte in Zeitlupe das Maul auf.
Ich brüllte zwar, er soll das lassen, aber es half nichts: Plopp, war die Wespe verschwunden.
Mir blieb erneut fast das Herz stehen.
Mein Lillyfisch verzog sich daraufhin eilig mit seiner Beute unter die Seerosen.
Sein Kumpel schwamm mit, die beiden sind halt ein Schwarm.
Sie scheinen es aber beide überlebt zu haben, denn bis jetzt treibt keiner oben.
Ich muss die gleich erst mal füttern, nicht dass die nachher meine Gießkanne auffressen!

Immer wenn ich Brot hole, fahre ich mit dem Fahrrad durch den Wald. Insgesamt bin ich knapp eine Stunde unterwegs, deswegen gehört so eine Beschaffungstour reiflich überlegt. Per Häkchenkontrolle ist abzuklären:
– Regnet es auch nicht?
– Habe ich denn Zeit?
– Hat der Bäcker überhaupt offen?
Natürlich könnte ich mir das ganze Theater auch sparen und wie jeder normale Mensch die Straße benutzen. Dann wäre die Sache auch binnen zwanzig Minuten erledigt. Aber ich liebe die Tour und habe richtig Freude daran. Das ist ähnlich beschaulich wie bei Rotkäppchen, nur mit moderner, ans Zeitgeschehen angepasster Handlung. Seine Großmutter hat heute keiner mehr mutterseelenallein im Wald wohnen, und damit ich mich zwischen finsteren Fichten nicht vorm bösen Wolf fürchten muss, habe ich ein Pfefferspray dabei.
Aus den genannten Gründen rede ich mir seit Jahren ein, dass zum Bäcker keine Straße führt. Das klappt auch gut, wir essen halt wenig Brot.
Gestern Nachmittag sprach nichts gegen eine Beschaffungstour. Es nebelte scheußlich wie in einer Waschküche, das Thermometer bibberte bei vier Grad, die Turmuhr zeigte kurz vor 15:00 – wenn ich mich beeilte, käme ich noch vorm Dunkelwerden zurück nach Hause. Vor allem könnte ich es mir aber erlauben, die letzte lange Steigung mit meinem unbeleuchteten Fahrrad auf der Straße hochzustrampeln. Da habe ich deswegen immer Bock drauf, weil ich dabei richtig schön ins Schwitzen komme. Also hurtig!
Beim Bäcker ergatterte ich das allerletzte Brot aus dem Regal – was Kleines, so was in der Menge für zwei der sieben Zwerge – und machte mich mit meiner Beute auf den Weg in den Wald. Wie es der Zufall will, hatten etliche Mülheimer Hundebesitzer die gleiche Idee mit dem fixen Heimkommen vor der Dämmerung und so war es ungewöhnlich voll.
Gerade sauste ich bei den ersten Fichten am Bächlein um die Kurve, da gewahrte ich hinter der Brücke vier dick vermummte Damen älteren Semesters. Die schlenderten nebeneinander und nahmen die komplette Breite des Weges ein.
Wobei Weg echt untertrieben ist. Er hat die Abmessungen einer Straße, auch die Qualität. Der Asphalt weist weniger Schlaglöcher auf, als die Straße, auf der ich wohne.
Die Damen schwatzten aufgeregt und verhielten sich auch ansonsten arttypisch. Vornweg versuchte ein kleiner Hund heimzuflitzen. Er trug Mäntelchen und Stiefelchen und zog so kräftig an der Leine, dass er auf den Hinterbeinen lief und vorne hoch stand. Wohl wegen seines Fliegengewichts und wegen des interessanten Gespräches schienen die Damen das aber nicht zu bemerken.
Ob der Kaffeekränzchen-Idylle plagte mich zwar ein wenig das schlechte Gewissen, doch dann betätigte ich sacht meine Klingel. Nichts passierte. Ungerührt palaverten die Damen weiter. Ich schellte lauter: wieder nichts.
Vemutlich lag es an den wollenen Mützen und an den Ohrenschützern, dass die Girls nichts hörten und so bremste ich hinter der Truppe scharf ab. Doch auch meine quietschenden Reifen störten sie nicht und so blieb mir nicht weiter übrig, als mich auf dem Grünstreifen vorbeizuquetschen. Ich entschied mich für die Seite mit dem schmächtigsten Weiblein.
Das hätte ich besser bleiben lassen sollen, denn als ich eben auf gleicher Höhe dran vorbeischlich, kreischte das Weiblein fürchterlich auf.
Vor Schreck fiel ich fast vom Fahrrad!
Doch damit nicht genug: Statt wenigsten stehen zu bleiben, sprang die dusselige Kuh auf meinen Gepäckträger!
In letzter Not gelang es mir, den Drahtesel in Balance zu halten. Leider kam ich trotzdem von der Straße ab.
Wie ich mit der entführten Alten schnurstracks auf dem Weg in den Bach war, hatte die Zweite sich so weit gefangen, dass sie losblökte: „HILFE! HILFE!“
Die Dritte kreischte: „POLIZEI!
„KLINGELN SIE GEFÄLLIGST, JUNGE FRAU!!“, brüllte die Vierte.
Herrschaftszeiten, ich sage Ihnen weiter nichts! Mein Herz! Die Girls machten so einen Terz – so muss es dem Fuchs ergehen, wenn er im Hühnerstall vom Bauern erwischt wird. Also machte ich es wie der Fuchs und gab eilig Fersengeld.
Ich hatte mich gerade wieder beruhigt, bog 800 Meter weiter um die nächste Ecke, wanderte vor mir eine junge Frau mit vier riesengroßen Schlittenhunden. Wieder über die gesamte Wegbreite verteilt. Ich dachte noch: Nicht schon wieder! – Doch die junge Frau achtete auf ihrer Umwelt. Sie gab den Hunden ein Kommando und die vier stellten sich brav zwei rechts und zwei links vom Frauchen auf.
Wir Frauen winkten uns zu, wir lächelten uns an und setzten beide beschwingt unseren Weg fort.
So einfach kann einem ein Lächeln den Tag erhellen.
So, und wie ich kurz davor war, den Wald zur Straße hin zu verlassen, dann noch diese beiden sportlichen Herren hier: mit extrabreiten Lenkern gestylte und schön eingeschweinste Biker im besten Mannesalter.
Die heizten wie zwei Kometen auf mich zu.
Solche Vorstandvorsitzenden, die gemeinsam auf der Jagd Geschäfte machen – sicher wissen Sie, welchen Typus Mann ich meine. Die reiten da nach ihrem Bürotag, der aus unnützen Konferenzen, überflüssigen Telefonaten, Schlipswechseln und täglich neu verteidigter Hackordnung besteht, mit gezogenen Lanzen durch den Wald. Sie sind auf dem Survivaltripp und haben vorher gemeinsam zwei Kilo rohes Fleisch verschlungen, damit der Aggressionspegel auch hier in der Natur nicht sinkt. Wer sich ihnen in den Weg stellt, wird überrannt. Ich habe sie echt dick, solche Kerle.
Jedenfalls schossen die beiden Lichtgestalten gleichfalls wegbreit heran. Logisch, die nehmen ja schon einzeln mächtig Raum ein – allein die Aura drückt uns Kleinvieh wie ein Rambock von der Piste.
Jetzt ist es aber so, dass ich mit einem Fahrrad geboren wurde. Würde ich zu Fuß schüchtern und ängstlich vor soviel geballter Entscheiderkompetenz beiseitespringen und schuldbewusst für nichts den Kopf senken – straffte ich mich stattdessen und fasste den Lenker fester. Ich kniff die Augen ein bisschen zusammen und hielt die Spur. So in etwa.
Doch der Zufall oder das Schicksal wollten es – oder vielleicht waren es auch die beiden Idioten gemeinsam: Plötzlich lag da auf dem Teerweg vor mir ein überdimensionaler Pferdeschiss! Fein säuberlich Appel für Appel zu einer Pyramide gekackt – bestimmt einen halben Meter hoch!
Verdammte Scheiße, ich und die Chefs würden genau am Scheißhaufen zusammentreffen!
Der Riesenschiss war megafrisch, er dampfte sogar noch.
Der Herr Generaldirektor, der auf meiner Seite fuhr, gewahrte den Kack wohl im gleichen Moment wie ich, denn er grinste fies. Der andere Bankier kriegte die Sache auch spitz und grinste noch fieser. Eines muss man solchen Typen ja lassen: Deren Auffassungsgabe ist wieselflink!
Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass die die Sache auf einmal als Autorennen einstuften. Sie wissen schon, als Illegales. So eines, wo beide Kontrahenten aus entgegengesetzten Richtungen aufeinander zurasen, und der mit den schwächeren Nerven im letzten Moment beiseite zieht. Mit dem Unterschied, dass sich normalerweise beide Parteien einig sind und keiner ungewollt, so wie ich eben, Protagonist und somit Teil der Show wird.
Aber man muss das Leben nehmen, wie es kommt!
Zum Glück stamme ich aus einer Zeit, wo man bei kleinen Problemen weder zur Kindergärtnerin, noch zur Mutter, geschweige denn die zur Lehrerin rannte. Wir lösten noch selber.
Und so gab ich mich der Sache halt hin und stellte mich: Ich fasste den Lenker noch ein wenig fester, kniff die Augen noch ein bisschen mehr zusammen und trat noch kräftiger in die Pedale.
Die Leitfigur, die auf mich zuschoss, erkannte wohl meine Absicht, nicht zu weichen, und verlegte sich augenblicklich aufs Rumbrüllen, darauf verstehen sich solche Typen ja besonders gut: „DU DÄMLICHE PUTE! WENN ICH DAS SCHON SEHE! BLOSS NICHT BREMSEN!“, feuerte er mitten im Naturschutzgebiet eine Maschinengewehrsalve auf mich ab. Im selben Moment sausten wir um Haaresbreite aneinander vorbei. Der Ärmel seines BikerJackets schürfte über meinen kleinen Finger.
„Arschloch!“, informierte ich und weil ich so viel Schwung hatte, war der Wald da auch schon zu Ende.
Diese Brottour war mir jedenfalls zu aufregend.
Das nächste Mal fahre ich auf der Straße, da ist zwischenmenschlich weniger los.
Und vielleicht gibt es dann bei uns auch öfter mal ein Brot zur Wurst.
Lasst Euch nicht die Butter vom Brot nehmen, Leute!

Soll ich Ihnen mal einen von meinem Weihnachtgesteck erzählen? Wir müssen mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen, das wird uns allerorten erzählt. In diesem Advent mache ich mal was, dafür krieg ich ganz bestimmt einen Nachhaltigkeitspreis!
Doch lassen Sie sich erzählen!
Im September bestellten meine Nachbarn Sperrmüllabfuhr. Es handelte sich dabei um eine Mischung aus Sperrmüll und einer halben Haushaltsauflösung. Will sagen: Da stand richtig viel draußen!
Jetzt ist mein kleines Flatter mentalitätsseitigt ein Sammler. Das ist wohl fast allen Kindern eigen: Sie horten Schätze. Im Laufe des Lebens verliert sich das bei den Meisten wieder, da schlägt das dann ins Gegenteil um und sie schätzen Struktur und Übersichtlichkeit.
Noch ist nicht abzusehen, zu welcher Besitzkultur Meines später zählen wird – solange verhält es sich eben altersgerecht. Aufgeregt flatterte es um den riesigen Haufen Hausrat herum und trug ein Teil nach dem anderen ab. Es schleppte auch ein Adventsgesteck an. Vier dicke, fast unversehrte Kerzen, Kugeln drumherum und das ganze auf Tannenbraun gebettet. Ehemals frisches Grün – aber der Zahn der Zeit – Sie wissen schon. Das Gesteck war halt in die Jahre gekommen.
Den ganzen Herbst über stand das Gesteck dann bei uns im Wohnzimmer. Zwischen dem Abtreter der Terrassentür und dem Fischfutter. Ich habe im Moment eben viel zu tun, ich lamentierte ja bereits. Das Stillleben fiel mir nach dem ersten Tag schlichtweg nicht mehr auf. Der ankompostierte Kranz hatte sich vollkommen in unserem Wohnzimmer integriert. Vor allem farblich.
Kleine Kinder haben eine innere Uhr eingebaut: Kurz nach den Sommerferien fangen sie an, über Weihnachten nachzudenken. Was sie sich wünschen, vielleicht auch, ob sie brav genug waren … Das Daran-Herumdenken intensiviert sich dann jede Woche um ein kleines Stück. Bei uns war es so, dass ab Anfang November der Geist von Weihnachten einzog. Eines Mittags nach der Schule befreite mein Töchterchen das Adventsgesteck von Spinnenweben und Fischfutter und schleppte es ins Treppenhaus.
„Wo willst du denn damit hin?“, fragte ich, als sie an meinem Schreibtisch vorbeischnaufte.
„Ich such dem jetzt einen Platz!“
Ein Seitenblick auf das Gesteck: Sie hatte recht: von der Farbe ab, sah es wirklich nett aus. Sollte sie mal machen!
Ich vertiefte mich wieder in meine Arbeit.
Es rumorte im Flur herum, es klapperte hier und da – weil aber nichts polterte und auch keiner um Hilfe rief, kümmerte ich mich nicht darum. Ich war halt beschäftigt.
Kurz darauf tauchte das Kleine an meinem Schreibtisch auf: „Ich bin fertig. Ich habe einen tollen Platz gefunden! Magst du mal gucken?“
Ich weiß schon, ich hätte ja-sagen müssen! Schon allein deswegen, damit es sich ernst genommen fühlt!
Nun bin ich aber Freiberufler. Die sind so frei in ihrem Tun, dass wenn sie den Job nicht erledigen, fix ein anderer dafür einspringt. Ich quetschte also ein „Später!“ zwischen den Lippen hervor und hoffte inständig, dass mir über dem Gequatsche jetzt nicht der rote Faden abhandenkam.
Die Tochter erkannte das und verzog sich mit dem Schulranzen in ihr Zimmer. Sie hatte auch zu tun: die Hausaufgaben.
Wir beiden Girls also jede an ihrem Schreibtisch versumpft, keiner dachte mehr an Weihnachten oder irgendwelchen anderen romatischen Schnickschnack. Bis zu dem Moment, als jemand die Haustür aufstieß! Es schepperte und dröhnte fürchterlich, so als wäre ein Bus ins Treppenhaus reingebrettert! Im gleichen Moment brüllte eine Stimme: „WELCHER DÄMLICHE IDIOT HAT DENN DEN KUPFERKÜBEL HINTER DIE TÜR GESTELLT??“
Die Stimme gehörte zu meinem Pubertikel, er war stark erkältet nach Hause gekommen. Weil er auch im männlichen Siechtum ein kräftiger Junge mit viel Schmackes ist – hatte er mit dem Zimmermannsbrett den Kupferkessel durch den ganzen Flur katapultierte. Kurz fragte ich mich ebenfalls, was zum Henker der Eimer hinter der Tür zu suchen hatte! Normalerweise ruht er sicher auf seinem Platz auf der Heizung und beherbergt sämtlichen Schlüssel, Türöffner und sonstigen Krimskrams, wo keiner von uns weiß, wohin damit. Doch dann fiel es mir wie Christbaumkugeln aus den Augen! Da stand jetzt das Adventsgesteck!
Äußerlich erlitt der Kupferkessel zwar nur ein paar Blessuren – er hält sich aber nicht mehr gerade. Er kippelt und das ist schlecht bei dem Konvolut in seinem Gedärm. Ich denke, wir werden das Adventsgesteck einfach auch unterm Jahr auf seinem Platz belassen.
Wenn‘s Dunkel ist, sieht man dem sein Alter gar nicht an!

Da kam ich gestern Abend spät nach Hause – mein gehetzter Blick schwiff auf dem Weg in die Küche wie üblich über meinen Schreibtisch – da bin ich aber fast auf der Stelle tot umgefallen!
Hatten die mir die Viecher hier auf den Laptop gesetzt!
Nachdem meine Schockstarre sich etwas gelockert hatte, erkundigte ich mich, was das sollte. Also, will sagen, ich stieß einen Brüller aus.
„Das ist nur meine Bio-Hausaufgabe“, kam es vom Fernseher.
„Lose Viecher?“
„Ne, muss ich noch aufkleben.“
„Wie soll das denn gehen? Meinst du, die finden das gut?“
„Ist doch den Bildern egal, wohin ich die kleb.“
Erst jetzt wurde mir klar, dass die fette Assel links im Bild nicht im Stechschritt über meinen aktuellen Job sauste, und dass die riesige Schnecke nicht verträumt den Schleimfuß aus ihrer Hütte baumeln ließ. Wir hatten es hier ausschließlich mit Fotos zu tun! Die sahen aber verdammt 3D-echt aus. Meine Fresse!
„Wann passiert das denn mit dem Aufkleben?“
„Keine Ahnung, ich bin so müde. Ich schau mal … vielleicht morgen früh.“
„Brauchst du die Hausaufgabe für morgen?“
„Na logisch! Sonst hätte ich doch noch nicht damit angefangen!“
Nun habe ja nichts gegen Kellerasseln und auch nichts gegen Schnecken. Ich kann die eigentlich ganz gut leiden. Aber so heftig vergrößert und detailverliebt auf meinem Tisch …
Ich habe jetzt erst mal eine Zeitung draufgedeckt. Solche Viecher mögen es ja gern eng und finster.
Wenn die mir aber morgen früh immer noch in die Tastatur scheißen, miete ich mich in einer Bürogemeinschaft ein!

Liebe WordPresser,
ich hatte Euren Rat befolgt und zwecks der widrigen Einstufung meiner Kommentare als Spam den WordPress-Support kontaktiert. Wir verbrachten den Tag mit nettem Hin-und Herschreiben, will sagen: Die androiden Supporter nahmen sich hilfsbereit und ausnehmend fix meiner Unannehmlichkeit an. Binnen Tagesfrist wechselten wir drei freundliche E-Mails.
Die Sache ist nun offiziell als „geklärt“ eingestuft und die Essenz und den good Advice aus der finalen Abschlussklärung letzte Nacht will ich Euch nicht vorenthalten!
Mit meinen Softwareeinstellungen sei alles in Ordnung – ich benutze mittlerweile auch das aktuelle Update.
Man könne sich die nahezu flächige Einstufung meiner Kommentare als Spam nur so erklären, dass …
Na, seid Ihr schon gespannt? 🙂
… wo war ich denn jetzt? Ich habe irgendwie den Faden verloren … Ist ja heute auch mächtig heiß draußen und Mückenstiche habe ich letzte Nacht auch ein paar hinzubekommen. Mann, juckt mir das heute am Hals!
Ah, beim Hals fällt es mir auch wieder ein! Ich wollte verraten, was ich aus des Androiden Sicht falsch mache 🙂
Der schreibt: Ich würde zu viel kommentieren!
Jawohl, ich soll ein bisschen weniger hier herrumschwätzen!
Aufs Lesen hin beschlich mich der Verdacht, dass ich anstatt mit dem WordPress-Support wohl eher mit einem Strohmann meines aktuellen Projektgebers Mailverkehr gehabt haben könnte …
Also, Leute, jetzt wisst Ihr jedenfalls Bescheid. Ich soll nicht labern, ich soll strebsam arbeiten!
In diesem Sinne 😉
 Alles Mülleimer, oder was? 🙀
Alles Mülleimer, oder was? 🙀(Foto: Georg Teiner)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Hat Frau Müller-GoodWord eine heftige Bloglesemüdigkeit ergriffen?
Oder ist die heitere Dame beschäftigt; hat sie keine Lust – oder ist sie gar erkrankt?
Vermisst Ihr ihre Kommentare unter Euren geschätzten Beiträgen?
Dann guckt besser schnell mal rein in Eure Spamfilter!
Und befreit sie dort aus der neuen Form von Cybermobbing, die die hier auf der Spielwiese gerade gegen sie betreiben!
Spam-Filter sind etwas Tolles – aber da gehört sie doch nicht rein!
Falls eine Petition nötig wird: Unterschreibt Ihr dann für ihre Rechte? ❤️
Viele Grüße aus Mülheim,
Eure auf fingertot gesetzte Frau Anke Müller-GoodWord, aus dem stillen Kämmerlein ihrer Zwangsisolation heimlich herausgefunkt 😭

Hi Leute!
heute ist ja Freitag. Klimafreitag! Da will ich auch meinen Senf dazugeben!
Es ist so: Meine Klimabilanz für heute sieht erschreckend aus. Gleich morgens früh um acht hatte ich einen Termin in der City. Jetzt bin ich ja nicht nur ein Cycloholik, ich fahr auch so grundsätzlich nicht mit dem Auto in die Mülheimer Innenstadt! Da verweigere ich mich strikt. Und das nicht erst, seitdem das modern ist. Das Warum ist ganz einfach in einem Satz zusammengefasst: Mülheims Stadtplaner waren entweder besoffen oder aber von Haus aus nicht ganz auf der Höhe, also bildungsseitig. Die Beweggründe für die planerische Misere aus sinnfreien Einbahnstraßen, Dauerbaustellen und sonstigem verkehrsbehinderndem Mist sind auch irrelevant – allein das Ergebnis zählt. Und mit dem verhält es sich jedenfalls so, dass ich mit meinem Fahrrad als Chef über den Ring sause.
Jetzt kommen wir aber mal zum Klimapunkt! Heute Morgen an der frischen Luft: drei Grad und eisiger Wind. Nachdem ich nach einer halben Stunde am Ziel anschnaufte, waren mir die jeweils körperentferntesten Extremitäten zapfig gefroren und auch meine Ohren schmerzten. Nicht schlimm, dachte ich mir, dauert ja sicher ewig, bis ich hier fertig bin.
War aber nix. So schnell wie heute früh habe ich noch nie etwas erledigt! Exakt vierzehn Minuten nach Ankuft stand ich schon wieder – und immer noch zitternd – auf der Straße. Nun bin ich ja Fux und sauste durch den stehenden Berufsverkehr wieder mit Vollgas nach Hause. Bewegt man seine Muckis, entsteht als Abfallprodukt Wärme. Lernt mein Geflügel gerade im Biologieunterricht. Ich trete also kräftig rein – so kräftig, dass der Wind luftig durch mein Businessjäckchen durchpfeift, als wär ich drunter nackert.
Als ich hier oben auf meinem Berg rücklangte, war ich doppelt schockgefroren und die Kältestarre reichte nun bis zu meinen Ellenbogen und bis zu meinen Knien rauf.
Das Ganze ist mittlerweile zwei Stunden her. Seitdem mache ich mir in der Mikrowelle ein Kirschkernkissen nach dem anderen heiß. Ich habe auch schon zwei Liter kochendheißen Tee inhalliert, die Kaffeemaschine auf Dauerbetrieb eingestellt und die Heizung hochgedreht. Allein es bessert sich nichts. Ich sitze hier, ich zittere und schlottere und versuche mich nun mit Euch warm zu schreiben.
Jetzt krieg ich auch noch Hals, so ein Mist! Ich werd bestimmt krank …
Und das wird erst mal schlecht für die Volkswirtschaft!
Frohen Klimafreitag, Leute!

Vor vierzehn Tagen hatte ich in Ihnen ja das Bedürfnis erweckt, zu erfahren, was auf dem Gedenkstein gemeißelt steht, der mir im Schuppen abhandenkam. Kurz zur Erinnerung: Es dreht sich um ein Monument, das an die Opfer des Orkans aus dem Winter 2018 erinnert. Ich habe den Gedenkstein von Spinnenweben und Staub befreit, die Buchstaben mit einer frischen Schicht Blattgold aufpoliert – doch lesen Sie selbst!
Sie erinnern sich bestimmt alle noch an Friedericke. Das war die blöde Kuh, die hier letzten Winter mit beiden Backen voll Druckluft durchgeblasen ist. Nachdem ich damals blauäugig festgestellt hatte, dass innerhalb meines Gartenzaunes alles in Ordnung war – drangen nach und nach immer mehr Schäden aus der Umwelt in meine heile Bewusstseinswelt. Von einem Baum nach dem anderen erfuhr ich, dass er – Gott hab ihn selig – das Zeitliche gesegnet hatte. Es konnten einem die Tränen kommen, ich liebe Bäume.
Was mich persönlich am betroffensten machte, war aber nicht irgend ein Baum, sondern der meiner Aussicht vom Schreibtisch aus: Eine stolze Blautanne, ein Leuchtturm von einem Baum und bevölkert mit einer ganzen Stadt voller Viecher: Elstern balgten sich lauthals mit Krähen, Eichhörnchen sausten den Stamm rauf und runter und machten mit ihren Puschelschwänzen Großreine und Amseln ließen sich im Wipfel zum Jodeln nieder. Am Abend, aber auch wenn der Morgen graute, also mitten in der Nacht. Überhaupt hüpften und flatterten sämtliche Singvögel, die die heimische Faune zu bieten hat, im Baum herum und zwitscherten. Jedes Jahr wuchsen in etlichen Nestern mehrere Sorten Vöglein heran und auch sonstiges Flattergetier, angefangen bei Schmetterlingen, über Bienen und Käfern, war da zu Hause. Ich hatte ein ganzes fröhlich ausgelassenes Dorf vorm Fenster.
Nun hatte die dumme Sturmnuss Rike die Tanne aber nicht tatsächlich gefällt, sondern nur kräftig aus den Schuhen gehoben. Dem Baum hat das nicht gefallen und er stand danach schräg. Noch eine richtig heftige Böe hätte gereicht und er wäre zu mir herein gekommen. Bei aller Liebe – das wäre nun auch nichts gewesen.
Die Besitzer der Tanne konsultierten also einen Gärtner; der ordnete sofortige Fällung an. Aus ‚Sofort‘ wurden ein paar Wochen, das lag an den Genehmigungen. Eile war aber von bürokratischer Seite trotzdem geboten, denn egal wie wackelig der Riesenweihnachtsbaum nun stand und wie gefährlich er sich zu mir herüber über die Straße beugte: nach offiziellem Start der Vogelbrutsaison ist Fällen verboten. Für die Nicht-Vogelfreunde und die Nicht-Gartenzwerge unter uns: Am 1.März beginnt das gefiederte Eierhocken.
Der Februar-Monatsletzte rückte immer näher und Petrus schaltete Frühlingsstimmung ein. Bestimmt auch damit die Vogeln in Kürze was zum Draufhocken hatten. Menschlein beeinflusst solches grelles Dauergefunzel vom blauen Himmel auch, die einen fühlen sich sexuell stimuliert, die anderen werden wegen dem Frühjahrsputz unruhig. So genau weiß ich das nicht. Ich hatte deswegen an eine Umfrage am Ende des Beitrags gedacht, aber der ist eh schon lang genug.
Mir missfiel nun jedenfalls, dass mein Schlitten nach dem langen Winter so dreckig eingeschweinst vor der Tür stand. Ehe ich ein halbes Vermögen in Spülen-Schäumen-Bürschteln-nochmalSpülen-Trockenföhnen-und-MehrereSchichtenHochglanzwienern investierte, checkte ich meine Wetter-App. Die gab mir grünes Licht: Eine furztrockene Woche Sonnenschein lag vor Mülheim.
Und wo ich mich einmal beim Erlebniswaschen aufhielt, putzte ich den Wagen auch gleich noch von innen und saugte ihn aus. In Summe war ich mehr als eine Stunden beschäftigt, dafür funkelte der Wagen danach aber auch wie frisch vom Band.
Mein Mann war beeindruckt, als ich daheim vorfuhr.
Von meinem Erfolg angespornt beschloss ich, auch gleich noch die Straße und ums Haus herum zu fegen. Das mache ich auch selten, denn das dauert lange. Deswegen checke ich auch vorm Fegen grundsätzlich meine WetterApp: Ist Sturm angekündigt, spare ich mir das, weil da schaut es hinterher aus wie vorher.
Und schließlich, wo ich jetzt einmal so in meinen Putzwahn eingetaucht war und mich so in Übung geschrubbt hatte, cleante ich in der einfallenden Dämmerung auch noch die Fenster. Um die kümmere ich mich noch seltener als um Auto und Straße.
Jetzt hatte ich aber echt genug Aktionismus gezeigt, das reichte fürs nächste Jahr. Erschöpft fiel ich kurz vor Mitternacht in mein Kissen und verbrachte eine tiefe, traumlose Erholungsnacht.
Als ich am nächsten Morgen aufstand und die Rollos hochzog, freute ich mich an meinem blitzenden Hochglanzschlitten, meiner wie geleckt ausschauenden Straße und vor allem an meinen funkelnden, wie nicht vorhanden durchsichtigen Fensterscheiben. Einfach herrlich sauber war alles um mich herum! Ich startete voll bester Laune in den Morgen und nahm mir vor: Künftig mache ich das öfter! (So wie jedes Mal halt)
Beschwingt packte ich meine Tasche und machte mich auf den Weg zu einem kurzen Termin. Als ich den Wagen ausparkte, rückten gegenüber die Gärtner an. Meine gute Laune bekam augenblicklich einen Knacks: Die unschuldige Tanne, Sie wissen schon. Als ich nach einer Weile zurück kam, war der Gefahrenbereich mit Flatterband und Hütchen abgesperrt und sämtliche Vorbereitungen getroffen. Ich wollte bloß schnell ins Haus verschwinden, um die Hinrichtung nicht miterleben zu müssen! Zuerst parkte ich den Wagen wie gewohnt vor der Tür – doch dann überlegte ich es mir anders: Falls was schief liefe, wäre es schade drum. Also fuhr ich ein paar Häuser weiter die Straße rauf, wo eben Platz war.
Die Motorsäge heulte auf und ich versuchte, mir die Ohren zuzuhalten, während ich den Schlüssel im Haustürschloss drehte. Eben noch rechtzeitig schaffte ich es rein, denn als ich gerade die Kaffeemaschine an drückte, krachte es draußen zum ersten Mal. Die Gründaumen-Henker folterten den Baum untenherum und säbelten die starken Äste weg. Für Leute mit zarten Seelen ist das echt Quälerei. Auch die Kaffeemaschine schien das Vorgehen zu entrüsten, denn sie schredderte die Bohnen heute besonders laut. Und sogar das Wetter protestierte: Es schickte starken Wind. Der beutelte Baum und Gartenzwerge und wirbelte die Sägespäne in einem Strudel herum.
So ging das draußen ein paar Stunden. Wütend und böse zerfetzte die Motorsäge das jahrzehntelang friedlich gewachsenen Holz. Nach jedem Teilerfolge krachte es und die Erde bebte. Der benzinbetriebene Folterknecht riss von unten nach oben die Äste ab und köpfte den Stamm dann von der Spitze her stückweise ein. In einem heftigen Proteststurm von allen Seiten wohlgemerkt. .
Gegen Mittag war das Massaker beendet. Meine Tanne war Geschichte und die Folterjungs räumten auf. Sie hatten keinen Schredder dabei, sondern luden die Zweige und die portionierten Stammstücke auf einem Anhänger. Der Sturm schien mithelfen zu wollen, denn er legte an Stärke zu und kehrte den ganzen Schmodder bestehend aus Spänen, Nadeln und abgerissenem Efeu rüber auf mein frischgeputztes Anwesen. Dort blieb das Zeug als Mahnung in sämtlichen Ritzen und Vorsprüngen kleben.
Als schließlich alle Nadelgebeine verladen und der Anhänger abgefahren war, kam einer der Grünen mit einer großen Tonne unterm Arm zurück und einer Schaufel. Aha, dachte ich, der macht jetzt anständig sauber. Ohne Besen? In dem Moment stellte der Typ den Eimer ab und zog einen dieser Hochleistungslaubbläser heraus, so einen, mit dem öffentliche Wege gefegt werden. Der Kerl schaltete das Ding an – da blieb mir vor Schreck fast das Herz stehen!
Denn als er das brüllende Gerät auf die Erde richtete, verschwand er augenblicklich in einer undurchsichtigen Wolke aus Staub und sonstigen seltenen Erden!
Weil der Wind unvermittelt stark aus Süden fauchte, verschluckte die Dreckwolke mein ganzes frischgeputztes Haus gleich mit!
Mein Puls raste, mir schwoll der Kamm!
Was macht man da?
Man atmet tief in den Bauch, meditieren nennt sich das.
Als der Kerl endlich fertig war und der Wind mir den Rest von dem Mist gegen die Fenster gekotzt hatte, konnte man kaum noch rausgucken. Sie waren jetzt noch dreckiger als gestern. Ein Glück, dass ich wenigstens den Wagen weggestellt hatte.
Kurz darauf musste ich zum nächsten Termin. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten es ruhig noch ein paar mehr sein können, denn ich wollte nicht zurück nach Hause. Irgendwann rollte ich wieder daheim ein. Der Wind war immer noch sauer, ich konnte ihn verstehen, mir passte die neue baumfreie Aussicht auch nicht. Ich parkte also genau gegenüber meiner ehemals geliebten Tanne, öffnete die Autotür – da muss der Wind sich die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen haben haben, denn er kriegte jetzt einen richtigen Anfall! Ich war gerade ausgestiegen, die Tür stand sperrangelweit offen: Da wirbelte eine dermaßene Böe, die strudelte so viele Sägespäne mit sich, wie vorhin der Grüne mit dem Blasinstrument. Geistesgegenwärtig schmiss ich zwar die Tür zu – doch es war zu spät. Mein schwarzes stäubchenfreies Hochglanzschiff sah innerlich aus, als beherberge es eine mit Aufträgen zugeschissene Schreinerei. Sämtliche Oberflächen, alle schwarzen Teppichauslegungen mit Sägespänen paniert. Haben Sie schon mal Sägespäne aus Kurzfloor gepult? Ich befürchtete echt, ich würde gleich durchdrehen!
Stocksauer sprang ich erneut auf den Fahrersitz, drückte wutentbrannt auf Zündung und katapultierte das Gespann wieder die paar Häuser weiter nach oben in Sicherheit. Das lohnte sich, weil außenherum ging es noch.
Nach der Aktion beruhigte sich der Wind und zog weiter, sicher um woanders für Stimmung zu sorgen. Ich hingegen besah mir das Übel ums straßenseitige Anwesen. Und weil wieder die Sonne schien und ich, wenn ich ärgerlich bin, sowieso nichts Gescheites aufs Papier bringe, begann wieder zu putzen. Erst die Straße und die Einfahrt, dann ums Haus herum und zum Schluss, in der hereinbrechenden Dunkelheit: die Fenster. Meine Laune hatte sich zusehends gebessert und ich beschloss, den Tag zu streichen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
So, liebe Leute, eigentlich ist die Geschichte jetzt zu Ende. Gibt nichts mehr zu erzählen. Denkt Ihr doch auch, oder?
Von wegen!
Am nächsten Morgen saß ich schon eine Weile am Schreibtisch, da rückten draußen irgendwelche Bauarbeiter an. Es hörte sich an, als würde ein Gerüst aufgebaut werden. Nun ist es aber so, dass ich zum Einen nicht neugierig bin und zum Anderen seit gestern eh nicht gerne aus dem Fenster schaue, weil mich alles zu sehr an meinen Freund, den Baum, erinnert. Ich ignorierte also den Lärm – Was sollte schon sein? – und arbeitete weiter. Auch als es draußen rumpelte, dachte ich nicht darüber nach. Beim Gerüstaufbau fällt schon mal was runter. Ich tippte weiter in meine Tastatur, draußen klapperte es weiter. Doch irgendwann glaubte ich plötzlich, eine Handsäge zu hören. Das alarmierte mich! Ich sprang auf und guckte aus dem Fenster: Da waren meine neuen Freunde, die Gärtner, wieder da und stutzten gegenüber einen anderen Baum ein! Der Wind hatte sich auch wieder dazugesellt – und mein vorgestern frischgewienerter Schlitten war nun endlich außenherum mit Sägespänen paniert wie ein Wiener Schnitzel.
Verdammt noch mal!
So, aber jetzt kommt es!
Die Gartenzwerge beendeten ihre Pflegearbeiten, verluden alles Grünzeug auf den Anhänger und fuhren ab – doch nach fünf Metern hielt die Gärtnerkutsche plötzlich wieder an. Die Beifahrertür öffnete sich: Der Kerl und die Tonne stiegen aus. Nicht schon wieder! Ich konnte mich nicht mehr rühren. In Slow-Motion verfolgte ich, wie der Typ den Hochleistungsbläser herauszog. In dem Moment, und noch ehe er den Einschalter drückte, setzte setzte bei mir das Herz aus.
Als ich wieder zu mir kam, waren meine Fensterscheiben ziemlich undurchsichtig. Und das Auto stand jetzt inkognito unterm Fenster: Mausgrau mit blonden Sägespan-Pocken.
Das eine sage ich Euch: Sollte sich noch einer unterstehen, hier in nächster Zeit mit der Motorsäge anzurücken: Den erschieße ich auf der Stelle!

Hi Leute!
Erinnert Ihr Euch alle noch an Friedericke, den verdammten Sturm, der uns letzten Winter heimsuchte? Am 19. Januar 2018 war es, als die dumme Nuss sich auf unsere Umwelt stürzte und Kahlschlag versuchte.
Jetzt hatte ich Euch damals ja meine Erlebnisse geschildertund Ihr erinnert Euch sicher: Ich war gut davongekommen. Lediglich bis in meinem Schlafzimmer war es der Tusse gelungen, vorzudringen.
Im Nachhinein hat sich dann aber herausgestellt, dass die hier oben von unserem Berg doch nicht so schadlos abgelassen hat, wie zuerst gedacht. Die wunderschöne, riesengroße Fichte vor meinem Fenster, der direkte Blick von meinem Schreibtisch, der Schattenspender für mein Haus – vor allem aber der Lebensraum von zig Eichhörnchen, Krähen, Elstern, Amseln und sonstigem Flatter-, Krabbel- und Kleinviehzeug, das die heimisch Fauna zu bieten hat, hatte einen weggekriegt.
Wenn so ein Riesenbaum nach Sturmangriff nicht mehr standfest wurzelt und halbschräg in den Himmel ragt … – na, Ihr könnt euch das ja denken.
Das weitere Geschehene hat mich jedenfalls ganz schön mitgenommen und ich habe es in einen Gedenkstein gemeißelt. Wie das jetzt genau passieren konnte, dass der mir dann entfallen ist, weiß ich heute auch nicht mehr – aber wenigstens habe ich ihn nicht auf den Fuß gekriegt.
Nun ist der mehrseitige Grabstein dank eines glücklichen Umstands – ich habe nämlich aufgeräumt – wieder aufgetaucht! Ihn wegen mangelnder Aktualität irgendwo im Schuppen vergammeln zu lassen, bringe ich nicht übers Herz. Schon allein der treuen Fichte wegen!
Wie schaut es denn aus, Leute? Wollt Ihr wissen, was drauf steht?

Mein Freund der Baum

Kennen Sie das, dass Sie während Ihrer Alltagsroutine dermaßen in Gedanken versumpfen, dass sie wie weggetreten sind?
So was ist mir gestern passiert, beim wöchentlichen Großeinkauf.
Trotz gedanklicher Abwesenheit befüllte ich meinen Einkaufswagen mit den üblichen VerzehrBasics – ich mache das seit zig Jahren, ich kann das im Schlaf. Bananen, Gurke, Milch, Joghurts … Wie ich noch beim Käse herumsuchte, fiel mir plötzlich ein, dass Geflügel am Wochenende in der Schule übernachten würde und mir sausten Salzstangen durch den Kopf. Was zum Knabbern und trotzdem keinen Karies-Schock über Nacht – ich war stolz auf meine Idee!
Also machte machte ich mit meinem Wagen auf dem Absatz kehrt und suchte zielsicher die Knabbereien am anderen Ende des Ladens auf, wenngleich solches Mäandern auch uneffektiv ist, Unterwegs tauchte ich anscheinend wieder mariannengrabentief weg, denn hier fehlt mir jetzt ein Stück. Erst bei den Eiern wurde ich wieder wach, wohl deshalb, weil man zum Eierkauf Konzentration benötigt: Karton auswählen, öffnen, reingucken: Sind die Eier alle heil?
Wie ich den dritten Pappmascheekarton eben zufrieden im Wagen abstellte, wunderte ich mich, wieso da noch so viel Platz drin war. Kleinstierstreu, Holzpellets, Teewurst – Wollte mich da einer verarschen? Was sollte ich denn damit??
Ich schaute mich um! Es sprang aber niemand wiehernd hinter einem Regal hervor, es haute mir auch keiner auf die Schultern – ergo musste ich den Wagen wohl selbst hier hergekarrt haben.
Aber wo war denn jetzt mein Wagen? Den hatte ich doch nicht zum Spaß befüllt!
Rechtzeitig, bevor ich begann, mir die Haare zu raufen, fiel mir meine unterbrochene Käsesuche ein und ich machte mich mit dem Päckchen Salzstangen und den Eiern auf den Weg. Vorm Käse wartete auch tatsächlich ein randvoller, herrenloser Einkaufswagen. Allerdings war er nicht allein, denn eine aufgebrachte Damen wuselte um ihn herum. Sie guckte hektisch rechts und links, schaute hinter die Butterberge, beugte sich unter die Wursttheke …
Also, mit Verlaub! Ich hatte den Wagen nur geklaut! Kleingeschrumpft hatte ich ihn nicht! Wie, in drei Teufels Namen, soll der sich denn in die Kühltheke gezwängt haben? Jedenfalls schüttelte mich eine dermaßene Kicherattacke, dass ich nach einer Holzpalette Ausschau hielt. Ich musste mich dringend setzen, Frauen kennen das.
Das wäre auch alles unauffällig vonstatten gegangen, wenn die gute Frau ihren Suchradius nicht in meine Richtung ausgedehnt hätte. „Wo ist denn nur mein Wagen …?“, kam sie murmelnd auf mich zu. Sie entdeckte mich, holte tief Luft – gleich würde sie mich ansprechen. Hilfe! Eilig blinkte ich links und bog zur Schokolade ab.
Wissen Sie, der Moment war einfach vorbei, wo ich noch hätte erklären könne, was geschehen war.
Weil die Dame jetzt aber wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gänge flatterte, wurde mir die Sache zu heiß und ich brach meinen Einkauferei auf der Stelle ab. Die Dame war größer als ich, sie war auch deutlich kräftiger – kurz: Ich fürchtete mich. Mir fehlte noch ein Töpfchen Speiseeis; woran es sonst noch mangelte, würde mir daheim schon wieder einfallen. Nix wie raus hier!
Ich wähnte mich schon in Sicherheit, denn als ich mich an der Kasse anstellte, startete die Damen noch zu einem erweiterten Suchflug durch die Backwaren. Leider waren die Wägen der Kunder vor mir ähnlich voll dem meinen und die Kassiererin obendrein recht langsam. Sie war wohl neu.
So kam es, dass sich die Dame – nach dem erfolglosem Abstecher zu den Kaiserbrötchen – hinter mir anstellte.
Ey, augenblicklich sauste mir der Puls in die Höhe!
Abwechselnd durchschossen mich heiße und kalte Schauer.
Hysterisches Kichern wechselte mit frostiger Angstkälte.
Irgendwie war ich mit den Nerven ziemlich runter – wird Zeit, dass Wochenende wird!
Ich vermied tunlichst, den Blick aus meinen Einkaufswagen zu heben und besann mich auf eine verhaltensgestörte Rolle.
Nach einer dreiviertelen Ewigkeit war ich endlich per drei Kreuze auf dem Kassenzettel entlassen und trat an die frische Luft. Geschafft! Mit dem Leben davongekommen!
Ich atmete tief durch und wendete mich zu meinem Fahrrad.
Wie ich so beschwingt unsere Wochenration in meine Radtaschen stapelte und fast versucht war, ein Wanderliedchen zu trällern, sah ich im toten Winkel die voluminöse Damen den Laden verlassen. Mit großen Schritten steuerte sie den Parkplatz an, ein Dreierpack Holzpellets klemmte unter ihrem Arm. Sie schritt mit flatternden Mantelschößen aus, als trüge sie ein Fliegengewicht.
Doch plötzlich stoppte sie ihren Exerzierschritt und marschierte schnurstracks auf mich zu.
Hilfe! Mir setzte fast das Herz aus.
Ich tat, als sähe ich die Dame nicht und packte tiefgebeugt weiter. Eier in die linke Tasche, Zucker rechts rein, man muss das Gewicht gleichmäßig verteilen.
Sie werden es sich denken können: Mein beschäftigter Eindruck half mir nichts. Die Dame baute sich vor mir auf. Völlig zu Recht herrschte sie mich an: „Da brauchen Sie gar nicht so blöd zu grinsen! Wie alt sind Sie eigentlich? Hoffentlich haben Sie keine Kinder!“

Guten Morgen Ihr Lieben,
lasst mich erst einmal herzlich Danke sagen für die vielen großartigen Geburtstagsglückwünsche! Ich habe mich sehr über jeden einzelnen gefreut! ❤
Aber ich weiß, das ist es nicht, was Euch umtreibt! Vielmehr ist es der Kuchen, der mit Fragezeichen demonstriert.
Fraß ihn die Katze – oder wars doch der Fischreiher, der mit den Weihnachtspositionslichtern auch im Dunkeln mitten ins große Fressen fand?
War überhaupt Fischfutter beigemengt?
Oder kamen erneut drei Schimmel angeritten und mischten sich heimlich unter die Möhrchenglasur?
Fragen über Fragen, ich verstehe das. Mir ging es genau so! Weil, soll ich Euch was verraten? In der Hast des Aufbruchs nach Oberhausen hatte ich den Kuchen doch tatsächlich über die Silvesternacht draußen auf dem Gartentisch vergessen! Das ist mir aber erst unterm Friedensengel eingefallen. Da fahr ich nicht extra für heim. Sonst hätte ich vielleicht am Ende noch das Feuerwerk verpasst!
Aber ich habe die besten Nachbarn der Welt, das sage ich Euch! Kein Einziger hat nach hintenraus geknallt. Nicht einer hat seine Rakete in meine Geburtstagtorte gelenkt! Meine Nachbarn sind einfach supertoll!
Kurz nach dem letzten Knall zum neuen Jahr fing es ja dann an zu regnen. Vielleicht war das ganz gut für den Kuchen, denn er wurde richtig schön saftig.
Am Neujahrsmorgen hat mein Geflügel schließlich die finale Schmückung übernommen. Es ist ein Einhornfan, das sieht man deutlich am Zierrat.
Was meint Ihr? Meine Blechbodengeburtstagstorte ist mega gelungen, oder?
Kulinarisch und auch ansonsten schwelgend, weil aus Altersgründen im Urlaub,
Eure Anke GoodWord

Im Prinzip endet mein 2018 nicht ungewöhnlich. Während der Gatte bereits zu seinem Silvestergig nach Oberhausen aufbrach, war ich eilig dabei, meine Geburtstagstorte zu präparieren. Creme aus Sahne und weißer Schokolade schon fertig gemixt, anschließend schälte ich den dreistöckigen Boden von der Stange aus seiner Verpackung – Da trägt der weiße Schimmelpusteln!! 🙀
Wat denn jetzt?? 🙀💩
Ich habe nun also in aller Hast einen braunen Boden gebacken und das Ganze zum Kühlen in den Garten verbracht.
Leute, ich dreh durch, wenn da jetzt noch eine Katze dran geht!
Kommt gut ins neue Jahr, wir lesen uns! 🎆❤️
Krallen weg von meinem Rohling!

Hallo Ihr Lieben,
Seid alle herzlichst aus Mülheim gegrüßt!
Ich bin zur Zeit arg beschäftigt, deswegen vernachlässige ich Euch liebe Bloggercommunity.
Aber heute ist der 1. Advent!
Einen Frohen Euch allen!
Ich trinke jetzt einen Glühwein auf Euch! ❤
Eure Anke Müller-GoodWord

Hi Leute!
Ich bin total besorgt um meine beiden Fische! Lilly und Hektor heißen sie, ich erzählte ja bereits von ihnen. Jeder ist ungefähr so lang und so rund wie ein durchschnittlicher Männerunterschenkel. An den Abmessungen zeigt es sich: Meine beiden Jungs sind fast so alt wie ich. Lasst Euch nicht von Vornamen irritieren, auch Lilly gehört zum starken Geschlecht. Das ist auch ganz einfach erklärt: Nehme wir beispielsweise Andrea und Simone, die würden in Italien schließlich auch keine Röcke tragen. So ist das eben: Andere Teiche, andere Sitten!
Bis hier liest sich doch ganz romantisch, was ist denn nun passiert?
Bis jetzt zum Glück nichts! Aber die Gefahr lauert im Teich! Steht auf zwei Storchenbeine, hat einen grauen Plüschhals und einen scheiße spitzen Schnabel! Das alles gehört zu einem hungrigen Fischreiher.
Bis heute Morgen war ich echt zufrieden, dass der neuerdings den halben Tag bei mir im Garten verbringt. Kämpfen wir doch seit Jahren auch medial gegen eine Schwemme von mehreren Tausend Backfischlein pro Jahr, die alle aus ehemals 18 erwachsenen Goldfischen populierten. Die 18 holte der Fischreiher zwar alle im Verlauf des ersten Winters – doch ihre Nachkommen treiben es lustig. Bereits im zarten Alter von 6 Monaten legen die übrigens los.
Ich finde es also okay, wenn der Reiher bei mir zum Essen erscheint. Ich begrüßte das bisher sogar.
Aber letzte Woche erzählte ich Euch doch von meiner Fischfutter-Superfood-Idee. Da blieb es nicht aus, dass die Fürsorglichen vom personalisierten Alghorytmus hier, mir andere Fischgeschichten als Werbung einblendeten. Solche wo es ebenfalls um Nahrungsbeschaffung ging.
So, und jetzt haltet Euch fest! Da war ein Bild dabei, das hat mir das Blut in den Adern schockgefrieren lassen! Da stand so ein gefiedertes Reihervieh an einem beschaulichen Bachufer – und hatte mit seinem spitzen Schnabel einen Riesenkarpfen aufgespießt! So wie einen Schaschlik, kurz unterhalb der Kiemen. Mir ist fast das Herz stehengeblieben!
Doch nicht genug mit dem sprechenden Bild, die Bildunterschrift lautete: „Keine halbe Minute später war der riesige Fisch im schlanken Reiherhals verschwunden“!
Leute, was mach ich denn jetzt??
Soll ich mit dem Vieh sprechen?
Oder soll ich besser gleich handgreiflich werden?
Was meint Ihr denn?
Gebt mir mal einen Rat!
Zitternd,
Eure Anke Müller

Ich bin im Moment ein bisschen lädiert. Ich bin nämlich zweimal innerhalb einer Woche die Treppe heruntergefallen. Eigentlich war das erst gar nicht so schlimm, aber lassen Sie mich erzählen!
Los ging es an einem warmen Sonntagmorgen vor zwei Wochen. Mein Pubi kam vom Sport und weil er ein Asket ist, kühlte er sich im Garten unter der Gartendusche ab. Nun ist der Knabe ja nicht der Ordentlichste und mittlerweile fror ihn stark. Er sprintete zum Haus, um dem sicheren Erfrierungstod zu entkommen. In der Hast verlor er, genau vor der Terrassentür, seine Schlappen.
Nun trug es sich zu, dass dann zwei Dinge gleichzeitig passierten: Die Waschmaschine piepte und das Telefon schellte. Meine Mutter war dran. Ich nahm den Hörer also mit in den Keller und quatschte mit meiner Mutter. Ich habe vergessen, um was es ging, aber es muss interessant gewesen sein. Denn wie ich mit dem Wäschekorb im Arm und meiner Mutter ans Ohr geklemmt aus der Terrassentür jonglierte, gewahrte ich erst im allerletzten Moment Pubis Treter. Leider hatte ich bereits abgehoben und war schon ein MicoNanoSekündchen lang schwerelos, als ich noch versuchte, Pubis Hinterlassenschaft mit einem Kick meines linken Fußes auszuweichen. Sie werden es sich denken können: Das misslang. Ich stürzte mitsamt des Korbes, der Wäsche und meiner Mutter über unseren eisernen Fußabtreter.
Himmel, tat mir jetzt die Ferse weh!
Die nächsten drei Tage war‘s mit Fahrradfahren schlecht und überhaupt kam ich schlecht in meine Schuhe. Ich trat nur vorsichtig auf und hoffte, dass der Schmerz bald vorbeigehen würde.
Weil ich aber so vorsichtig hatschte, war ich eben auch ein bisschen ungeschickter. Keine Woche drauf dann Folgendes: Ich hatte einen Termin und stand viel früher auf als an einem gewöhnlichen Wochentag. Es war stockfinster, noch nicht mal ein Vöglein zwitscherte. Ohne Licht zu machen schlich ich durchs Treppenhaus, denn ich wollte die anderen nicht wecken. Als ich aus dem Bad kam, fiel mir mein Handy ein. Das lag vergessen auf dem obersten Treppenabsatz.
Ich schob mich sacht wie eine Katze von meinem Podest aus nach oben und ertaste das Mobilding in der Finsternis auch tatsächlich. Weil das alles ein wenig dauerte und ich auch recht müde war, brachte ich wohl gedanklich die zurückgelegte Strecke durcheinander. Ich war mir sicher, ich hätte nur eine Stufe erklommen. Schwang mich also mit meiner Kommunikationsbeute nach hinten, um wieder auf dem Podest zu landen – und fiel ins Leere.
Ey, Leute, könnt Ihr Euch vorstellen, wie das gepoltert hat? Danach waren die bei mir im Haus jedenfalls alle wach – und die aus dem Nachbarhaus gleich mit.
Ich hab mich knapp bei meinen Mitbewohnern entschuldigt und geknurrt, sie sollen weiterschlafen. Nach einer Weile hörten die Englein auf, mir einen vorzusingen und der Schmerz in meinem Fuß ließ deutlich nach. Es fühlte sich nur noch an, als sei mir die Haut unter der kleinen Zehe aufgerissen. Ging also.
Ich verbrachte drei echt stressige Arbeitstage. Da blieb keine Zeit, mir die Blessur einmal eingehend zu betrachten.
Warum auch? Meine kleine Zehe war dick und blau und überhaupt war das ganze Ding bunt, als sei ich beim Malern versehentlich in den Farbeimer getreten. Blaue Flecken dauern halt, bis sie abreifen.
Nach den drei Tagen schwang ich mich vorvorgestern erst einmal zur Erholung aufs Fahrrad! Meine kleine Zehe muckerte und gegen Ende meiner Runde schmerzte mir der Mittelfuß. Beim Duschen fiel mir auf, dass die Sache ganz schön fett angeschwollen war. Aber ich bin ja kein Weichei. Abtrocknen, anziehen, fertig.
Vorgestern wieder das Gleiche: Ich zog mein Bike aus der Garage. Die Sonne schien gar zu schön und bald pausiere ich wetterbedingt sowieso. Also hurtig die Zeit genutzt!
Dieses Mal schmerzte der Fuß schon bevor ich den Wald erreichte. Und der Mittelfuß kniff bereits heftig kurz vor jedem huckeligen Wegstück.
Duschen, gleiches Spiel: Fett – aber dafür war jetzt die blaue Farbe verschwunden. Erinnerte jetzt in Form und Coleur an eine bayerische Weißwurst. Oder zwei, weil die Ringfingerzehe sah nun auch so aus.
Am Abend erzählte ich meinem Mann davon.
„Bist du denn verrückt?“, regte der sich auf. „Schluss jetzt mit der Fahrradfahrerei! Lass das erst mal ausheilen!“
Ich versprach‘s, doch gestern Nachmittag schien ja wieder die Sonne! Solchem Wetter kann ich einfach nicht widerstehen! Fuß hat scheiße geschmerzt – ich habe die Runde aber trotzdem genossen. Daheim heizte ich fix und unauffällig mit dem Bike in der Garage, damit mein Mann es nicht entdeckte.
Kurz nach mir erreichte mein Mann den Hof. „Na, warst du heute Fahrradfahren?“
„Nein. Du hast es doch verboten.“
„Und was machen dann deine Radschuhe vor der Tür?“
Scheiße, hatte ich Depp die übersehen.
Gerade eben war ich zufällig in der Garage. Ich wollte vom Fischfuttervorrat reinholen, Sie wissen ja, koche ich ja neuerdings zum Mittag. Was musste ich da entdecken?
Meine sämtlichen Fahrräder alle mit einer langen Kette zusammengeschlossen und verschnürt!
Was mache ich denn heute Nachmittag?
Hat einer von Ihnen ein Fahrrad für mich?

.
Doch was sollte ich jetzt mit den nach altem Fisch stinkenen Hupfdingern machen? Sollte ich die etwa einzeln aus den Moosfugen pfriemeln? Alle?
Ich guckte mich unauffällig um und scannte die Hausfassade ab. Es stand niemand am Fenster – und so entschied ich: mich unauffällig zu verdrücken. Das Rollbrett aus Tiernahrung würde schon irgendwie wieder verschwinden.
Kaum war ich mir meiner Ich-hab-nichts-gemacht!-Strategie sicher, raschelte es hinter mir heftig im Gebüsch. Hilfe, nix wie weg hier!
Mit pochendem Herzen sauste ich zurück zum Haus und haute die Terrassentüre hinter mir ins Schloss. Erst dann drehte ich mich um.
Also, Leute, wisst Ihr was?
Da bin ich doch echt vor zwei Igeln abgehauen!
Die beiden ärschelten aufgeregt in meinem Futter-Malheur herum und schmatzten so laut, dass ich das durch die geschlossene Türe hören konnte. Eindeutig, den Jungs schmeckte es. Als sie sich nach einer Stunde wieder trollten, ging ich die Sache überprüfen: Alle Hupfdinger ratzekahl weggefressen!
Ich erzählte meiner Freundin Carmen davon.
„Nicht nur Igel mögen dein Fischfutter“, informierte sie mich. „Meine Hunde fressen das auch gerne. Die drehen total durch, wenn sie es entdecken.“
Nun gehen wir ja im Moment straff auf den Winter zu. Gestern Abend saß ich deshalb mit meinem Mann noch auf einen Absacker im Garten. Ich wollte eine Falsche Glühwein köpfen, aber mein Mann fand das unpassend. Plötzlich raschelte es hinter uns im Gebüsch! Mein Mann horchte auf, doch ich winkte ab: „Das sind bloß die Igel.“
Ich hatte es kaum ausgesprochen, da kamen die zwei Stachellinge auch schon aus dem Efeu herausgewatschelt.
„Bisschen wenig Speck dran …“ Mein Mann betrachtete sie.
Und er hatte wirklich recht, so richtig winterratzrundgefressen waren die nicht!
„Ich hol das Fischfutter!“
Wir kippten den Igelbrüdern also eine Ladung gepresster Fischkadaver aufs Pflaster und verzogen uns ins Haus, damit sie zum Mahl ihre Ruhe hätten.
Doch kaum hatten wir die Tür hinter uns geschlossen, fegten plötzlich drei schwarze Schatten über die Terrasse. In der Dämmerung vermutete ich zuerst, das seien Fledermäuse – doch dann kamen die Blitze unvermittelt überm Fischfutter zum Stehen. Die Igel gaben augenblicklich Fersengeld und drei Katzen materialisierten sich. Zwei schwarze und eine graue. Die Gebeamten stürzten sich sofort und wie die Verrückten auf das Fischfutter. Gut, dass die Igel abgehauen waren, sonst hätten die Bartputzer die bestimmt gleich mitgefressen!
Fassen wir den Sachverhalt nun zusammen:
– Fische lieben Fischfutter
– Igel schlagen sich glücklich den Wanst damit voll
– Katzen überfressen sich daran
– Hunde drehen durch und vergessen die gute Erziehung, wenn Fischfutter aufgerufen wird
Bei Fischfutter muss es sich wirklich um eine Delikatesse handeln!
Ich glaub, ich probier das morgen auch mal …

Not only for fish: Superfood entdeckt!

Letzte Woche war es doch saumäßig kalt. Können Sie sich erinnern? Mir ist da ein Ding passiert – Liebe Leute, ich bin echt blöd! Lassen Sie sich erzählen!
Wissen Sie alle, was Frostbeulen sind?
Wenn die Haut gefrostet wird, entstehen Beulen; wie der Name halt schon sagt. Früher dachte ich immer, Frostbeulen seien so was wie ein Schimpfwort. Genau wie man in meiner Jugend Krätze als abfällige Bemerkung verwendete. Zumindest tat man das da, wo ich herkomme. Ich kannte halt früher keinen, der jemals an einem von beidem krankte. Zeiten ändern sich, gerade stand es in der Presse: In Mülheim aktuell 91 Fälle von Krätze. Aber lassen wir den Strang mal fahren, hier geht es bloß um Frostbeulen!
Ausgerechnet in diesem Winter habe ich mir den Mist nämlich gleich zweimal zugezogen! Könnt Ihr Euch noch an den Schneesturm eines Sonntags im letzten Dezember erinnern? Nach nur zwei Stunden fanden wir uns in Mülheim unvermittelt in einem hochverschneiten Wintermärchen wieder. In den Alpen schneit es einen Dreck dagegen!
Nun wohne ich lange genug hier in unserem beschaulichen Kohlenpott, um zu wissen: Sobald Schnee fällt: Nix wie sofort raus in die weiße Pracht! Wenn man bis nach dem Mittagessen wartet, ist die eh schon wieder weggetaut.
So auch an jenem Sonntag: Kurz nach zehn, mitten im fettesten Schneetreiben, machte ich mich mit meinen Mannen auf den Weg in den Wald: Der Schlittenberg war unser Ziel. Normalerweise hätten wir das Auto genommen, denn man stapft bei hohem Schnee schon um die 25 Minuten dort hin, doch die Pferdekutsche war so hoch zugeschneit: Mein Mann hätte sie erst freischaufeln müssen. Den anderen Wagen hätte er auch nur mit Mühe aus seinem behüteten Kellerstellplatz bekommen – gingen wir also zu Fuß. Das war auch besser fürs Klima.
Sie lesen es: So weit war der Ausflug durchdacht!
Jetzt hatten wir aber, wie schon erwähnt, etliche Jahre im Pott keinen Schnee gehabt – die drei kurzen Federschäuerchen zähle ich nicht mit – und außerdem kam das viele schöne Schneeweiß ja unangekündigt bei uns an. Will sagen: Hätte ich mehr Zeit gehabt, mich auf Mülheimer Schneeverwehungen und Wintermärchen einzustellen, hätte ich vermutlich am Morgen nicht meine beige Sommerhose angezogen, sondern was Dickeres von weiter hinten aus im Schrank gewählt. Hatte ich aber nicht.
Wir fuhren also ein paar Runden Schlitten. Indes zog es mir immer frischer um die Beine herum. Nach vielleicht vier Abfahrten sagte ich deswegen zu meinen Leuten: „Jungs und Mädel, die Mutter wandert schon mal heimwärts, die friert.“
Mein Mann schien sich auch zu dünn eingekleidet zu haben, denn er schloss sich mir erfreut an. Außerdem dürstete ihn nach einem Kaffee, schließlich war ja Wochenende. Couch flätzen, Füße hochlegen, dampfender Kaffee, ganz frischer Kuchen und ein Loch ins Kaminfeuer stieren: Sie kennen das.
Wir Alten machten uns also auf den Heimweg. Nachdem wir den Wald verlassen hatten, kämpften wir uns schutzlos durch den Schneesturm. Der tobte von vorn und fatschte mir im Senkrechtflug kiloweise Neuschnee gegen meine Sommerhose. Die Flocken waren riesengroß und entsprechend nass, und wir wissen alle vom Phsyikunterricht aus der Schule und vom Strandurlaub, wie sich das mit nasser Körperoberflache bei Wind verhält: Man friert. Bei Sturm friert man entsprechend heftiger und wenn es noch dazu eh schon saukalt ist: Schockgefriert man quasi wie Petersilie. Wäre ich jünger gewesen und nicht so abgeklärt: Ich hätte laut gejammert!
Nachdem ich also unterwegs halb verstarb, erreichten wir irgendwann mit letzter Kraft unsere Hütte. Drinnen war es mollig warm und schön trocken. Ich wollte mich eben steifgefroren und erleichtert meiner nassen Kleidung entledigen, als meine Oberschenkel mit einem Mal fürchtlich anfingen zu jucken. Sie juckten und sie brannten, sie waren feuerrot und glühten – es fühlte sich an, als wäre ich in einen Ameisenhaufen gefallen. Ich kratzte und kratzte und konnte mehr als eine Stunde lang gar nicht mehr damit aufhören. Irgendwann wurde es besser.
Den Rest des Sonntags verbrachte ich eingerollt in einer Decke auf dem Sofa. Sie brauchen nicht mit mir zu schimpfen, ich weiß es selber: Beim nächsten Mal ziehe ich mehr an!
Am Montagabend erzählte mir mein Mann eine Geschichte, die mich emotional so mitnahm, dass ich mich erst einmal hinsetzte und meinen Kopf in die Hände schloss. Wie ich dazu eben meine Ellbogen auf die Oberschenkel aufstützte, durchfuhr mich in beiden ein heftiger Schmerz. Aua! Wat war dat denn??
Ich zog meine Bux herunter um nachzuschauen – da waren meine beiden Oberschenkel blitzblau und heftig angegeschwollen! Ich sah an den Beinen aus, als hätte ich mit meinem Mann eine Meinungsverschiedenheit ausgetragen und dabei den Kürzeren gezogen. Oder als wäre ich, ungeschickt wie ich bin, mit meinem Pubertikel beim Boxtraining gewesen. Den zweiten Vergleich erwähne ich nur, nicht dass noch einer meint, mir ginge es daheim schlecht.
„Schau dir das an!!“, sagte ich entsetzt zu meinem Mann. „Was sind das für dunkelblaue Dinger??“
Mein Mann war auch erschrocken. „Ich glaube, das sind Frostbeulen.“ Zur Sicherheit guckte er aber noch mal im Internet nach: tatsächlich. Die dicken Veilchen würden ungefähr vier Wochen bleiben, las er mir vor. Neben den Schmerzen würden sie auch fürchterlich jucken. Man soll auf keinen Fall kratzen! (Dämliche Klugscheißer!)
Irgendwann verschwanden die hässlichen Beulen sang und klanglos, ich hatte sie auch gänzlich wieder vergessen. Bis zum letzten Wochenende. Zu meiner Ehrenrettung sei darauf verwiesen, dass wir hier im Pott nicht nur keinen Schnee kennen – um richtig knackige Kälte steht es bei uns ebenso mager.
Jetzt bin ich ja ein Fahrradfanatiker, ich erzählte es bereits. Mittlerweile schulte ich altersbedingt auf Schönwettersportler um, zumindest wenn es um nasses Gelände geht. Mit meinem Sportrad ohne Schutzblech heize ich nur noch los, wenn die Sonne scheint. Und es wird noch besser: Seit diesem Winter lasse ich es bis zum Frühjahr gleich im Stall stehen und nehme stattdessen das Citybike. Wenn ich mich zu einer Runde aufmache, muss ich dann nicht erst die Kleidung wechseln, denn mit einem Damenrad fährt man nun mal gemütlicher. Außerdem: Ein im Wind flatternder Wollschal auf einem Mountainbike: Das sieht schon scheiße aus.
Aber kommen wir mal zum letzten Wochenende zurück. Mir wäre es ja eigentlich eh zu kalt für einen Ausritt gewesen, doch mein Mann nötigte mich. „Komm, fahr eine Runde mit dem Fahrrad, dann bist du ausgeglichener“, meinte er mütterlich, als ich wohl ein wenig herumgezickt hatte.
Konnte ja nicht schaden, dachte ich mir und machte mich auf den Weg zu meiner ‚Kleine Winterrunde‘. Die geht über knapp 30 Minuten und beinhaltet zwei schöne Steigungen. Kurz überprüfte ich meine Kleidung: Ich trug nach langer Zeit endlich mal wieder meine beige Sommerhose und obenherum zwei Schichten Stoff, die untere aus Baumwolle, die äußere aus Fleece. Obendrauf dann Softshelljacke, Wollschal, Mütze und Handschuhe – bei solch kurzer Strecke ist die Kleidung eh fast egal und ich düste los.
Bissiger Winterwind pfiff mir um die Nase und kniff mir in die Wangen, er riss an meiner Mütze und biss feindselig in meine Ohren – ich trat schneller als gewöhnlich in die Pedale und machte, dass ich wieder nach Hause kam. Das waren verdammt harte 30 Minuten für mich!
Endlich langte ich wieder daheim an. Es dämmerte bereits und ich sauste mit dem Cityesel in die Garage. Ein wenig achtlos band ich ihn fest und stürmte ins Haus. Mollige Wärme begrüßte mich und die Tür krachte hinter mir ins Schloss. Erleichtert entledigte ich mich meiner äußeren Kälteschutzschichten und als ich eben auch die Schuhe auszog, fingen auf einmal meine Knöchel an zu jucken wie Hulle!
Sie juckten und sie brannten, sie waren feuerrot und sie glühten – es fühlte sich an, als wäre ich mitten rein in einen Ameisenhaufen getrampelt. Ich sage Ihnen weiter nichts!
Wie kann eine einzige Frau nur so blöd sein?
Den Rest des Winters bleibe ich jetzt jedenfalls drinnen!

Hallo Leute,
da bin ich wieder! Meine Computerpanne ist nicht behoben, aber es funzt wieder gut genug, um zu arbeiten. Macht es Euch bequem und lasst Euch erzählen, was sich zutrug!
Im Jahre 2017 des Herrn, um es genau zu sagen: am 4. Dezember, in der Mittagszeit, schlief mein Rechner plötzlich ein. Der Cursor blinkte nur noch im Zeitlupentempo und der Text, den ich bis dahin geschwind mithilfe von sechs Fingern eingeklackert hatte, fatschte nicht wie gewohnt das Blatt voll, sondern jeder einzelnen Buchstabe ließ sich für sein Auftauchen anständig Zeit.
Ich schnaubte und ging erst einmal aufs Klo.
Als ich nach einer Weile – begleitet von einem Pott voll Kaffee mit verschneiter Weihnachtslandschaft drauf – wieder an meinem Schreibtisch aufkreuzte, hatte es gerade der letzte Satzzeichen-Punkt von vorhin geschafft, sich schnaufend auf den Monitor zu hieven.
Ich kratzte mir den Kopf. Was war da los?
Nach einem Blick auf die Uhr entschied ich, das Mittagessen zuzubereiten. Gegen später Nachmittag, als alle meine Leute abgefüttert, bemeckert und besprochen waren, erinnerte ich mich meines Tagwerks.
Ich setzte mich an den Rechner – da wollte der immer noch nicht! Verflixtundzugenäht! Was hatte die blöde Kiste für ein Problem?
Und auf einmal entdeckte ich das Übel im Maileingang! Da hatte mir so eine Hirni eine riesengroße Mail mit unglaublichen 42 MB geschickt! Der Absender war mir bekannt, also klickte ich drauf und schaute mir die Sache an: Fotos.
Jetzt wäre das ja so weit auch okay gewesen, doch im Text stand, dass ich diese Mail an drei Leute weiterleiten sollte, weil dem Absender die Adressen nicht vorlagen. Ich krauste die Stirn. Zwei von denen führen Webmail, da gibt es normalerweise Volumenbeschränkung. Was macht man da? Kurz überlegte ich, ob ich die Bilder verkleinern sollte und dann erst abschicken. Das verwarf ich jedoch gleich, weil von so was habe ich keine Ahnung und es würde viel Zeit draufgehen, bis ich das erledigt hätte.
Also tat ich das in meinen Augen einzig Richtige: Ich setzte die Empfängeradressen dazu, drückte auf „Weiterleiten“ – und ging einkaufen.
Als ich am Abend zurück kam, war mein Rechner mit dem Verschicken fertig und ich hätte nun endlich losarbeiten können. Doch ich war zu müde. Ob ich faulenze oder nicht – am Abend werd ich müd. Geht Ihnen sicher auch so. Ich beschloss, Feierabend zu machen und am nächsten Morgen Schlag sechs Uhr zu starten.
Nächster Morgen, noch vor dem ersten Hahn, saß ich mit Kaffee am Schreibtisch und hämmerte los. Die Bildermail von gestern hatte ich vergessen, draußen war es finster und ich schrieb in den aufziehenden Morgen. Die Amseln stimmten ein und jodelten mir einen vor, es war echt beschaulich.
Wenn ich so früh loslege, kriege ich auch früh Hunger. Gerade holte ich mir ein paar Wurststullen aus der Küche, als mir der Bing-Ton an meinem Rechner die Ankunft einer Mail verkündete. So was hebt mich erst mal nicht an, die Mail läuft ja nicht weg. Während ich noch mit der Kaffeemaschine hantierte und eines ihrer Bedürfnisse nach dem anderen befriedigte – gerade war ich bei „BOHNEN NACHFÜLLEN!“ – klingelte der Posteingang erneut. Anschließend verlangte die Maschine: „TRESTER LEEREN!“ – das Gematsche aus Kaffeesatz und alter Kaffeebrühe ist immer eine besondere Sauerei. Nach dem Massaker säuberte ich das Spülbecken mit einem Zewa, als der Rechner erneut klingelte. Als ich endlich auf „KAFFEEBEZUG“ drückte, schließlich noch einmal: „Bing!“
Ich gebe zu, ein wenig trieb mich die Klingelei zur Eile, denn ich hatte Pläne für den Tag. Ich wollte mir meine Struktur heute nicht schon wieder von außen durcheinanderbringen lassen!
Stöhnend setzte ich mich also an meinen Arbeitsplatz, klickte die Mails auf – War das ein Scherz??
Der Maileingang voll mit dem hier:
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
Mail delivery failed: returning message to sender
.
.
.
War mein Account gehackt worden?
Breitet sich so was aus?
Was tut man da?
„Bing!“
Während ich geschockt auf mein Postfach starrte, wieder: „Bing!“ Ich schüttelte den Kopf und klickte die erste Mail auf: Eine der Gmail-Adressen der Bildergeschichte von gestern teilte mir darin mit, dass die Mail zu groß sei und deshalb nicht zugestellt werden konnte.
Die Mail darunter war gleichen Inhalts und die noch eins drunter auch. Ich mutmaßte, dass es sich beim gesamten Aufkommen um einunddieselbe Information handelte. Pro Minute erreichten mich zwei dieser Tauben, eine gute Frequenz, damit auch der dümmste Depp schnallte, dass mit seiner Postzustellung was schiefgelaufen war.
Vielleicht war ja auch beim Provider was durcheinandergekommen. Vor einem Jahr gab es da schon einmal ein Problem: Damals war mein Posteingang im zehn Minuten-Takt mit sämtlichen Mails, die ich jemals seit dem Jahr 1999 verschickt hatte, teil- und rückgeflutet worden. Innerhalb von zwei Tagen hatten die das aber in den Griff bekommen, urplötzlich war mein Briefkasten wieder aufgeräumt und sauber sortiert, ohne dass ich etwas dazu beigetragen hatte.
Auf solche Art von Panne hoffte ich auch heute. Zumindest die erste Woche lang.
Addieren wir kurz zusammen, wie es nach dieser Zeit postmäßig bei mir ausschaute:
2 Delivery-failed-Botschaften in der Minute,
macht 120 Stück in der Stunde
und 2.880 Stück am Tag.
In acht Tagen ergibt das die stolze Menge von 23.040 Mails – die ich alle von Hand löschte.
Danach platzte mir allerdings der Kragen. Keine Minute zu früh, denn endlich kam mein Mann von seiner Reise zurück. Weil er auch keine Idee hatte, wie sich der Scheiß abstellen ließ, denn der empörte Briefkasten gab (wohl damit man ihn nicht mundtot machen konnte) keine eindeutige Adresse preis – und weil mein Mann zum Jahresende immer besonders den Kopf voll hat, richtete er einen Filter ein: Der pfiff die faulen Eier ungesehen in den Müll. Leider funktionierte der nur am Rechner, nicht aber am Handy, was auch der Grund ist, warum ich seit Anfang Dezember nur noch halbtags auf Emails reagierte, oder eben gar nicht, weil da ging schon mal was schief.
Dann kamen die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr und mit ihnen jede Menge Ablenkung und Aufregung und irgendwie hatte ich mich danach an den Zustand gewöhnt. Mein Laptop wohl auch – ich leerte nun halt täglich den Papierkorb. Das tut man mit dem Leibhaftigen ja auch so.
Seit letzter Woche Montag habe ich aus Projektgründen aber nun einen anderen Rechner: Riesengroß, selbst wenn ich vier Seiten gleichzeitig auf dem Schirm ziehe, lässt sich alles gut erkennen. Ein Traum!
Allerdings verträgt sich der Neue nicht mit meines Mannes Filter. Ungefähr 20 taube Nüsse schlüpften im Laufe des Dienstags durch die Wall. Am Mittwoch schafften das schon 200 – und in der Nacht kamen weitere 600 dazu.
Am Donnerstagfrüh brach der löcherige Damm dann endgültig entzwei und seitdem flutet die Scheiße ungebremst rein.
Jede Minute zwei Würste, ich dreh bald durch!
Wie es der Teufel will: Seit der Invasion ist mein Mann wieder unterwegs. Auch richtig schön weit weg, er hört mich nicht toben. Zum Glück endet auch die längste Reise irgendwann und so kommt mein Mann heute Abend zurück!
Ich mach ihm jetzt was Feines zu Essen und stöpsel das Telefon aus. Soll sich keiner unterstehen, meinen Mann heute Abend abzulenken! Der hat heute zu tun!
Und wenn der das hinkriegt, dann komm ich auch endlich dazu, vom versprochenen Tatort aus dem Wald zu erzählen! Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur daran denk …
Aber eines weiß ich jetzt schon, egal wie das mit der Technik heute ausgeht: Wenn mich noch mal einer bittet, was weiterzuleiten, wo ich Bauchschmerzen bei hab – das lass ich künftig bleiben!!


Hi Leute, heute ist Donnerstag, wartet Ihr auf eine neue Story? Ich habe ja auch eine schöne. Eine richtig gute, einen Krimi im Wald! Aber es wird nix. Guckt Euch an: Ich habe ein Computerproblem. Das geht zwar schon eine Weile länger, aber nun ist ganz Feierabend. Ich melde mich, wenn das Probem behoben ist. Bleibt mir gewogen, und falls das Netz mich frisst: Behaltet mich im Herzchen! 🙂 In Liebe und immer mit einer Kaffeetasse im Arm, Eure Anke GoodWord 🙂
Hi Leute, heute ist Donnerstag, wartet Ihr auf eine neue Story? Ich habe ja auch eine schöne. Eine richtig Gute, einen Krimi im Wald! Aber es wird nix. Guckt Euch an: Ich habe ein Computerproblem. Das geht zwar schon eine Weile länger, aber nun ist ganz Feierabend. Ich melde mich, wenn das Probem behoben ist. Bleibt mir gewogen, und falls das Netz mich frisst: Behaltet mich im Herzchen! 🙂 In Liebe und immer mit einer Kaffeetasse im Arm, Eure Anke GoodWord 🙂

Haben Sie alle den Sturm letzte Woche leidlich überstanden? Kommen Sie mit den Aufräumarbeiten voran? Ich hoffe, es ist Ihnen nichts Schlimmes passiert und sie haben keinen Schaden an Leib und Leben genommen!
Bei mir ist dieses Mal im Prinzip alles gut gelaufen:
Alle meine Bäume stehen unversehrt aufrecht und sämtliche Dachziegel liegen an ihren angestammten Plätzen. Meinen neuen Schlitten band ich rechtzeitig am Haus fest und die mobilen Außensitzgelegenheiten nebst sämtlicher petroler Sommerbeleuchtung schleppte ich während des lostobenden Orkans in die Garage. Als alles sicher verwahrt dort drinnen stand, ließ sich das Tor nicht mehr schließen: Es blähte voll auf wie ein Segel im Sturm auf dem Meer und hatte sich so verkeilt, dass es klemmte. Während ich noch damit kämpfte, aber kurz vor dem Durchbruch stand, hörte ich durch das Tosen schweres Bersten von Holz und die Erde erzitterte in einem mittleren Erdbeben.
Wohl durch dieses zusätzliche Wackeln gab sich das Tor geschlagen und surrte scheppernd zu, während ich fast so schnell wie Friederike ins Haus stürmte. Die schwere Haustür krachte hinter mir ins Schloss und ich entschied, die Hütte heute nur noch im Notfall zu verlassen. Überschwemmung, Flugzeugabsturz oder ähnliches.
Ich gedachte des armen Baumes, dessen Endes ich eben akustischer Zeuge gewesen war und machte mir erst mal einen Kaffee. Wer weiß, wie lange das noch ginge, wenn erst einmal der Strom ausfiele. Das kennt man ja.
Von den folgenden anderthalb Stunden will ich jetzt mal nicht reden, die verbrachte ich schlotternd mit der Kaffeetasse im Arm an meinem Schreibtisch. Der Orkan prügelte auf das Haus ein, er peitschte die Bäume, würgte sie und versuchte sie zu lynchen – gearbeitet habe ich jedenfalls nichts. Das Haus klagte, es stöhnte, es schwankte – aber es hielt stand und ließ sich nichts abreißen.
Wohl weil Friederike von vorne nichts ausrichten konnte, drehte sie wütend und blökte dann von hinten los. Sie nahm beide Backen voll Druckluft und pustete den Kärcherstrahl mit aller Macht in den Teich. Eine gewaltige Wasserfontäne peitschte auf und fatschte grün auf meine Fenster nach hintenraus. Dem weiteren Verlauf des Schauspiel konnte ich erst nach einer Weile wieder folgen, als das Algenzeug heruntergelaufen war.
Ich hatte nicht geklatscht und so ganz ohne Applaus hatte die Windschickse wohl keinen Bock mehr auf das Spektakel. Brüllend zog sie weiter.
Die Flaute nahm ich zum Anlass, mein Anwesen in Augenschein zu nehmen. Hocherfreut stellt ich dessen Unversehrtheit fest – doch betrübte mich der anschließende Blick ins Umland gewaltig! Der arme Baum von vorhin war einer der Bäume meines Nachbarn gewesen. Ein wunderschöner alter Laubbaum lag quer auf der Wiese.
Wie ich zum Haus zurück ging, entdeckte, ich, dass Friederike beim Nachbarn noch einen weiterer Baum stark eingekürzt hatte. Anklagend ragten pfeilspitze Splitterstellen zum Himmel. Mich dauert so was immer sehr, ich liebe Bäume.
Was erledigt man als Erstes, wenn man ein Unwetter heil überstanden hat?
Man informiert seine Liebsten!
Ich begann mit meiner Mutter, die macht sich immer mehr einen Kopp um mich als mein Mann. Der weiß, dass ich mich sowieso sofort melde, wenn was nicht passt. Schließlich bin ich ihm erst letzten Freitag wieder Schlag sechs Uhr früh mit der Heizung auf den Wecker gefallen. Meine Mutter wohnt mehrere hundert Kilometer weit weg, das ist doppelt nervenaufreibend für sie.
Ich sprudelte also in den Hörer, meine Mutter beruhigte sich auch sofort, was ihr einziges Kind nebst Familie angeht – vielleicht lag das aber auch daran, weil sie mit eigenen Wetterfolgen abgelenkt war: „Der Sturm hat die Terrassentür vom Schlafzimmer reingedrückt! Stell dir das mal vor!“, forderte sie mich entrüstet auf.
„Und jetzt? Pfeift der da jetzt ungehindert rein??“
„Keine Sorge.“ Ich hörte förmlich, wie meine Mutter in den Hörer abwinkte. „Vater hat die Tür wieder eingehängt. Er stand genau dahinter, als sie reinflog.“
Hä?
„Wären wir allerdings nicht da gewesen wären, hätte das mit dem gekippten Fenster mächtig in die Hose gehen können …“
„Du erzählst mir doch hier nicht gerade, dass ihr die Tür immer gekippt lasst, wenn ihr weggeht??“ Meine Eltern wohnen idyllisch: Kleinstadtrand, hintenraus Wiese, Bach und endlos Wald. Genau der richtige Fleck, alles sperrangelweit offen stehen zu lassen. „Seid ihr irre?“
„Nun reg dich mal nicht so auf, dein Vater ist gerade noch mit dem Leben davongekommen! Ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir das große Fenster grundsätzlich offen stehenlassen. Aber das kommt schon mal vor. Man vergisst halt mal was.“
„Hallo! Was gibt‘s denn da zu vergessen?? Es gehört dazu, dass man seine Fenster kontrolliert!“
„Dir passiert so was natürlich nicht!“
Stimmt, hatte sie recht. Mir nicht – für so was hab ich Kinder.
Entsprechend vergnatzt beendeten wir unseren heutigen Informationstransfer per Telefonleitung und verabredeten uns für den nächsten Klatsch zur gewohnten Zeit.
So, jetzt hatte ich ja den ganzen Tag noch nichts Sinnvolles getan. Mit der Arbeit brauchte ich gar nicht erst zu beginnen, war ja schon Nachmittag. Der Wäschekorb blockierte die Treppe zum oberen Stock und so entschied ich, ein wenig Hausarbeit zu betreiben. Ich schulterte den Korb und wie ich forsch mit dem Ellbogen die Tür zum Schlafzimmer aufklinkte, wirbelten mir ein paar Eichenblätter entgegen. Was war denn hier los?
Mit der Hüfte stieß ich gegen die Tür, doch sie schwang nicht wie gewohnt leicht auf – irgendetwas lag drinnen davor. Jetzt reichte es mir aber! Ich stellte den Korb ab, damit ich beide Hände frei hatte. Und dann traf mich fast der Schlag!
Vom Bett und vom Teppichboden war nicht mehr viel zu erkennen!
Alles lag voller Laub!
Alte Herbstblätter, braune Federn von den Lebensbäumen vorm Fenster, spittelige Tannenzapfen und jede Menge Kleindreck von Birken- und Lindensamen. Apropos Fenster! Das stand auf Kipp, verdammte Scheiße!
Das Herbarium hatte meine Wollpullover, die aus Platzgründen auf dem Board statt im Schrank liegen, paniert und zugedeckt. Sie ließen sich nur noch als großer Laubhaufen ausmachen. In meinem Schlafzimmer sah es aus wie beim Modeshooting für die nächste Herbst-/Winterkollektion.
Das konnte einfach nicht wahr sein!
Geschockt trat ich rückwärts in den Flur hinaus und schloss die Tür hinter mir. Draußen lehnte ich mich für einen Moment dagegen, dann schüttelte ich mich und atmete tief ein.
Ich öffnete die Tür wieder: Alles unverändert. Leider!
Das ganze Zimmer glich einem riesengroßen Komposthaufen.
Was macht man da?
Putzt man es – oder sucht man sich eine neue Bleibe?
Unsere Schlafkammer ist klein, theoretisch könnte man sie abschließen und woanders neu anfangen.
Für das Lösen von Problemen ist mein Mann zuständig, also rief ich ihn an.
Bei meinem Mann in der Arbeit herrschte schon helle Aufregung: Ehefrauen informierten gerade ihre diversen Ehemänner telefonisch über Rikes Schäden. „Ach, deine auch!“, vernahm ich im Hintergrund einen Kollegen, als ich eben mit meinem Bericht loslegte.
Mein Mann hörte sich alles ruhig an und als ich mit der Frage endete, was wir nun tun sollten, fragte er mich, ob ich sie noch alle hätte. Nachdem ich das bejahte, mein Mann aber auf meinen Vorschlag mit der neuen Kemenate nicht eingehen wollte, rief ich meine Mutter an. Nicht dass sie bei mir putzt sollte – nein das war nicht der Grund! – aber ich musste ihr ja vom meinem gekippten Fenster erzählen, und mich deswegen bei ihr entschuldigen.
Merkt Euch das einfach, Leute: Mütter haben immer Recht!

Freitags fällt bei uns daheim gerne die Heizung aus. Das ist im Winter ziemlich regelmäßig so – doch was echt schwerwiegend: Es passiert in der Nacht auf den letzten Arbeitstag der Woche.
Zum Glück ist unsere Heizung dann nicht wirklich kaputt, sie erleidet nur einen spontanen Druckabfall. In weniger als einer Minute und ohne ein akustisches Signal abzugeben, entleert sie ihre Blase. Einfach so, zack, uriniert sie das Wasser ins Loch. Sie müssen sich das Loch wie eine dieser kultursensiblen Toiletten vorstellen, nur eben bei uns im Keller zwischen den karrierten Fliesen. Ruckzuck ist die Heizung fertig und guckt dann verklärt. Das hat sich vor ein paar Jahren sanft eingeschlichen – in diesem Winter passiert das ständig.
Unter der Woche bimmelt mein Wecker immer Schlag sechs Uhr – mein Mann steht fast zwei Stunden später auf. Dafür dauert sein Arbeitstag aber auch etliche Stunden länger als meiner. Wenn mein Gatte zurück nach Hause kommt, schlafe ich schon fast wieder.
Vielleicht hat sich die Heizung darum überlegt, sie hilft unserem Zusammensein ein wenig auf die Sprünge und pfeift meinen Gatten nun regelmäßig einmal pro Woche mit den Hühnern aus den Federn. Das mit dem Wassernachfüllen im Heizungskeller gehört nämlich zu seinen Aufgaben. Erschwerend gesellt sich hinzu, dass die Heizung mit schlichtem Wassertrinken nicht mehr zufrieden ist. Neuerdings verlangt sie nach weiterer Zuwendung. Mein Mann drückt dann hier ein paar Knöpfe, bis sie aufhört zu blinken; er dreht da ein wenig an zwei Schräubchen herum, bis sie zufrieden losschnurrt – kurz: Er streichelt sie und spricht mit ihr, bis sie ihren Dienst tut. Die Heizung ist weiblich. Eindeutig.
Warum erzähle ich Ihnen das jetzt? Sicher haben Sie eigene Probleme mit ihren technischen Geräten. Ja, da sehe ich auch ein und das tut mir auch leid – aber mein Mann ist diese Woche unterwegs. Und morgen ist Freitag! Oh Gott, oh Gott, oh Gott …
Schneemann wärmt sich am prasselnden Kaminfeuer

Liebe WeihnachtsLeute!
Ich kümmere mich ab gleich mal ein bisschen ums Fest und lasse das Internet Internet sein.
Guckt Euch an, wie farbenfroh es bei mir daheim noch ausschaut! Sogar mit blauem Himmel. Ich habe also noch eine Menge zu tun, bis mein Anwesen frostig klirrend für die Heilige Nacht hergerüstet ist. Die ist mir nämlich wichtig, mit all ihrem Glöckchengebimmel und den roten SchlittenSchleifchen!
Warum ich mich ablenkungsfrei um meine Zimtsterne kümmern muss, geht schon damit los, dass mein neues Auto ein Stück kürzer ist als mein altes.
Wie beschaffe ich da jetzt bloß den Weihnachtsbaum?
Hat jemand Erfahrung mit in zwei Teilen?
Ich vermute, das duftende Nadelholz daheim in der Stube mithilfe eines Zapfens wieder zusammen zu puzzeln, wird nicht hinreichend stabil funktionieren. Schon allein wegen des schmückenden Gewichts nicht, das da dran baumeln soll: Vögel, Kugeln, Sterne, Zwerge, Äpfel, Kerzen – ich habe bestimmt noch was vergessen.
Mit meiner Sorge liege ich doch richtig, oder?
Aufgrund meines Dilemmas schlug ich meiner Sippe vor, wir könnten uns, statt eines zersägten Legobaumes, auch gleich einen Künstlichen zulegen. Schon allein wegen der Nachhaltigkeit! Doch meine Leute wollen das nicht. Sie wollen einen richtigen Baum! Weihnachten sei schließlich nur einmal im Jahr. Ja, so funktioniert dann halt Demokratie: Drei gegen Einen – und am Ende wird gemacht, was die Mutti sagt.
Trotzdem fordert mich das. Entweder muss ich es aussitzen – oder ich muss viel darüber labern. Leider lässt meine Aura meine Kontrahenten nicht verstummen. Aber ich bin ja noch jung, ich reife also noch. In ein paar Jahren werde ich nur noch die Augenbrauen anheben und werde Nicken ernten.
Leute, für diesen Lernprozess brauche ich aber die ganze Frau. Deswegen, und wegen der Gründe oben, sage ich:
Bis demnächst, ihr lieben Hochverehrten!
Ich freue mich aufs Fest – Merry Christmas Euch allen!

Wie verhält sich das denn bei Ihnen, besitzen Sie einen Adventskalender?
Ich habe einen. Natürlich. Mein Mann auch und die Kinder sowieso. Unsere vier Adventskalender hängen an der Wand an ihren angestammten Plätzen. Für das Befüllen des traditionellen Vorfreudenzierrats sind unsere Kinder zuständig, ich kaufe lediglich die Schleckereien dafür ein. So läuft das bei uns jahrein jahraus, man kennt so was auch aus der frühkindlichen Pädagogik: Ruhe, Rhythmus, Rituale
Gestern Nachmittag kam Geflügels bester Kumpel zu Besuch. Er schien ein paar Tage nicht hier gewesen zu sein, denn nachdem er den üblichen Kontrollflug durch die Bude absolviert hatte, baute er sich vor meinem Schreibtisch auf: „Sag mal, Anke, wieso habt ihr denn dieselben Adventskalender wie letztes Jahr hingehängt??“
Hatte da wer mit mir gesprochen? Ich schaute von meiner Tastatur auf. Dann kratzte ich mir den Kopf und tauchte langsam auf. Schließlich fragte ich: „… Hä?“
„Na, die Adventskalender! Die hingen doch schon letztes Weihnachten hier!“
Geflügel verstand die Frage auch nicht: „Im Sommer haben wir die natürlich abgenommen. Auch wenn die meinetwegen das ganze Jahr über hängenbleiben könnten. Das schaut mit denen so gemütlich aus.“
Der Kumpel entrüstete sich: „Wie könnt ihr denn so langweilig sein?? Wir basteln uns jedes Jahr einen neuen Adventskalender! Einen riesengroßen! Meine Schwester, meine Mutter und ich, wir besorgen Papier und dann schnippeln und kleben und basteln und verzieren wir so lange, bis wir ein Dorf beisammen haben!“
Jetzt wo er das sagte, erinnerte ich mich, dass ich bei der Kumpelfamilie in der Adventszeit immer ein ganzes Sideboard voll Papphäuschen stehen sehe. Ich dachte allerdings, das sei jedes Jahr dasselbe. Bastelten die das Kaff etwa jeden Advent neu??
Innerlich war ich geschockt: Enthielt ich meinem Töchterchen eine wichtige gemeinsame ElternKind-Zeit vor? Würde sie mir das später übelnehmen? Sehr?
Ehe ich mich weiter ins schlechte Gewissen reinsteigern konnte, beschloss ich, die Sache auf eine analytisch-emotionslose Ebene zu hieven: „Da wüsste ich gar nicht, wo wir so eine Landschaft hinstellen sollten. Über so viel freie Ablageflächen verfügen wir gar nicht.
Der Kleine schaute sich um: „Stimmt. Auf den Esstisch könnt ihr die nicht stellen. Da müsstet ihr im Stehen essen …“
„Auf dem Küchentresen ist auch kein Platz, da klettere ich immer drauf rum“, informierte uns Geflügel.
„Dann eben nicht.“ Der Kleine zuckte die Schultern, schnappte Geflügel an der Hand und saust mit ihm durchs Treppenhaus nach oben in den Hühnerstall. Über mir polterte es, als würden die wilden Horden durchziehen: also alles wie immer.
Gerade wollte ich mich erleichtert an meine Arbeit rückwenden, als die kreischende Bagage erneut angeflattert kam. „WIR WISSEN WOHIN MIT DEM DORF!“, brüllten sie schon auf der Treppe. „Steh mal auf!“, forderte mich Geflügel auf.
Damit ich mich ein bisschen schneller drehte, zog mir der Kumpel den Bürostuhl unterm Hintern weg. Dann klappte Geflügel meinen Laptop zu und riss ihn schwungvoll vom Schreibtisch. „Hier!“ Beide Kinder zeigten freudig auf meinen eben freigewordenen Arbeitsplatz.
Noch ehe ich mich entrüsten konnte, gab Geflügel mir Bescheid: „Ich mag das eh nicht, wenn du so viel arbeitest!“
Der Kumpel pfiff zwei Bögen Bastelkarton auf die freie Fläche. Einen orangefarbenen und einen in Schweinchenrosa: „Lasst uns keine Zeit verlieren! Sonst wird der Adventskalender erst nach Weihnachten fertig!“
„Was sind das eigentlich für bescheuerte Farben …?“ Ich musste mich erst mal sammeln.
„Was anderes haben wir nicht gefunden. Du musst deiner Tochter mal gescheites Bastelmaterial kaufen! Aber meine Mutter sagt immer: Der Wille zählt!“

Als mündige Bürgerin informiere ich mich mal weniger und mal mehr was weltpolitisch ansteht – bei den lokalen Geschehnissen bin ich dafür aber top im Bilde.
So kam es, dass mir letztens nicht entging, dass vor meiner Haustür zwei Diebe geschnappt wurden, die sechs ergaunerte Fahrräder in ihren weißen Transporter mit ausländischem Kennzeichen luden.
Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Polizei alarmiert, als das Duo auf einem Parkplatz mit dem Diebesgut hantierte.
Laut Redaktionsmeldung verfügten die beiden jungen Herren über keinen festen Wohnsitz; sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß entlassen.
Ich hoffe mal, den Herren war der Schreck mit der anrauschenden Polizei und den Fingerabdrücken lehrreich, sie sind jetzt geläutert, und dass das nicht noch einmal vorkommt!
Darauf kann man sich aber nicht verlassen, und außerdem weiß man ja auch nichts über deren Familienverhältnisse: Vielleicht haben sie Cousins oder Schwager, die noch nicht erwischt wurden und deshalb noch fröhlich durch die Gegend klauen. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin besorgt um meine Fahrräder!
Als Bike-Fanatikerin besitze ich mehrere, für jeden Anlass das passende Zweirad. Stock-und Steinfahrten im Gelände, Hochgeschwindigkeitsrasen auf der Chausee oder gemächlich in der Stadt herumjuchteln: das mache ich nicht mit ein und demselben Fahrrad. Das verhält sich bei mir wie bei Frauen mit Schuhen – Schuhe besitze ich dafür weniger.
Weil mein sorgsam zusammengestellter Fuhrpark während meiner Radkarriere von Langfingern schon um insgesamt 3,5 Fahrräder erleichtert wurde – beschloss ich, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen!
Gestern Nachmittag kam ich in der Dämmerung von einem Termin nach Hause. Ich war mit dem Rad unterwegs, schon allein wegen der Einbahnstraßen-, Baustellen- und Parksituation in der Mülheimer City. Mir blieb eine Dreiviertelstunde, bis ich wieder los musste, Geflügel bei einer Freundin abholen. Das Kleine war auch mit dem Fahrrad gefahren und im Dunklen lasse ich es nicht allein heimradeln.
In der Garage wollte ich mein Pferd für den Moment nicht unterbringen – normalerweise hätte ich es einfach in unserer Einfahrt stehengelassen. Aber der Zeitungsartikel ….
Zum ersten Mal, seit ich hier wohne, schloss ich also mein Fahrrad auf meinem eigenen Grundstück ab. Ich war stolz auf mich, ich hatte mich den Umständen angepasst und nicht wie gewöhnlich die empfohlene Trotzhaltung: Jetzt erst recht! eingenommen.
Als die Zeit ran war, war es draußen stockfinster. Beschwingt stürmte ich in die Nacht – doch ich erspähte die Hand vor Augen nicht mehr. Nun kenne ich mich daheim ja aus und so hangelte ich mich blind an den Mülltonnen entlang bis in die Ecke, in der ich mein Citybike vorhin gelassen hatte. Schien auch alles vollständig und ich tastete nach dem Schloss. Soweit klappte das – doch dann kriegte ich den winzigen Schlüssel nicht in das Miniloch gefummelt. Ich griff in meine Gesäßtasche – Mist! Handy im Haus vergessen, also nix mit Funzeln.
Ich knurrte, denn ich setze mich grundsätzlich erst kurz vor knapp in Bewegung. Mein Motto lautet: Das Leben ist zu kurz, um zu warten! Das half mir im Moment nicht weiter, ich musste ins Haus zurück und mir eine Lichtquelle besorgen.
Eilig griff ich in meine Jackentasche – doch da war kein Schlüssel! Der lag auch im Haus, auf der Treppe, verdammte Scheiße!
Die Situation war jetzt so ähnlich, als wäre mir das Bike tatsächlich geklaut worden. Ich schellte an der Haustür Sturm, indessen mein Pubi drinnen mit Kopfhörern Musik hörte. Der war sozusagen taub. Wie ich gerade überlegte, was jetzt zu tun sei – ich tendierte dazu, mich mittig auf die Straße zu stellen und: FEUER!, zu rufen, bog mein Mann in die Einfahrt. Gott sei Dank, ich würde wenigstens nicht erfrieren.
Ich schickte ihn dann auch gleich weiter, das Töchterchen abzuholen. Ist eh sicherer, wenn er das macht!

In Vorfreude auf den nächsten Sommer will ich Ihnen heute mal einen vom Teich erzählen.
So ein Gewässer ist nämlich eine tolle Sache! Besonders viel wert ist es, wenn sich das gleich an die Terrasse anschließt. Mal stürzt ein Gast direkt von der Kaffeetafel aus rein, ein andermal pfeift der Wind den Wäscheständer hinterher; die Goldfische hecken wie die Karnickel und eine eigene Mückenzucht bekommt man gratis obendrein.
Klingt abträglich?
Ganz im Gegenteil! Ich sehe da ausschließlich Vorteile!
So man ein Wasserspiel installiert hat, murmelt und plätschert es beschaulich; für schlechte Zeiten tummelt sich Fisch, der nur darauf wartet, geschlachtet zu werden; und mit Frischwasser bevorratet ist man außerdem.
Ich denke dabei an die 14Tage alten Hamster, die der Bundesregierung gehören. Weil von denen echt lange keiner mehr gesprochen hat, will ich die an der Stelle mal wieder erwähnen. Sollen ja nicht in Vergessenheit geraten!
Von der Fresserei ab, lässt sich am Ufer auch prima chillen.
Nach Feierabend und am Wochenend stiere ich regelmäßig ein Loch ins Algenwasser. Gucken ins Grüne erholt nämlich die Augen! Man braucht dann lange keine Brille. Alternativ reicht es aber auch, wenn man viele Möhren isst.
Um augenschonend auch ganz sicher zu gehen, stehen um unseren leuchtend grünen Teich herum hohe Bäume. Laubbäume wohlgemerkt. Sie ahnen, woher jetzt die Brücke zum Teich kommt?
Herbstlaub! Würden wir die Klassiker der heimische Flora ungehindert ins Wasser abhaaren lassen, wäre im nächsten Frühjahr Essig mit unserer plätschernden Teichfreude. Stattdessen würde ein großer Komposthaufen an unserer Terrasse grenzen. Das sieht nicht nur unschön aus, das stinkt auch.
Als junge Teichbesiter (mit dem menschlichen Alter hat das übrigens nichts zu tun) erlebten wir das nämlich schon einmal. Deshalb spannt mein Mann nun Alle-Herbste-wieder ein großes Fangnetz quer über den Teich. Ursprünglich sollte das den Fischreiher vom Fressen unserer Haustiere abhalten – weil dem das Hindernis aber egal war und er einfach pfeilschnell drunter herrannte, wenn er Hunger hatte, lauben heute nur noch die Bäume drauf ab. Die alten Blatthaare hängen dann den ganzen Winter über wie eine wärmende Mütze dicht über dem Wasser. Den Fischen gefällt das auch, denn seitdem friert der Teich nur noch im extrem kalten Winter zu.
Letzten Sonntag fiel meinem Mann beim Frühstück ein: „Mensch, wir haben ja Herbst …“
Pubi kippte sich gerade eine Schüssel voll Müsli: „Das weiß ich schon seit den Herbstferien. Die nennt man nicht umsonst so.“
Mir war die Jahreszeit egal, ich hatte einen Termin. Ich packte meine Sachen und überließ meine Blitzmerker sich selber.
Als ich am Nachmittag zurückkam, schwebte die IsolierMütze über dem Teich. Als hätten die Bäume nur darauf gewartet, endlich ihre Blätter abschmeißen zu dürfen, war von der Netzstruktur schon kaum mehr was zu erkennen: Eine dicke gelbe Matte Biomasse lag darauf.
Arm in Arm am Fenster betrachteten mein Mann und ich sein Werk. Zufriedenheit durchströmte uns, denn das Netz ist das letzte, was wir in jedem Gartenjahr tun. Danach halten wir es mit den Bauern und schlafen bis zum Frühjahr.
Plötzlich sagte mein Mann: „Scheiße!“
„Was ist los?“ Ob der Kombination der beschaulichen Herbstromantik mit der FäkalVokabel war ich irritiert.
„Das Gebüsch am Ufer steht noch. Hat irgendwie keiner zurückgeschnitten …“ Er sah mich strafend an.
So ein Mist, jetzt sah ich das auch. An der Wasserkante wucherte noch die undruchdringliche, grüne Wand des Sommers, bestehend aus Schilf, Farn, verblühten Staudengewächsen und Unkraut. Die gehört vor der Bespannung zurückgeschnitten, weil man danach nicht mehr herankommt.
„Und nun?“
Mein Mann winkte ab: „Das nehm ich nicht noch mal ab. – Vielleicht schafft‘s der Fischreiher ja auch nicht, durchzukommen.“
Nun sind wir jedenfalls gespannt, wie optimal sich der Schutzwall auf unsere Fischpopulation auswirkt.

Jeden Herbst erwacht bei meiner Freundin Micha das Pilzfieber. Sie scheint nicht viele Pilze zu kennen, denn sie fotografiert sie und fragt uns dann in der WhatsApp-Gruppe, was das für einer ist. Und ob er zu den Genießbaren zählt. Die anderen Mädels halten sich bedeckt, ich Landei bin die Pilzfachfrau. Eine Einäugige unter Blinden – Sie verstehen?
Meine Freundin schickt aber auch Kreaturen, ich sage Ihnen weiter nichts!
Wir hatten schon welche, da flatterten fleischfarbene Unterröcke auf dürren Spinnenbeinen im Wind. Oder schwindsüchtige Fingernägel, die sich um ein Fläschchen schwefelgrünen Lacks balgten. Letztens war einer dabei, der sah aus wie das Gehirn eines Affen. Bei den Fotos kann es einem Himmelangst werden. Unter den ShootingStars fand sich noch keiner, den man auch nur in die Nähe eines Kochtopfes lassen konnte.
Wie es der Zufall will: Just wenn bei Micha im Garten die Pilze sprießen, tun die das bei uns daheim auch. Allerdings mit einem diffizilen Unterschied: Unsere Pilze sind auf alle Fälle essbar! Wir haben Rotfußröhrlinge, im Volksmund auch Ziegenlippen genannt und Birkenpilze.
In den letzten Jahren kamen wir in Summe auf maximal drei Schwammerl pro Saison – doch in diesem Jahr knacken wir alle Rekorde! Im Moment wachsen 14 riesengroße Schirme gleichzeitig auf der Wiese. Alles Birkenpilze, fein verteilt unter dem namensgebenden Baum.
Mein Pubi schleicht nun täglich mit der Bratpfanne unterm Arm in den Garten und hofft, dass ich das nicht bemerke. Zu gerne möchte er sich ein schmackhaftes Pilzgericht einverleiben.
Allein ich untersage das strickt!
Unsere Pilze werden nicht gegessen!
Ich will, dass unsere Pilze Sporen werfen!
Ich will, dass wir eines Tages Pilze wie vom Acker ernten können!
Einfach eben das Abendessen reinzuholen, ohne dafür erst im Wald herumzustreunen und dort Hänsel und Gretel, dem bösen Wolf und anderem Geschwerl zu begegnen.
Mein Traum und der pure Luxus.
Dafür opfere ich auch Einiges. So ist bei uns jeden Herbst die Wiese für sämtliche Kinder gesperrt. Ich mache da keinen Unterschied, ob es sich um eigene oder um Besucherkinder handelt. Da bin ich eisern! Jeder Pilz soll die Zeit zum Reifen und Absamen bekommen, die er braucht. Macht man mit Männern ja auch so.
Genug von der Rahmenhandlung erzählt, werden wir mal szenisch!
Gestern hatte mein Gatte Grillbesuch geladen. Den Kindern wurde das Geschwätz der Erwachsenen schnell zu langweilig und so klauten sie sich in einem unbeobachteten Moment den Beutel mit dem MinigolfEquiment und verzogen sich nach hinten auf die Wiese.
Pubi hatte zusätzlich noch einen Hammer mitgenommen – soll er was helfen, weiß er nie, wo das Werkzeug liegt.
Erst ab dem ersten Schlag auf eines der Positionshölzchens kriegte ich die Sache spitz. „Ey, wat soll dat?“, brüllte ich in den Garten. „Die Wiese ist gesperrt!“
„Wir machen nichts kaputt“, vernahm ich Geflügels zartes Stimmchen von hinterm Schilf. „Wir sind ganz vorsichtig und spielen nur hier am Weg. Indianerehrenwort!“
Ich wollte gerade ansetzen, dass ich das kennen würde und jetzt Schluss mit der Gaudi wäre, doch mein Mann beruhigte mich: „Mach nicht so einen Stress. Die Pilze sind groß genug, die sind nicht zu übersehen. Da tritt keiner drauf.“
Mein Finger zuckte zur Schläfe und ich wollte meinen Gatten Bescheid sagen, doch der Besucher kam mir zuvor und nickte zustimmend: „Genau. Sie haben es außerdem versprochen.“
Was hätte ich da tun sollen?
Ich gab mich geschlagen.
Gegen zwei bornierte Männer kommt man mit mütterlicher Weitsicht sowieso nicht an.
Ich winkte also ab und begab mich in die Küche. „Will jemand Kaffee?“ Hausarbeit lenkt mich immer am besten ab.
Und richtig: Die Kaffeemaschine blinkte mir fröhlich einen Imperativ entgegen: Trester leeren!
Gerade wischte ich mit einem Küchentuch das matschige Kaffeepulver aus den Ecken des Auffangbehälters, als die Kinder ihres Spiels überdrüssig zur Terrasse zurückkamen.
„War‘s das schon?“, fragte der Besucher verwundert, während mein Mann vermittels Zeigefinger eine parente These an die Terrassentür nagelte: Auch wenn sich eine Sache als weniger aufregend entpuppt als gedacht, bleibt man eine Weile dabei und gibt ihr eine Chance!
Bei mir jedoch schrillten sämtliche Alarmbimmeln Sturm: „Was habt ihr angestellt??“
„Was sollen die angestellt haben?“, knurrte mein Mann. „Die haben keinen Bock mehr.“
„Quatsch“, knurrte ich zurück. „Wie viele Pilze?“ Ich sah Pubi scharf an.
„Du hast echt ‘n Knall mit deinem Pilztick!“, fauchte der Knabe und wollte sich an mir vorbei ins Haus zwängen. „Das wird sowieso nichts!“
„Wie viele?“
„Mensch, vier, wenn du es genau wissen willst!“
Schnell rechnete ich im Kopf durch. Die Verbliebenen würden es schwer haben: Dynastien zu gründen erfordert Disziplin!
Verbal weiter rumzuzicken brachte aber nichts, das schraubte den Gefallenen die Pilzmurmeln auch nicht wieder drauf. Erzürnt holte ich mir deshalb aus der Küche das schärfste Messer, das wir besitzen – und?
Schnippelte die Körper der vier Birkenschwammerl in hauchdünne Scheiben. Dann breitete ich sie sorgfältig auf vier Blättern Küchenkrepp aus, und stellte sie in die Sonne. Am Abend nahm ich sie mit ins Haus und rangierte sie liebevoll auf der Heizung.
Das wiederhole ich jetzt täglich; so lange, bis sie richtig schön prasselig trocken sind. Dann stecke ich sie in ein Schraubglas und im Winter kommen sie in die gute Suppe.
Im Ergebnis ist die Sache gar nicht so schlecht gelaufen. 🙂

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Ich darf Ihnen stolz verkünden, dass wir unsere Rettungsmission „Pubi goes Ruhrpott!“ siegreich zum Abschluss gebracht haben!
Nicht nur die Alpenüberquerung per Elefant war so kurz vor dem ersten Schnee mit viel Verstand gesegnet – auch unseren riesengroßen Reisegefährten brachte ich Montagmorgen wieder klammheimlich in den Zoo zurück. Den anderen warf ich vorher pünktlich – wie das von mir als gute Mutter erwartet wird – mit dem Klingeln vor der Schule ab.
Wir wären eigentlich 20 Minuten früher dagewesen, doch wir standen in einer Umleitung im Stau. In Mülheim wird nämlich gebaut. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ganze Land freut sich über die Konjunktur.
Wie sie das anderswo halten, weiß ich nicht, aber hier besteht die Herausforderung darin, an mehreren Einfallsrouten gleichzeitig die Straße aufzureißen. Mit dem Ziel, dass der Verkehr zu Stoßzeiten auch garantiert zum Erliegen kommt.
Das ist wirklich knifflig, denn der gewiefte Einheimische nimmt dann auch schon mal eine Einbahnstraße falschherum in Kauf. Das nützt ihm aber nichts, weil im Gegensatz zu mir bereiten die von der Baustellengenehmigungsplanung sich ausgiebig und detailliert darauf vor. Und so steht der Fuchs dann mit dem Elefanten, zack, vor dem nächsten weißen Plastikzaun.
Weit und breit ist nirgendwo ein Arbeiter zu sehen, auch kein schweres Gerät: Könnte also auch gut sein, dass die Sperrerei in Wahrheit einen anderen Grund hat.
Na, ich habe den Elefanten ja jetzt zurückgebracht, bestimmt gibt es in Mülheim ab morgen wieder freie Fahrt für freie Bürger!
Aber nochmal zurück zum Elefanten. Nach so einer langen Reise liegt es auf Hand, dass er ziemlich unter dem Trennungsschmerz leidet. Die erste heftige Attacke konnte ich mit einer Stiege Bananen lindern – die nächste bringe ich ihm morgen.
Ich muss mich bei meinen Besuchen allerdings verkleiden, denn ich will ja nicht im Nachhinein noch einkassiert werden. Morgen gehe ich als Weihnachtsmann, dem kann man immer schön was erzählen.
Welcome home and Merry Christmas!
Mülheim an der Ruhr: Siegreiche Mutter mit Lorbeerkranz

Hi Leute,
viele Grüße aus dem Bergen, Ihr wisst schon von wo!
Genauer will ich es nicht verraten, da ist ja noch die Sache mit dem geklauten Elefanten. Die hat ganz schön Wellen geschlagen: überall Kontrollposten, die irgendwelche Papiere sehen wollen. Für den Elefanten hatte ich ja nichts dabei, deswegen habe ich ihm einen Pass selbstgemalt. Bisher hat das keinen gestört. Ich will aber nichts riskieren und so kommen wir mit unserer Rettungsmission bloß langsam vorwärts. Wir reisen nur, wenn es finster ist. Die Zeitumstellung wirkt sich dabei gar nicht aus. Morgens ist es dunkel, abends auch. Wenn mich also einer fragt: Ich bin dagegen.
Übrigens schwankt so ein Elefant wie ein Kamel. Mir ist sau schlecht.
Zum Glück haben wir noch ein paar Tage Zeit, bis die Schule wieder anfängt! Ich denke, wir werden Mülheim Montagmorgen pünktlich 8:00 Uhr erreichen. Also mit dem Klingeln …
Drückt uns weiterhin die Daumen und gehabt Euch wohl!
Pubi-Hannibal und Mutter Müller
(Ansichtskarte von vorne: Postkutsche im Laubwald)

Donnerstags erzähle ich Ihnen ja immer einen. Mir ist sonst langweilig und außerdem frage ich Sie so gerne um Rat.
Aus Gründen von Herbstferien unterbreche ich das jetzt mal. Ich will mich ein bisschen mit meinen Mutteraufgaben befassen: Kinder herzen, geklaute Äpfel einmusen, Weihnachtsgirlande billiger handeln, Herbstlaub zum Nachbarn schieben – was man halt so tut, damit der Nachwuchs weiß, wie es später läuft im Leben.
Ein paar spießige Bürgerdinge gehören außerdem erledigt: Auto waschen, Bürgersteig fegen – vielleicht spritze ich auch mal die Fenster von außen ab, damit drinnen der Stromverbrauch sinkt. Da bin ich mir aber noch nicht sicher.
Ein Ding hält mich zusätzlich in Atem: Pubis Rückreis aus den Ferien! Er weilt nach dem 28. Oktober als AirBerlinFluggast in der Schweiz bei der Tante, Sie erinnern sich.
Dank Ihnen habe ich alle Optionen im Kopf durchgespielt: Dortlassen, Zurückwandern, Heimradeln oder einen Heißluftballon zusammennähen (als Ossi hat man damit Erfahrung).
Seit ich um das Problem weiß, habe ich zur gedanklichen Refreshung eine Badewanne voll Tee leergetrunken.
Im Moment bin ich dabei, einen Elefanten zu besorgen: Mit dem kommt Hannibal-Pubi Müller dann sicher und ohne Verluste über die Alpen, das hat schon einmal geklappt.
Tausend Dank an der Stelle an meine BloggerKollegin Ellen für diese grandiose Idee!
Weil es aber schwierig ist, den Zoo in Duisburg von der Herausgabe eines Elefanten zu überzeugen, muss ich nun meine SchwatzKompetenzen bündeln. Drücken Sie mir die Daumen und sehen sie unser familiäres ZusammenführungsUnterfangen wohlwollend!
Herzlichst und auf in Bälde,
Ihre Anke Müller

AirBerlin stellt zum 28. Oktober den Flugbetrieb ein.
Haben Sie es alle mitbekommen?
Normalerweise hebt mich das ja nicht an.
Weder steuert einer von uns ein Luftschiff, noch macht hinten einer die Saftschubse. Klempner oder Sesselfurzer in der Verwaltung sind wir auch keine – mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein, womit man bei einer Fluggesellschaft sein Geld verdient.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich finde das Ende tragisch!
Da ich aber nun mal nicht betroffen bin …
Doch jetzt kommt es!
Das finale Ende liegt in den Herbstferien. Schön mittig auf der Hälfte, am Samstag nach der ersten Woche. Und mein allerliebstes, entzückendes Pubertikel weilt in der Schweiz. Bei der Tante, die hat starke Nerven.
Der Hinflug geht klar – nur zurück kriege ich ihn nicht wieder.
Ich mache mir jetzt mal einen Tee und dann werde ich in aller Ruhe abwägen, wie schlimm das ist! 🙂

Mutter: „Dieses wunderbare Buch hilft mir dabei, zu entscheiden, ob ich Pubertikel anderweitig heimhole!“ 🙂

Wenden wir uns heute einer anderen romantischen Herbstweise zu: Spinnen!
Dicke, fette, schwarze Hausspinnenmännchen auf Brautschau. Kennen Sie?
Nur für denn Fall, dass dem nicht so ist: Kinderfaustgroße, lichtscheue Kellerbewohner mit acht dünnrohrigen HochgeschwindigkeitsTentakeln und starker Beinbehaarung. Nicht zu verwechseln sind die Liebestollen mit den schlaksig, zittrigen Weberknechten. Schon allein deswegen nicht, weil sich die Jungs untereinander nicht grün sind: Der Kleinere schätzt den Größeren als Delikatesse.
Weberknechte gibt es übrigens auch mit Flügeln, da nennt man sie Schneider.
Ja, ja, schon gut, ich höre schon damit auf! Eigentlich will ich eine Homestory erzählen, die Damen können sich also entspannt zurücklehnen. 🙂
Versetzen Sie sich in eine beschauliche Mülheimer HausflurSzene:
Zwei Grundschulfreunde besohlen sich ihre Füße, sie wollen nach draußen.
Aus Platzgründen hockt das Mädchen auf der Treppe, der Kumpel lümmelt quer davor.
Die Sache zieht sich, man hat sich viel zu erzählen.
Nach fünf Minuten hat die Maid immerhin schon einen Fuß im Schuh – der Knabe schwingt seine noch am Bandel im Kreis herum, so wie Thor seinen Hammer.
Theoretisch kann mir das egal sein, ich bleibe sowieso drinnen – praktisch aber nicht, denn vor der Tür warten noch zwei Menschlein. Um sich die Zeit zu vertreiben, ernten die derweil meine Tomaten ab. Da sie keinen Lärm veranstalten, ist ihnen die Schändlichkeit ihres Tuns bewusst.
Offensichtlich gönnt uns Thor das Gemüse ebenfalls nicht, denn er wendet sich plötzlich an mich: „Anke, weißt du eigentlich, dass drei Meter entfernt von jedem Menschen eine Spinne lauert?“
„Nein“, antworte ich wahrheitsgemäß, „ist mir neu.“
Weil ich unverwandt entspannt gucke, schickt der Kleine noch eine Info aus dem Kinderfernsehen hinterher: „In jedem Haus leben drei Spinnen.“
Ich nicke. „Kann ich mir gut vorstellen, ich weiß, wo die sitzen.“
Der Kleine starrt mich an. „Hier? In eurem Haus??“
„Zu einer habe ich Blickkontakt.“
Der Junge reißt die Augen auf.
„Willst du wissen, wo sie sich verstecken?“
Der Knabe bewegt sich nicht. So im Gegenlicht kann ich ihn halt schlecht erkennen – und ehe ich da noch dreimal nachfrage, gebe ich lieber bereitwillig Auskunft. Hätten Sie doch auch so gemacht?
Ich lege also los: „Eine ist in die Badewanne im Keller gefallen. Die zweite lauert im Treppenhaus an der Wand hinter dir – und die Dritte bewacht im Küchenschrank die Schokolade …“
Ich bin mit meiner Schokolade noch nicht fertig – vor allem habe ich noch nicht erwähnt, dass es sich bei der im Schokivorrat um eine Plastikspinne handelt – da wird der Knabe kreidebleich.
Den Farbwechsel sehe ich sogar bei den schlechten Lichtverhältnissen.
Der Junge kreischt los, reißt die Tür auf und stürmt schreiend nach draußen.
Geflügel springt ebenfalls auf: „Warte! Du hast deine Schuhe vergessen!“
„Ich bleib ohne“, bibbert es hinter der Mülltonne.
„Fürchtet der sich etwa vor Spinnen?“ Auf den Schreck muss ich mich erst mal setzen.
Nichtsdestotrotz fiel mir ob des Theaters nun aber endlich wieder die Spinne in der Badewanne ein! Mensch, das arme Vieh hockte da seit mindestens zwei Tagen und kam nicht vor und nicht zurück. Ich war bisher zu busy, um als Kammerjägerjungfer herumzurennen. Genaugenommen hatte ich auch jetzt keine Zeit. Doch zwei Tage ohne Essen und ohne soziale Kontakte …
„Pubi!“, rief ich ins obere Bad, wo es rumorte: „Schmeiß mal unten die Spinne aus der Wanne!“
„Kannst du vergessen“, gab der mir Bescheid, „die ist mir zu groß.“
„Ja und? Da nimmst du halt ein größeres Glas! Du wirst schon was Passendes finden.“
„Ums Glas geht‘s nicht, Mutter!“ Pubi klapperte hektisch mit dem Föhn.
Der wird doch nicht etwa … „Hast du etwa Angst vor der??“
Keine Antwort.
Eigentlich wäre es nun meine Aufgabe als Mutter gewesen, den Knaben bei der Hand zu nehmen, und mit ihm gemeinsam das Spinnentier an die Luft zu setzen. Eigentlich. Tatsächlich war es aber so, dass ich allzeit gestresste Mutter gleich einen Job hatte und wenn ich davon zurückkäme, die Spinne sowieso längst wieder vergessen hätte. Ich scheute also die Diskutiererei und nahm die Sache selbst in die Hand.
Vom Regal in der Küche schnappte ich mir das größte Trinkglas, das wir haben und von meinem Schreibtisch nahm ich ein DinA4 Blatt mit. Dann stürmte ich zur Spinne. Während ich in die Wanne kletterte, redete ich ihr gut zu: „Gleich erlöse ich dich …“
Die Spinne fand die plötzliche Nähe gar nicht lustig und nahm erschrocken die Beine in die Hand. Pfeilschnell sauste sie zum anderen Ende der Wanne und versuchte, mit Anlauf die Wand zu erklimmen. Wohl weil sie nicht genug Schwung hatte, rutschte sie nach einem drittel Höhe wieder herunter.
„Armes Ding“, sagte ich mitleidig und wollte das Glas geschwind über den zitternden Leib stülpen – doch in dem Moment drehte sich das Vieh blitzschnell um, und galoppierte mit Lichtgeschwindigkeit auf mich zu. Mich durchzuckte der heftige Impuls, laut zu schreien und die Wanne im Hechtsprung zu verlassen – allein der Gedanke an meinen schadenfrohen Pubi ließ mich tapfer weiterkämpfen.
„Du dusseliges Viech!“, brüllte ich mir Mut an. „Komm her jetzt, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit!“
Meine Schallwelle muss die Spinne tierisch eingeschüchtert haben, denn sie verharrte stocksteif. Gerade dass sie sich nicht auf den Rücken fallen ließ und tot stellte.
Das war der Moment, indem ich fix das Glas über das Monstrum stülpte und das Papier darunterschob. Augenblicklich kehrte auch das Leben in die Spinne zurück. Ihre Röhrenbeine trommelten hörbaren Protest.
„Sei froh, dass ich kein Weberknecht bin …“, beruhigte ich sie und machte mich an den Ausstieg.
Nun ist das aber auf den griplosen Wannenstufen kompliziert, wenn man keine Hand frei hat. Irgendwie schwankte ich, eine Winzigkeit nur, doch immerhin so viel, dass das Blatt, das ich als Deckel über dem Glas hielt, ein wenig lupfte – und Zack: Entschlüpfte mir die Spinne. Mit einem Affenzahn sauste sie über den weißen Fliesenboden und verschwand zwischen den Bodengittern der Heizung.
„Scheiße!“, knurrte ich.
Was macht man denn in so einem Moment?
Kurz überlegte ich, ob ich das Glas hinterherschmeißen sollte.
Dann entschied ich mich für das einzig Richtige: Ich tat nichts.
Pubi, der im Flur an der Haustür auf mich wartete, meldete ich Vollzug.
Sollte der verliebte Achtbeiner wieder auftauchen, würde ich mich über den Informationsgehalt des Kinderfernsehens empören: Das mit den drei Spinnen im Haus stimmt hinten und vorne nicht! Das sind viel mehr!

Lassen Sie uns mal von Vögeln reden! (Gefiederte Tiere meine ich, ehe es zu Missverständnissen kommt!) Zur Einstimmung ein erweiterter Flügelschlag:
Es summseln nicht mehr so viele Insekten durch die Gegend, wie man das kennt. Mir fällt das immer auf, wenn ich über die Autobahn heize: Noch vor ein paar Jahren war es so, dass am Ziel Motorhaube und Scheinwerfer paniert waren wie Wiener Schnitzel – nur eben frisch mit Insektenklein eingeschleimt.
Heute fahre ich doppelt so schnell wie damals und am Ziel blitzt und funkelt mein Schlitten, als käme er gerade aus der Waschanlage – von einem zermatschten Nachtfalter an der Frontscheibe mal abgesehen.
Weil mir zuerst die Idee kam, dass das an der Geschwindigkeitsdopplung liegen könnte, besprach ich die Sache mit meinen Vater. Der weiß alles. Außerdem hat er mehr Zeit und fährt deshalb gemütlich – doch bei ihm verhält es sich ebenso: Die Kutsche kommt porentief rein nach Hause, wie frisch gewienert.
Generationsübergreifend kamen wir deshalb überein: Es flattert weniger Getier!
Just um unsere Theorie zu bestätigen, las ich kurz vor den Sommerferien einen Aufruf von Naturschützern, dass man Vögel eben wegen des Insektenmangels nun das ganze Jahr durchfüttern soll. Die Winterfütterung reiche nicht mehr aus, auch im Sommer gäbe es nicht genug Nahrung in unseren Sagrotan-geflegten Gärten.
Erschrocken begab ich mich sogleich zum ortsansässigen Baumarkt. Die führten, saisonal bedingt, aber nur Grillaustattung und Mittel gegen Buchsbaumzünsler. Wegen Vogelfutter sollte ich nach dem ersten Frost wiederkommen.
Bis dahin hungern lassen wollte ich meine Vöglein auch nicht – also landete ich im Online-Versandhandel. Da kriegt man das ganze Jahr über alles.
Nun bin ich aber ein Fuchs und startete erst mal mit Preisvergleich:
1 Kilogramm Sonnenblumenkerne für 3 EURO,
5 Kilogramm für 7 EURO
Versandkosten waren obendrein zu berappen und wenn bei uns künftig das ganze Jahr durchgepickt würde, käme ich mit fünf Kilo nicht weit.
25 Kilogramm war die nächste Chargengröße.
„Wie voluminös wird so ein Sack wohl sein?“, fragte ich meinen Mann.
„Egal, lagern wir in der Garage.“
Ich drückte also auf „Bestellen“ und vergaß die Sache sogleich, es passierte auch erst mal lange nichts. Die Vögelein schlugen sich derweil anderweitig durch. Lag auch kein toter Flatter vorm Haus, also ging es wohl noch.
Eines Tages in der Mittagszeit schnaufte ein schwarzer LKW den Berg herauf. Er hielt vor unserem Haus und die Laderampe surrte herunter. Ein schmächtiges Männlein hüpfte in den Auflieger und kam mit einem viereckigen Monstrum auf der Schulter wieder herausgewankt. Sah aus wie ein Sarg.
Was sollte das werden??
Wir sind doch hier kein Friedhof!
Ich stürzte nach draußen. „Guter Mann! Packen Sie Ihren Vampir wieder ein! Sie sind hier falsch!
Fast strauchelte das Männlein. „Sind Sie Frau Müller?“ Er schnaufte schwer und auf seiner Stirn quollen die Adern heraus.
„Ja …“ Mir schwante Übles.
„Dann habe ich eine Lieferung für sie.“ Er wollte mich beiseite schieben und das Erdmöbel in unseren Hausflur abkippen.
„Unterstehen Sie sich!“ Meine Lebensgeister erwachten und ich breitete abwehrend die Arme aus. „Stellen Sie das vor der Tür ab!“
Unser Hausflur ist so eng, da kommen zwei Leute gleichzeitig nicht aneinander vorbei. Stünde das Ding da rum, ginge es weder raus noch rein – bei offener Haustür wohlgemerkt.
Es rumpelte und pumpelte und das Gruftmobiliar krachte auf den Fußabtreter.
Das Männlein, seiner Last befreit, streckte sich, seine Wirbel im Rücken knackten einzeln, dann zückte es einen dieser lustigen Taschenrechner zum Unterschreiben und drückte ihn mir in die Hand. „Aber leserlich!“
Kaum war ich mit dem zweiten Kreuz fertig, entriss es mir den Konservator wieder, drehte sich grußlos um und verschwand.
Machen wir es kurz, es war Ihnen sicher schon klar: Der Totengräber hatte das Vogelfutter gebracht.
In der Garage fand sich kein Platz – übrig blieb nur der Vorratskeller. Dort gehört Vogelnahrung thematisch ja auch hin. Wir kommen jetzt bloß nicht mehr an die Kartoffel heran und an den Bierkasten auch nicht.
Wenn also bei einem von Ihnen Vogelfutter aus ist: Wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an mich!
Bis dahin koche ich jeden Tag Nudeln – und mein Mann trinkt zum Feierabend einen Yogi-Tee.
Sind Engländer unter den hochverehrten Lesern? Kann man auch Sonnenblumenkerne aufgießen?

Im Futterhäuschen wird nun seit einer Weile täglich die Tafel gedeckt. Sämtliche Vöglein der Gegend scheinen das mittlerweile spitzgekriegt zu haben: Es geht zu wie in der Fußgängerzone.

Die Trauer um unsere von den gefräßigen ZünslerRaupen aufgefressenen Buxe eint uns, wir verharren und sind erleichtert, dass der Herbst gekommen ist. Mit Laubrechen, Brennholzsammeln und Äpfelklauen lässt sich gut die Zeit vertreiben.
Doch lassen Sie uns gemeinsam nach vorn blicken! Was machen wir mit den kahlen Standorten?
Dass diese Frage drohend und düster über den verwaisten Gärten baumelt, sehe ich jeden Tag, wenn ich meinen Berg erklimme. Ein Vorgarten dauert mich besonders: Eine tiefe, über die gesamte Grundstücksbreite gehende frische Schnittwunde markiert den ehemaligen Platz einer treuen Hecke.
Letztens verwickelte mich der Besitzer in ein Gespräch, mein mitfühlender Blick hatte ihm gutgetan. Die freie Sicht gefiele ihm nicht und er überlege, ob er stattdessen eine Ligusterhecke setzen solle. Allerdings störe ihn, dass die Krackel so schnell wuchsen und er häufiger schneiden müsse. Er sei ja auch nicht mehr der Jüngste. Obendrein wäre die Hecke im Winter kahl …
Was soll ich sagen? Ich verstand ihn!
Eine meiner Kolleginnen händelt die Nachfolge ihrer buxfreie Gartenzone mit dem Pflanzen von bunten Blumen. Leider käme sie aufgrund der kurzen Blühdauer auf drei Pflanzgänge pro Jahr, was zum einen ins Geld ginge, zum anderen verdammt viel Arbeit mache. „Der Rücken“, stöhnte sie.
Auch sie verstand ich.
Eine Freundin winkte ab: „Mir ist das egal, ich mache jetzt überall Rollrasen! Da muss ich nur ein, zwei Mal im Jahr drübermähen. – Oder ich betonier gleich und streich grün, mal sehen …“
Sie verstand ich nicht.
Deshalb lassen Sie uns gemeinsam zu meiner eigenen Buxliebhaberei schwenken!
Fangen wir beim Logischen an: Mein Gerippe auf der Mülltonne. Das behandelten wir diese Woche ja schon ausführlich: Es trägt nach wie vor Sack.
Nach hinten raus, auf der Terrasse, glänzte einst in einem Kübel eine gewaltige BuxPyramide mit einem blühenden Kragen aus Glockenblumen drumherum.
Die blauen Glöckchen blühen dort immer noch, nur in der Mitte trohnt jetzt ein Margeritenbusch. Sieht schön aus, zugegeben – weil der den Winter aber nicht übersteht, verhält es sich ähnlich wie bei der Kollegin und ich greife bald wieder in die Tasche. Allerdings bin ich bei Pflanzen genau so genügsam wie im Leben und wechsele die Bepflanzung unter der Saison nicht.
Der Wirtschaft ist der Zünsler zuträglich – dem Bürger geht er auf die Eier.
Weil das so auf Dauer nicht weitergehen kann, begab ich mich zwecks Fachmannrat in Mülheims renomiertestes Gartencenter. Die kannten mich da bereits, die standen mir seit Beginn der Invasion beiseite – vor allem bei den Folgekosten. Deswegen verwunderte es den fleißigen Gärtnersmann auch nicht, als ich ihn nach einer immergrünen dauerhaften Pflanzalternative fragte.
„Wird echt langweilig, wenn sie nicht mehr kommen“, grinste er und führte mich hinter ein Holzhaus zu einer Ansammlung von Kugeln mit kleinen sattgrünen Blättern.
„Guter Mann“, ich schüttelte den Kopf, „Ich will keinen neuen Bux! Ich such was Bleibendes!“
„Nicht doch“, der Gartenzwerg schwang den Zeigefinger, „das sind ZwergStechpalmen! Schauen aus wie Buchsbaum, verhalten sich auch so.“
Toll! Ich war begeistert – und linste auf den Preis.
Der war weniger toll.
Doch der beschürzte GärtnereiFachverkäufer verstand sein Handwerk: „Immergrün, schädlingsresistent, pflegeleicht und sehr robust – besonders auch für Leute ohne grünen Daumen!“
Beim Nachsatz grinste er richtig unverschämt. Mein Mittelfinger zuckte, doch ich bändigte ihn. Wo der Gartenzwerg recht hat …
Aufgrund der Lobpreisung erstand ich dann auch zwei von den Stechpalmen. Zu einem Preis, für den ich früher eine ganze Hecke Buchs bekommen hätte.
Aber, wissen Sie was?
Ich habe die ja jetzt schon ein paar Monate vor dem Haus stehen. Die beiden Töpfe sind tatsächlich ihr Geld wert!
Schauen doch schön aus, oder?
Hätten Sie erkannt, dass das kein Buchsbaum ist?

Über die Fakten brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen, Sie sind im Bilde. Mittlerweile hat sich die Invasion der aus Asien eingeschleppten gefrässigen Falterraupen bundesweit ausgebreitet. Sollte doch einer der hochgeschätzten Leser nicht verstehend die Stirn runzeln: Keine Sorge, es dauert nicht mehr lange.
Innerhalb nur eines Jahrzehnts gelang es den Scheißviecher, fast die gesamte deutsche Buchsbaumpopulation auszurotten.
Mit der Heimsuchung gingen wir alle unterschiedlich um: Ich zum Beispiel las die Raupen im ersten Jahr von den Blättern ab und zermalmte sie zwischen zwei Bruchsteinen. Weil man so viele gar nicht einsammeln kann, wie neue nachkamen, spritzte ich im zweiten Jahr Gift und im dritten schließlich gab ich auf.
Eine meiner Nachbarinnen rückte im ersten Jahr mit dem Kärcher gegen die Invasoren vor, im zweiten wechselte sie auf kochendes Essigwasser – und im dritten Sommer gab sie ebenfalls auf.
Wir hatten groß gekämpft und doch verloren.
Bei meiner Freundin Carmen mit altem Zierbuchsbestand verhielt sich die Sache ein wenig anders: In unserem Jahr Null hatten es die Zünsler noch nicht bis zu ihr in den Taunus geschafft und so schaute Carmen angstvoll zu uns ins Ruhrgebiet. Bei ihr fielen die Ausgeburten dann erst im Sommer darauf ein. Somit befindet sie sich im Augenblick im zweiten Jahr der Besatzung. Sie spritzt alle paar Wochen ein Zeug, was der Gärtner ihr empfohlen hat. Wie es dann im verflixten dritten Jahr bei ihr weitergeht, werden wir sehen.
Auf unserem Grund und Boden lief es sich jedenfalls so, dass mein Mann im Frühjahr die Faxen dicke hatte und die Gerippe unserer ehemals wohlgeformten Buchse einen nach dem anderen herausriss und in die braune Tonne entsorgte.
Entweder muss ihn dabei das Wetter überrascht haben oder er war schlicht von der Arbeit erschöpft und emotional angegriffen – er übersah eine Kugel. Die wuchs früher satt und grün und zufrieden auf dem Dach des Häuschens der Mülltonne.
Natürlich fiel mir beizeiten auf, dass der Bux-Torso mit der Herbstbelaubung noch dort rumkrakelte – aber meistens wollte ich entweder gerade gehen oder ich kam heim. In beiden Fällen war ich adrett gedressed und obendrein in Eile.
Die Sache zog sich also. Über den ganzen Sommer.
Am Wochenende entdeckte ich in einem Gartenratgeber die ultimativen Anti-ZünslerKampftechnik. Ökonomisch und biologisch einwandfrei noch dazu. Sie lautet wie folgt:
Stülpen Sie einen schwarzen Müllsack über Ihren Buxus!
Schnüren Sie unten fest zu!
Lassen Sie die Mittagssonne machen!
Klingt banal?
Unter dem schwarzen Sack würden sich die Temperaturen auf 60 – 70 Grad aufheizen. Die Raupen würden gegart; den Bäumchen hingegen schadete die Hitze nichts, die könnten das ab.
Da klang so unheimlich logisch, dass ich sofort euphorisierende Begeisterung verspürte. Sogleich fiel mir mein vergessenes Gerippe ein und ich stattete ihm auf seiner Mülltonne einen Besuch ab. Mein Ziel war es, herauszufinden, ob die gefräßigen ZünslerRaupen auf dem Weg zum winzigen Schmetterling genug Leben ihn ihm gelassen hatten, damit sich die Prozedur lohnte.
Hocherfreut stellte ich fest, dass zur Hausseite ein neues zartgrünes Blättlein spitzte. Doch drei fette, frech grinsende Raupen waren bereits im Stechschritt unterwegs zum jungen Grün. Eile war also geboten. „Euch werd ich‘s zeigen!“, knurrte ich grimmig.
Weil die Kugel für einen normalen Müllsack zu groß gewachsen war und ich außerdem vermutete, dass die kahlgefressenen Zweige sowieso tot wären, beschloss ich, die Gebeine kurz über dem Boden wegzuscheiden. Der geplagte Bux könnte dann in Ruhe neu austreiben und müsste sich nicht mit dem Totholz herumschlagen. Deshalb verstand ich auch nicht, wieso er das nicht mochte und sich tapfer gegen die Schnippelei wehrte.
Hätte er mal lieber bei den gefräßigen Viechern so herumgezickt!
Sei es, wie es wolle: Mit zwei Blasen an den Fingern obsiegte ich.
Anschließend zog ich dem Rasierten einen schwarzen Sack über den Schädel und schnürte unten am Hals fest zu, um das mal als Bild darzustellen.
Ich war gerade fertig, zupfte eben noch das Schleifchen vom gelben Band in Form, verdunkelte sich der Himmel.
Erst dachte ich mir nichts dabei, sondern war nur erfreut, dass ich beim Aufräumen nicht schwitzen würde. Doch dann blinzelte ich nach meiner Verbündeten: Clara hatte sich mit grauen Wolkendaunen zugedeckt. Nun gut: Dann mach deine Arbeit halt morgen. Ich nickte ihr freundlich zu und beeilte mich, ins Haus zu kommen, denn mich fröstelte bereits.
Das ist jetzt zwei Wochen her. Seit mein Bux den Sack über dem Kopf trägt, leben wir im Herbst. Es regnet, es stürmt, die Sonne hat sich verkrochen.
Bin ich jetzt etwa Schuld am Wetter?

Wie gewöhnlich reihte ich mich Freitag entspannt in den üblichen Feierabendverkehr ein. Zusammen mit den anderen Kraftfahrern schlich ich von eine Mülheimer Baustelle in die nächste, im Radio lief gute Musik, vom Himmel schiffte es beschaulich – was will man mehr.
Doch plötzlich wurde der Song von einer wohlklingenden Moderatorenstimme unterbrochen: Unsere Frau Kanzler hätte Stralsunder Grundschülern gestanden, dass sie im Deutschunterricht in der Schule geschummelt hätte. Wer mehr darüber wissen wolle, sollte dran bleiben.
Ich sofort hellwach und drehte das Radio lauter!
Genau in dem Moment, als die im Radio die Anekdote einspielten, kriegten sich aber vor mir zwei Autofahrer in die Haare. Sie waren sich wegen des Reißverschlussverfahrens uneinig. Nun konnte mir das eigentlich Brause sein, doch sie trugen ihren Hahnenkampf per Dauerhupen aus. Kurz überlegte ich, ob ich mitmischen und denen den Marsch blasen sollte, unterließ das aber. Stattdessen drehte ich die Lautstärke bis zum Anschlag.
So kam es, dass die Einleitung, in welcher es vermutlich um die Häufigkeit des reginalen Schulschwindels ging, an mir vorbeisauste und ich erst ab der Kanzlerin Beichte folgte:
„Als wir früher dicke Bücher lesen mussten, haben wir uns auch mal eins geteilt. Der Eine hat die erste Hälfte gelesen, der Andere die zweite. Dann haben wir, wenn uns unser Lehrer später gefragt hat, was drinnen stand, unser Wissen zusammengetragen. – Aber ihr lest ja aus Freude.“
Mit Verlaub: Wie soll denn das funktioniert haben?
Wenn der Lehrer im Unterricht die kleine Frau Kanzler fragte: „Was hat denn die Mutter gesagt, als Konrad mit dem Waschmachinenschlauch den brennenden Toaster löschte?“
Da kann die kleine Frau Kanzler doch nicht geantwortet haben: „Einen Moment, da muss ich mich erst mit dem Franz besprechen!“
Nun gehe ich ja so weit mit, dass es möglich ist, dass die Wissensabfrage nicht im Frontalunterricht, sondern schriftlich erfolgte: Doch da soll die kleine Frau Kanzler sich mal nicht bei erwischen lassen haben, wenn sie beim Franzl spickte! So ein Lehrer ist ja auch nicht blöd.
Kann auch sein, dass der uckermarksche Lehrer gar nicht herausfinden wollte, welches seiner Schäfchen lediglich zwei Wochen mit dem Buch Blümchen gepresst hatte. Kann ja sein, dass er seine inhaltlichen Fragen nur an die richtete, die sich meldeten. Dann wäre sie damit durchgekommen (Das widerspricht allerdings meiner Erfahrung als Schüler und Schülermutter).
Doch betrachtet man diese Leseteilung unter dem sozialen Aspekt, ist die ganz und gar nicht korrekt! Für die kleine Frau Kanzler mag das gegangen sein: Die hat mit dem Schinken einfach in der Mitte aufgehört – aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind der arme Franz!
Der wusste beim Start seiner Lektüre nicht mal, dass Konrads Mutter einen Sohn gebar, dass sie einen verdammten Toaster nebst Waschmaschine besitzt und wieso es überhaupt einen interessiert, was es mit dem Bengel und der Alten auf sich hat. Ganz im Gegenteil, der hätte da ein Lehrbeispiel zur Volksweisheit erhalten: Den Letzten beißen die Hunde. Und das gehört sich ja wohl nicht, dass der arme Junge in der Schule in den Schrank gesperrt wird!
Ich war ja auch mal Schüler und außerdem bin ich Mutter zweier grundverschiedener Schüler. Ich las damals tatsächlich aus Freude. Noch vor jedem ersten Schultag hatte ich das Deutschbuch ausgelesen. Mein Geflügel liest brav, was man ihm in der Schule aufträgt – und mein Pubi macht eher nichts, der vergisst lieber seine Hausaufgaben. Wir drei bilden einen guten Querschnitt durch die Schulgesellschaft.
Ich bin dem Schummeln in der Schule ja auch nicht abgeneigt, aber wer sich solidarisiert, der soll sich das so wohl überlegen, dass mir nicht aus dem Stand die Argumente einfallen, warum das nicht zusammenpasst.
Habe ich eigentlich eine Möglichkeit übersehen, wie die Sache mit der Buchleseteilung gelaufen sein könnte?
Ich grübele da jetzt seit Freitag daran herum …


Ich war etliche Wochen absent, es ist Ihnen vermutlich aufgefallen.
Irgendwann ging mir das Geld aus und so habe ich Palmen, Meer, Sand, den Sturm und mein RentBike verlassen und mich auf den Heimweg gemacht.
Hier ist es eigentlich auch ganz nett – ich denke, ich bleibe eine Weile.
Zwecks der freudigen Rückkunft ließe sich gut mal wieder was erzählen.
Weiße Schuhe oder Vogelfutter, was meinen Sie?
Wonach steht Ihnen der Sinn, welche Thematik liegt Ihnen näher am Herzen?
Ich bin da offen.
Ich zapfe mir jetzt erst mal einen Eimer Regenwasser aus der Dachrinne und dann braue ich mir mit klammen Fingern einen Kaffee.
Den teile ich übrigens auch sehr gerne. Nur zu, kommen Sie vorbei! 🙂

Das Gute an Plagen: Sie kommen – sie verschwinden auch wieder.
Außer der Großbaustelle vorm Haus war in letzter Zeit wirklich Ruhe daheim und meine Familie begnügte sich mit den Hundertschaften von Mücken und Schnecken, die Sie ja auch alle gut kennen.
So, bis gestern Nacht.
Ich darf Ihnen stolz verkünden: Es gibt endlich eine neue Heimsuchung!
Gegen 21:00 Uhr kam ich gestern ziemlich fertig im malerischen Städtchen an. Eine fast durchgearbeitete Nacht und fünf Stunden stauige Autofahrt lagen hinter mir.
Eigentlich wollte ich nur dringend aufs Klo, mir anschließend von meiner Mutter etwas Gutes zu essen servieren lassen und dann wollte ich meine Ruhe haben.
Ein Loch gucken, oder so.
Konversation mit der Familie hatte bis zum nächsten Morgen Zeit.
Ich hievte meinen Koffer in den Flur und öffnete die Tür zu meiner kleinen Wohnung: Da traf mich fast der Schlag!
Alles schwarz!
Kleine wimmelnde Viecher!
Millionen, was sag ich: Milliarden!
Auf dem Fußboden, der Couch, den Vorhängen, auf dem Klavier … Überall ein lebendiger, krabbelnder Überzug!
Was zu Hölle waren das für Scheißviecher, die sich da in meiner Bude breitgemacht hatte?
Ich bückte mich näher ran.
Ameisen!
Mit Flügeln!
Alles voller geflügelter Ameisen!
Verdammt nochmal, was hatten die in meinem Wohnzimmer zu suchen?
Aber viel wichtiger: Was tat man damit?
Das konnten die jedenfalls vergessen, dass ich mir für die Nacht eine andere Bleibe suchte!
Gar zu lebhaft erinnerte ich mich, als ich den Waschbären mein Bett überlassen hatte und stattdessen auf Mutters unbequemer Couch im Wohnzimmer nächtigte.
Da Ameisen im Gegensatz zu den eingeschleppten kanadischen Bärenviechern nicht beißen, war schon klar, wer am Ende des Abends als Sieger hervorgehen würde.
Kurzentschlossen schnappte ich mir Mutters Staubsauger und rückte der Invasion auf den Leib.
Bei den Vorhängen war es schwierig, die Schnorchel fraß sie und verstopfte.
Da Ameisen keine Widerhaken an den Beinen haben, fielen sie vom Schütteln aus der Gardine.
Nach einer halbe Stunde war die Sache erledigt und meine Wohnung sah aus, wie ich sie in Erinnerung hatte.
Ich stieg also die Treppe rauf und ließ mich von Mutters guter Wurst und den Zwiebeln aus eigener Züchtung verwöhnen.
Als ich satt war, verließ ich meine treusorgenden Eltern. Öffnete unten meine Tür: Krabbelten die dämlichen Viecher wieder auf Sofa, Dielen und Klavier herum!
Wo waren die denn schon wieder hergekommen??
Das konnte doch nicht wahr sein!
Es sah ein wenig so aus, als beamten sie durch die Wand. Deshalb stürmte ich nach draußen und stolperte über die Baustelle, bis ich das Fenster, hinter dem mein Sofas steht, erreichte.
Was ich da sah, das glauben Sie nicht!
Da wogte ein dicker Strom Ameisen geordnet den aufgerissenen Bürgersteig entlang, krabbelte bei uns ein Stück die Mauer hoch und verschwand dort zwischen den wuchtigen Sandsteinquadern.
Jetzt hatte ich aber genug davon!
Ich wollte nicht am nächsten Morgen wie in einem Hitchcock-Film erwachen.
Oder auch nicht wach werden, das weiß man ja vorher nicht, wie es zu Ende geht.
Ich holte aus dem Keller die chemische Keule für Notfälle und sprühte die halbe Flasche in das Einfalltor.
Es stellen sich folgende Fragen:
Wo kamen die vielen Ameisen her?
Was wollten die ausgerechnet in meinem Wohnzimmer?
Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und nun eine zweisäulige Theorie:
Zum Einen muss die Population in diesem Jahre enorm sein, denn auch andere aus unserem kleinen Ort beklagen die Invasion. Allerdings rennen die Viecher bei denen draußen herum und nicht im Bett.
Die andere Hälfte meiner Theorie beinhaltet die Großbaustelle. Wanderten die Ameisen jahrhundertelang unter der Straße durch die Kanäle des Städtchens, haben ihnen die Baumaßnahmen ihre Renntunnel genommen. Die gemauerten Abwasserkanäle wurden in den letzten Wochen in der ganzen Stadt zugeschüttet und ständig rumpelt eine Walze auf und ab und verdichtet den Untergrund.
Als Ameise würde ich da auch das Weite suchen!
Darum merke: Keine Aktion ohne Reaktion!
Gerade kommt wieder eine handvoll Ameisen auf meinen Tisch gekrabbelt.
Vielleicht schlafe ich heute Nacht doch besser wieder auf Mutters unbequemem Sofa!

Heute Nacht war bei uns was los!
Gegen drei Uhr Geräusche aus dem Keller!
Ich sofort hellwach – oder was man halt so wach nennt.
Da! Noch mal! Es schepperte und klirrte – Da war einer über den Bierkasten gefallen!
Ich stieß meinen Mann an. „Wach auf! Unten ist einer!“
Mein Mann bewegte sich nicht.
Ich rüttelte an seiner Schulter. „Einbrecher! Mensch, wach auf!“
„Was ist los?“ Mein Mann richtete sich ruckartig auf.
„Da sind welche“, flüsterte ich. „Hörst du sie?“
„Ich hör nix.“ Mein Mann ließ sich wieder in sein Kissen fallen und schlief weiter.
Jetzt reichte es mir aber! Kräftig stieß ich ihn in die Rippen. „Horch! Jetzt gehen sie in die Küche!“
„Werden Hunger haben …“ Mein Ehemann scherte sich einen Dreck um die Sache.
In dem Moment knarrte unten die erste Stufe und leise Schritte waren auf der Treppe zu hören.
Mittlerweile zitterte ich. „Jetzt kommen sie, jetzt holen sie uns.“
Neben dem Knarren vernahm ich auch das sanfte Klirren von Porzellan.
Die werden doch nicht mein geerbtes Gescherbel in einen Sack gesteckt haben!
Wie kann man denn so achtlos mit alten Schätzen umgehen?
Das machte mich wütend.
Mein Mann rührte sich nicht, er atmete tief und gleichmäßig.
Wenn der uns nicht verteidigt, mach ich das!
Entschlossen packte ich den Knüppel, der seit einer Weile griffbereit unterm Bett liegt, und huschte zur Treppe.
Die Schritte kamen näher.
Noch drei Stufen, im Haus kenne ich jedes Geräusch.
Langsam hob ich den Knüppel.
Zwei Stufen.
Ich holte tief Luft.
Eine.
Ich straffte mich.
Da kam ein Teller um die Ecke! Mit einem Baguette drauf.
Gerade wollte ich zuhauen – stand Pubi vor mir und kaute.
Jetzt hatte der Kerl sich aber dermaßen erschrocken, dass er laut losbrüllte und den Teller fallen ließ.
Darüber erwachte dann endlich auch mein Mann.
Das nächtliche Erlebnis hat mich jedenfalls echt mitgenommen. Weil ich danach richtig schön wach war, nutzte ich die Zeit und setzte mich an meinen Schreibtisch. Zustande gebracht habe ich eigentlich nichts, weil sich kurz nach vier meine Kaffeetasse in die Tastatur ergoß. Es dauerte eine Weile, bis ich der Sache Herr wurde.
Obendrein bin ich nun endlich müde. Gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen! 🙂

Während alle Leute heute schön schwitzen und nicht wenige gerade dem Sommer die Krätze an den Hals wünschen – vor allem die, die sich noch nicht in den Urlaub verabschieden konnten – suche ich jetzt für meinen Pubertikel Wintersachen zusammen. Dicke Jacke, Schal, Handschuhe …
Der transpirierende Leser fragt sich: Was soll das? Spinnt der Pubertikel, oder spinnt die Mutter?
Weder noch, liebe Verehrte.
Der Pubi will zum Skifahren.
Jetzt. Heute. In die Skihalle nach Bottrop.
Jedenfalls scheint der Knabe gewachsen zu sein, denn die Winterjacke passt nicht mehr.
Guckt an den Handgelenken Haut raus.
Wie löst man das mitten im Hochsommer?
Ich rufe jetzt erst mal im Rheinruhrzentrum an und frage, ob die bereits Winterfell führen.
Kriegt man denn überhaupt schon Spekulatius?

Ich will Euch das Neueste vom kleinen Melonen-Spermling berichten.
Nachdem es letztens so schlecht um ihn stand, hat er sich stabilisiert.
Er trennte sich zwar wie eine Eidechse von hinteren Teil seines Schwanzes, was eine Amputation nötig machte – doch die schwächte ihn nicht.
(Im Bild zu sehen kurz vor der Amputation)
Weil er Rund-um-die-Uhr-Pflege benötigte, bekam ich ein Problem: Ich musste auf einen Job und wer sollte sich dann um Spermi kümmern?
Mein Mann hätte mir was gehustet.
Eine Leserin schlug vor, ich solle den Kleinen eintopfen und im Tragtuch mitschleppen.
Ich machte nur den ersten Teil, weil auf dem Job da kannten die mich nicht und was sollten die denn von mir denken?
Den Abend und die Nacht hat er jedenfalls gut überstanden, fast macht es den Anschein, als hat das mit seinem Schwanz so kommen müssen.
Leute, ich glaube, die Sterne stehen günstig.
Wir schaffen das!

Leute, ich mache es kurz: Es geht dem Spermling schlecht.
Trotz aufopfernder Pflege wie H2O-Infussionen, Vorsingen und Schwanzwickel scheint er sein Hinterteil abzustoßen.
Man kennt das von Eidechsen. Die haben eingebaute Sollbruchstellen, an denen sie bei Stress den nicht-überlebenswichtigen Teil abtrennen und so verkürzt und wendiger weitermachen.
Der Ausflug zum Mülheimer Bürgeramt ist dem kleinen Spermling demnach doch nicht bekommen.
Gleichzeit bedeutet das aber auch, dass er mit einem Kriechtier gekreuzt ist.
Um sicherzugehen, habe ich Ultraschall machen lassen.
Es könnte sich auch um Plazentainsuffizienz handeln.
Wir werden sehen.
Bitte schließt den Kleinen in Eure Gebete ein.
Ergebenst,
Eure Frau GoodWord nebst Spermling

Es war wieder so weit: Wegen der letzten Regentage war meine Hütte durchgekühlt und es zog mir frisch die Beine herauf. Ab Eisbein bis Kniehöhe wurde mir klar: Ich musste etwas ändern!
Ich hätte die Heizung anschmeißen können – oder etwas backen.
Weil ich aber in den letzten Tagen vom Kinderfernsehen vermehrt das schlechte Gewissen wegen meines CO2-Fußabdruckes eingetrichtert bekommen habe, traute ich mich nicht, Energie zu verschwenden.
Nichtsdestotrotz fror ich – warme Gedanken allein reichte nicht aus.
Da erinnerte ich mich meines letzten Ausflugs zum Mülheimer Bürgeramt. Dort war es schön warm und für Unterhaltung war auch gesorgt.
Ich packte mir also geschwind ein Frühstück zusammen: ein Butterbrot mit Schinken (Verzeihung, aber ich will es mit der nachhaltigen Lebensweise nicht gleich übertreiben!) und ein paar Scheiben Melone. Auch eine Flasche Wasser vergaß ich nicht.
Dann schwang ich mich aufs Rad und sauste in die Stadt.
(Sie sehen, ich mache durchaus ernst!)
Unauffällig drückte ich mich im Bürgeramt am Empfang vorbei und huschte in die Kinderecke. Dort saßen schon zwei Konvertitinnen mit ihren insgesamt vielen Kindern.
Die eine brüllte zur Begrüßung auch gleich los: „Wer von euch Rotzlöffeln hat mir denn hier die angelullte Brezel in die Tasche gesteckt??“
„Das ist die vom Dschäiden.“
„Dich habe ich nicht gefragt, Schantall!“
Weitere Kinder mischten sich ein, ich verlor aber den Überblick, weil die Namen der jüngeren Kinder fremdländisch klangen.
Wo die nun einmal alle vom Essen redeten, verspürte ich plötzlich auch Hunger. Ich packte meine Brotzeit aus und setze mich dazu. In Gesellschaft isst es sich besser.
Das Brot schmeckte, anschließend zog ich meine Vitaminbeilage hervor.
Wie ich die so aus ihrer Klarsichtfolie schälte, guckte mich plötzlich ein einzelnes verirrtes Spermium an!
Erst war ich mal erschrocken!
Ein Melonenspermling!
Wo kam der denn her?
Was wollte der hier?
Aber noch viel wichtiger: Was machte ich jetzt mit ihm?
Ängstlich guckte mich der Kleine an.
„Keine Sorge, ich esse dich nicht …“, beruhigte ich ihn und steckte ihn vorsichtig in sein Melonenstück zurück. Ich wollte ihm ja nicht versehentlich den Schwanz abbeißen.
Sofort kuschelte er sich unauffällig in eines der Obstlöcher.
Der Appetit war mir allerdings vergangen, ich trug ja jetzt Verantwortung!
Da ich auch nicht mehr fror und relativ ausgewogen gegessen hatte, machte ich mich auf den Heimweg – beim Radfahren kann ich außerdem prima nachdenken.
Schwitzend, weil ich muss fast die ganze Zeit bergauf strampeln, kam ich daheim an.
Jetzt sitze ich hier mit dem Sperma am Laptop und überlege, wie ich ihn weiterzüchten soll.
Pflanze ich ihn raus … oder kaufe ich ihm lieber noch eine Melone?
Können Sie mir da helfen?

Eben beschwerte sich ein Freund via Whatsapp bei mir.
Thematisch handelte sich bei seinem Problem um eine Unabänderlichkeit und eigentlich wollte er nur Dampf ablassen.
Er gebrauchte in seinem kurzen Text auch zwei Kraftausdrücke, was mir den Ernst der Lage aufzeigte.
Um ihn aufzumuntern und auch um ihn in seiner Ansicht zu bestärken, schickte ich ihm ein Zitat: „Das Leben ist nur im Suff zu ertragen.“
Jetzt frage ich Sie: Wissen Sie, wer das gesagt hat?
Ich wusste es jedenfalls nicht und probierte es mit Lenin. Dem schiebe ich im Zweifel alles in die Schuhe.
Ich tippe also ‚Lenin‘ in mein Handy: Kennt den die Autokorrektur nicht.
Oder traut es ihm vielleicht auch inhaltlich nicht zu.
Stattdessen verbessert mein Freund und Helfer-Autokorrektur: Kevin!

Nachdem wir hier letzte Woche so schön mein Alter thematisierten, haben die mir heute beim Orthopäden den Rest gegeben.
Aufgesucht habe ich ihn, weil mich mehrmals im Jahr Rücken plagt. Im Winter mag das angehen, aber wenn es so heiß ist wie derzeit, macht es sich nicht gut, mit Heizkissen am Schreibtisch zu sitzen. Genaugenommen blockiert das Wetter eh schon mein Denkzentrum.
Der Orthopäde hörte sich also meine Beschwerden an, er wiegte den Kopf und schickte mich erst mal zum Röntgen.
„Frau Müller, kommen Sie bitte in die Röntgenkabine!“, tönte die Lautsprecherdurchsage.
Ich trat da also ein, begrüßte mich so ein junges Ding: „Schwanger sind Sie nicht?“
Auf den verbalen Schreck musste ich mir erst mal Luft machen: „Gute Frau, Sie sind wohl nicht ganz gescheit?“
„Wieso? Sie sind doch noch jung“, sagte meine neue, allerbeste Freundin.
„Dankesehr!“ Ich hätte sie auf der Stelle küssen können. Oder einen Urlaub spendieren, je nach dem.
„Schauen Sie doch mal in die Zeitung!“, fuhr meine neue Herzallerliebste fort.
Mich wunderte das. „Was hat die Zeitung damit zu tun?“ Normalerweise weiß ich vorher, wenn ein Artikel über mich erscheint.
„Na, wer heutzutage so alles Kinder kriegt … Da werden 65-jährige Mutter.“
Mädel! Die soll zusehen, wen sie anruft, wenn es ihr schlecht geht! So schnell können junge Sympathien umschlagen.
Ich hatte die Episode gerade verdaut, wurde ich zum Herrn Doktor hereingerufen: Das Röntgenbild besprechen.
„Wie Sie sehen“, er zeigte auf den Monitor mit dem Abbild meines durchfunzelten Bodys, „schaut das soweit gut aus.“
Hätte er das Soweit nicht weglassen können?
„Sie sehen hier den altersbedingten Verschleiß.“
Hä? Was ist los??
„Bis auf das hier …“
Leider war ich für Bis-auf-was-hier zu abgelenkt. Erst ab ‚Krankengymnastik‘ konnte ich wieder folgen.
Eines ist jedenfalls klar: In dem Laden da können die mich mal!
Da gehe ich so schnell nicht noch mal hin!

Ich habe ja schon seit einer Woche Rücken.
Immer erst ab Nachmittag – das ist aber genau so scheiße, als wenn es gleich früh los ginge.
Weil ich meinem Umfeld damit mal mehr und mal weniger auf den Sack gehe, machen die sich auch während ihrer Arbeitszeit Gedanken, um mir Erleichterung zu verschaffen.
So vorhin geschehen, kurz vor Feierabend.
Ein nahestehender Mensch schickte mir aus dem Büro einen Link zum Artikel eines Nachrichtenmagazins: Sparte Gesundheit und Ratgeber, Titel: „Lindern Sie Ihre Rückenschmerzen sofort – ohne Medikamente!“
Aufgeregt klickte ich den Artikel an.
Im Geiste sah ich mich schon wieder wie ein junges Reh Bocksprünge über meinen Schreibtisch machen.
Das lag vor allem am strategisch klug gewählten Bildmaterial: Zwei kehrseitig abgelichtete schlanke Jungmädchenschönheiten, die sich sexy ins Hohlkreuz beugten und dabei theatralisch mit den Händen das Corpus delicti stützten. Lange Haare reichten attraktiv bis zu den frischmanikürten und leicht gebräunten zarten Händen …
Da fühlte ich mich doch gleich besser.
Weil so sehe ich ja auch aus.
So, und dann las ich los.
Ich fasse die, Zitat: „alltagstauglichen Sofortmethoden“ mal zusammen:
Abschalten, Füße hochlegen, danach heiß duschen und mit Tennisbällen in der Badewanne herumrollen, gute Musik hören und spazieren gehen – aber um Himmels Willen nicht auf der Straße!
Mit Verlaub, Frau Redakteurin, so wird das nichts.
Sie hatten wohl noch nie Rücken, oder?
Ich nehme mir jetzt ein heißes Kissen – auch damit ich nicht friere – und dann jammere ich noch ein bisschen rum.
Das lindert!
P.S. Ich wünsche allen Leidensgenossen da draußen gutes und frohes Genesen! ❤

Ich habe ja aufgehört, zu zählen, wie lange ich mir aus Temperaturgründen schon versagt habe, Weihnachtsplatzerl zu backen. Bestimmt schon drei Tage, oder auch eine ganze Woche.
Geflügelklein brachte heute aus der Schule einen Zettel mit nach Hause: Hitzefrei für den Rest der Woche.
Also mache ich gute Mutter auch hitzefrei und das Licht an meinem Schreibtisch aus.
Das freut meine Partner unheimlich, zumal sie das erst aus dem Post hier erfahren.
Heute haben sich schwitzende Mutter und nörgelndes Kind jedenfalls auf den Weg zum See gemacht.
Durch den Wald, da war es auch schön frisch.
So frisch, dass die da doch glatt Schneewarnungsschilder aufgestellt haben! 
Schaut echt zum Fürchten aus, oder?
Mann, was bin ich froh, dass ich meine Ski vor der Haustür stehengelassen habe!
Genau wie Ihr gesagt habt: Man kann echt nie wissen!
Na, Leute, ist es schön warm?
Schwitzt Ihr schön?
Bei mir teilen sich die Viecher in die Schattenplätze.
Der Hintere, dachte ich eigentlich, sei Kater Bruno.
Ist er aber nicht.
Das Herrchen, das gar nicht Brunos Herrchen ist, erklärte, er kenne den Plüschpuschel nicht.
Wenn der also keinem von Euch gehört: Er darf gern bei mir bleiben, er guckt mir fast jeden Vormittag bei der Arbeit zu. Irgendwann kann er sie dann sicher übernehmen.
Haut rein, Leute, und lasst Euch nicht unterkriegen!

Ich glaube, ich werde alt. Neben anderen Indikatoren merkt man das vor allem daran, weil ich mich mit dem Wetter beschäftige.
Sie erinnern sich: Letzte Woche zog es frühsommerlich frisch durch Mülheim und ich buk Weihnachtsplatzerl. Als es nicht wärmer wurde, wärmte ich mich extern bei Mülheimer Behörden. Das war auch alles ganz schön, ich lernte viel Neues dazu.
Gerade schaue ich wieder nach der Wetterprognose. Man will ja wissen, was einen Montag erwartet. Ich halte das für wichtig, jetzt da das allerletzte lange Feiertagswochenendes des Jahres zu Ende geht und der Endspurt auf die großen Ferien ansetzt. Businesslike oder Funktionskleidung? Wenn ich friere, kann ich schlecht denken – wenn ich schwitze das Gleiche.
Morgen wird es jedenfalls verdammt heiß: 31 Grad für Mülheim!
Ob ich mal meine Ski wegräume?
Habe ja heute Zeit.
Schneit doch in der nächsten Zeit nicht, oder?
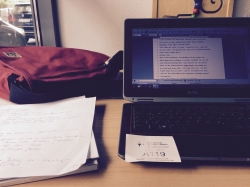
Wissen Sie was? Ich finde es immer noch frisch in Mülheim. Nun kann ich aber nicht jeden Tag backen, deshalb hab ich mir heute einen anderen Platz zum Wärmen gesucht. Ich sitze im Bürgeramt. In der Kinderecke. Hier ist es schön heiß, die Fenster lassen sich nicht öffnen; deswegen oder aus anderen Gründen klebt der Tisch.
Trotzdem bleibe ich hier im Gewächshaus sitzen, weil da wo sich die Ausgewachsenen aufhalten, will ich nicht hin!
Unterstellen wir, im Mülheimer Bürgeramt warten nur Mülheimer Bürger. Der Bürger, auf den ich freie Sicht habe, weil ihn nur ein Raumteiler aus Glas von mir trennt, popelt. Genüsslich bewirtschaftet er mit dem kleinen Finger eines seiner Nasenlöcher. Endlich wird er fündig, er pult einen Brocken heraus. Zuerst beguckt er sich das Ding von allen Seiten, dann schnipst er es in in den Mülleimer. Der Plumps ist nicht zu überhören. Anschließend wischt er den Nagel an seiner Hose trocken.
Während ich das gerade verdaue, versenkt er den kleinen Finger bis zum Anschlag im anderen Kanal.
Mir ist noch nicht klar, was ich mir wünsche: Soll der besser vor oder nach mir aufgerufen werden …?
Bin ich nach ihm dran, laufe die Gefahr, dass ich mich wo reinsetze. Bleibe ich noch ewig hinter ihm sitzen, könnte es sein, dass er mich trifft.
Ich bin unentschlossen, Sie merken es.
Noch runde dreißig Nummern vor mir, ich bin die 119.
Ich verabschiede mich jetzt und überdenke meine Prioritäten!
Geht doch nichts über ein Sonntagsfrühstück unter freiem Himmel!
Dabei werden natürlich auch die Viecher bedacht.
Der kleine Amseljunge ist immer noch Vegetarier, er bekam seine Portion Apfelgriebs in den Komposthaufen. In letzter Zeit schmecken ihm unreife Felsenbirnen besser, weswegen die Apfelration heute kleiner ausfällt.
Kennt Ihr Felsenbirnen?
Mit Birnen haben die nicht viel gemein. In der Größe und Form von Heidelbeeren wachsen sie an Bäumen, lediglich das kernige Innenleben erinnert an eingeschrumpfte Birnen. Alles eben viel kleiner, wie auf magerem Fels gewachsen.
Schmeckt nicht nur Viech, geht auch für uns. Man frisst sich halt dran hungrig.
Aber wir füttern auch Kriechtiere, wie man sieht. Meine Anverwandten haben alle ein gutes Herz. Eigentlich war ich auf der Suche nach der Tasse rechts im Bild.
Kaffee mögen Schnecken offensichtlich nicht.
Das macht nichts – ich dafür um so mehr.
Doch zuerst gucke ich der Schnecke noch eine Weile zu …
Genießt den Sonntag, Leute!

So, Leute, heute Tag 2 des unerwarteten Kälteeinbruchs.
Was tut man?
Man friert – oder man backt.
Backen haben wir gestern schon erledigt, heute verzieren wir die Reste.
So richtig lohnt sich das nicht mehr, aber es wärmt.
Alternativ ließe sich natürlich auch die Heizung nutzen.
Mir ist schon voll weihnachtlich ums Herz …
Lasst es Euch nicht kalt und die Zeit nicht lang werden! 🙂

Wie mir ja bereits gestern Abend während meiner unnötigen Pausenbrotschmiererei klar wurde, verleben wir heute einen Ferientag. Einen einzigen nur, Pfingstferien genannt. Zusammen mit ein paar anderen Bundesländern leistet sich NRW den Luxus, einen Einzeltag Ferien zu nennen. Wenn man bedenkt, dass zum Beispiele bayerische Schüler gerade zehn freie Tag vergammeln, lässt das nur zwei mögliche Schlüsse zu: Entweder haben es Schüler aus NRW besonders nötig durchgängig weitergebildet zu werden – oder wir überholen die Bayern links.
Nichtsdestotrotz ist mir das Politikum egal, für mich gilt das Gleiche wie für alle bundesweiten Mütter: Macht das Beste aus den Ferien!
Ich überlasse also meinen Schreibtisch heute einer erweiterten Feiertagsruhe und kümmere mich stattdessen um das kleine Flatter.
Pünktlich zum Großereignis Pfingstferien, öffnete Petrus die Schotten und schickte zusätzlich ein wenig arktische Kälte an den Rand des Ruhrgebiets. Am Nachmittag soll es gleich noch stürmen, mal sehen.
Wir bleiben heute einfach drinnen!
Was tut man mit einem solch unerwarteten Kälteeinbruch?
Richtig, man backt Weihnachtsplätzchen!
Lasst Euch von einer erfahrenen Mutter gesagt sein: Man kann nicht früh genug damit starten.
Wie lange dauert es eigentlich noch?
Bemehlte Grüße und bringt den Tag gut rum,
Eure Frau GoodWord

Ich bin doch echt durcheinander.
Vitamine und ein Butterbrot: Bin gerade dabei, dem Kleinen für morgen Frühstück zu schnippeln.
Dabei sind morgen Ferien!
P.S.: Ja, ich mache das immer am Vorabend. Schmieren, verpacken – zack, in den Kühlschrank damit.
Außer heute.
Das ess ich jetzt gleich selber!
Kauend,
Gott zum Gruße

Ich bin ja nun auch schon Ü40. Normalerweise entfällt mir das, aber es gibt Momente, wo ich danach gefragt werde. So auch geschehen letzte Woche. Dies nur zur Erläuterung, warum ich mich im Moment des Alters entsinne.
Aber trotzdem, um die Altersfrage noch zu spezifizieren: Genaugenommen befinde ich mich auf der Hälfte zum halben Jahrhundert, auf den Tag exakt. Da bleibt es nicht aus, dass ich mir die ein oder andere Falte gelacht habe.
Jetzt ist mir gestern in der tropischen Sommernacht was passiert, daran muss ich Sie als Anti-Aging-Experten einfach teilhaben lassen. Hat mich doch eine Mücke mitten aufs Augenlid gestochen! (Das Mistvieh!)
Zuerst juckte die Sache fürchterlich. Im zweiten Schritt schwoll mir das Auge schlitzig zu. Mein Mann war besorgt, was die Nachbarn davon halten würden – zumal es sich plötzlich blaulila einfärbte. Kurz nach Mitternacht brachte er mir deswegen das Aloe-Vera-Gel aus dem Kühlschrank.
Ich patschte das stinkende Zeug großzügig aufs Lid, der Abend war eh beendet. und legte mich zufrieden ins Bett.
Gejuckt hat es nicht mehr, an die Nacht habe ich keine wachen Erinnerungen.
Das glauben Sie nicht, wie ich heute aussehe!
Glatt!
Wie zwanzig!
Oder jünger.
Leider nur einseitig.
Wenn Sie also ein wichtiges Date haben, die Damen: Setzen Sie sich am Vorabend einfach neben einen Eimer schlupfbereiter Mückenlarven! Das wirkt todsicher!
Herzlichst,
Ihre Frau GoodWord

Clara meint, wenn ich ein Bild in einen Kommentar einfügen will, muss ich es in einem Beitrag hochladen, dann die URL kopieren und in den Kommentar einfügen.
Das probiere ich jetzt, ich will ihr einen Lavendel schenken. Einen lilanen Stimmungsheller. Zwar schon ein bisschen mitgenommen, weil in die … Wochen gekommen, aber er ist lila und er gibt nicht auf.
Falls ich das jetzt doch versehentlich öffentlich übe, hier vorsorglich die Erklärung.
Man sieht: In Mülheim regnet es.
Schönen Sonntag zusammen! 🙂

Damit es nach den Tollen Tagen in Mülheim an der Ruhr auch fröhlich weitergeht: Heute, 19:30 Uhr, Cafè Mocca Nova, Löhberg 16! 🙂

Wie in vielen anderen Familien auch, hat bei uns in den letzten Tagen dieser Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch anständig für Diskussionen gesorgt.
Wer es trotzdem nicht mitbekommen hat, hier noch mal der Gesetzestext zur heimischen Gesprächsgrundlage:
„§ 1619 – Dienstleistungen in Haus und Geschäft
Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.“
Sieben Stunden Hausarbeit für 14-jährige seien angemessen, so der Bundesgerichtshof.
Bleibt mir nichts weiter, als Ihnen für daheim frohes Streiten zu wünschen! 🙂
Herzlichst
Ihre Frau GoodWord
Seit einer Weile schreibe ich an der Fortsetzung von MAMA, BLEIB MAL IM SLIP. Die Storys sind was länger, die Kinder auch. Gerade sitze ich an einer rutschig, glitschigen Geschichte über Regenwürmer.
Von denen gibt es übrigens 670 bekannte Arten. Haben Sie das gewusst?
Bis gestern war für mich ein Regenwurm ein Regenwurm. Gibt eben Große und Kleine, Dicke und Dünne – alles wie beim Menschen.
Wohl damit die Fortpflanzen später nicht so dumm daherreden wie die Mütter, behandeln sie die ringelige Artenvielfalt jetzt in der Bildungsanstalt.
Keine Frage, dass die Thematik im Haus für Verwerfungen sorgt …
Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird, seit MAMA, BLEIB MAL IM SLIP im Dezember erschienen ist, lautet: „Was sagen eigentlich Ihre Kinder zum Buch?“
Oberflächlich sind beide mit der Antwort schnell fertig. Geflügel gefällt das, vor allem wegen seiner Kuscheleule und weil Meersau Eddy jetzt berühmt ist. Für Pubertikel verhält sich die Sache so: „Wehe, einer meiner Kumpel spricht mich darauf an, Mutter!“
Geht man in die Tiefe, verschiebt sich die Interessenlage allerdings. Plaudern wir mal aus der Nähkiste:
Gestern Abend hockte Mutter an Facebook und jammerte: „Meine Businessseite kackt immer mehr ab …“
„Was macht die??“ Geflügel war so schockiert, dass ihm das Leberwurstbrot aus der Hand klatschte.
„Die hatte mal 1038 Fans. Jetzt sind es nur noch 999.“
„Gute Zahl“ Pubi rührte in seiner Muslischüssel und stierte dabei aufs Handy.
„Du machst ja auch nichts mehr dran. Du schreibst nur noch Bücher.“ Mit dem Zeigefinger schmierte Geflügel ein Herzchen in die Leberwurst. „Ich mag das nicht. Du hattest in den Ferien keine Zeit für mich“, beschwerte es sich. „Mach lieber wieder Facebook!“
„Facebook ist aber brotlos.“ Ich klappte den Laptop zu und setzte mich zu den Kindern an den Tisch.
„Na und?“ Das Kleine schleckte die Wurst vom Finger. „Schmeckt mir auch so.“
„Mir ist lieber, sie schreibt noch ein Buch“, meldete sich des Youngsters Stimme aus dem Körner-Off. Zu sehen war er nicht. „Meckert sie weniger rum. Und mehr Taschengeld will ich auch!“
Ich will Euch mal was zeigen. Gleich im 1. Kapitel von „MAMA, BLEIB MAL IM SLIP“ geht es um eine Geburtstagstorte. Damit sie es schön frostig hat, sollte der hauseigene Pubertikel sie in den Vorratskeller verbringen. Nun ist das mit der Pubertät ja so eine Sache. Man hört schlecht zu, denken klappt auch nicht so ganz und im Übrigen weiß man sowieso alles besser.
Ende vom Lied: Die Torte landete im Gästeklo. Unter dem tropfenden Wasserhahn.
Voilà! 🙂

Mit diesem tollen Porträt in der NRZ und in der WAZ verabschieden wir uns in die Weihnachtspause! 🙂
Wir wünschen Euch Frohe Weihnachten und eine tolle Zeit – und vergesst nicht: Nehmt das Leben mit Humor! ❤
http://www.nrz.de/staedte/muelheim/humor-als-erziehungsratgeber-id209057143.html
http://www.waz.de/staedte/muelheim/humor-als-erziehungsratgeber-id209057481.html


So, Ihr Lieben! Gestern hatte ich Euch ja für Heute hatte ich Euch ja die Renzension zum Buch “Mama, bleib mal im Slip” der wunderbaren Frau Goodword versprochen! Allerdings hatte ich erst andere Dinge zu tun. Zunächst einmal musste ich Herrn L. davon überzeugen, trotz interessanter Finanzlage den nächsten Kindergeburtstag im Indoor-Spieleparadies stattfinden zu lassen. […]
über Sie hat es geschrieben – und ich habe es gelesen!!!! — Von der Uni an den Herd
Es ist schon eine Weile her, dass es hier neue Geschichten um Pubertikel, Geflügel und deren Erziehungsverpflichtete zu lesen gab. Das hatte auch einen guten Grund: Chronistenmutter schrieb nämlich ein Buch!
Und weil das ein großes Stück Arbeit war und ziemlich lange dauerte, verkündet sie Euch jetzt stolz: Es ist so weit! Ab 9. Dezember gibt es jede Menge Lesestoff!
Neue Geschichten, alte Geschichten und das alles im schmucken Kleid.
Anke Müller: „Mama, bleib mal im Slip“, ISBN 978-340460927, 256 Seiten
Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen!
Ich will die Gemeinde nicht im Unklaren lassen: Die VisitorIn zieht weiter. Auf Dauer wird ihr das bei uns zu langweilig, hat sie gesagt. Immer brav sein sei nichts. Und den Kürbis – gut, an dem könne sie kaum vorbeigucken.
Ich kann ihr Dilemma verstehen, immerhin habe ich Kinder.
Wir besprachen also die möglichen Reiseziele, erstellten daraufhin gemeinsam eine Packliste und zum Schluss suchten wir im Internet nach anständiger Begleitung. Man darf nämlich nicht vergessen, dass die VisitorIn zu den Minderjährigen zählt. Am Freitag geht es los, da starten die Herbstferien.
Als ich ihr sagte, sie solle unterwegs mal eine Karte schreiben und mein Garten stünde ihr immer offen, stürzte sie sich auf mich und küsste mich temperamentvoll.
Ich werde mich jetzt nicht mehr waschen!
So angenehm das neue Leben mit der ausgetauschten VisitorIn ist; wir wollen die alten Schandtaten nicht vergessen. Nehmen wir zum Beispiel meine Kürbispflanze. Mein Mann und ich essen unheimlich gern Kürbissuppe. Pubertikel und Geflügel bekommen zwar das große Kotzen – aber das ist uns Alten egal. Nach drei Jahren Bedenkzeit rang ich mich zu einer eigenen Zuchtpflanze durch. Um eine gescheite innere Verbindung zwischen uns aufzubauen, kaufte ich nicht etwa das fertig ausgebrütete Pflänzchen im Topf, nein, ich zog selber an! Aus einer Tüte mit sechs Kernen ging ein einziges kräftiges Pflanzenkind hervor. Das sollte es sein! Ich hegte es und goss und jätete, es sollte dem Kleinen an nichts fehlen: Der Grünling war mein drittes Kind.
Er dankte es mir und steckte zu meiner Freude täglich eine neue gelbe Blüte auf.
Doch über jeder Nacht verschwand die Blüte wieder. Bis auf den Strunk. Mein Kürbisnachwuchs mühte sich redlich, wochenlang.
Er tut es immer noch, doch nicht einer einzigen Frucht gelang es, der VisitorIn und ihrer Mischpoke zu strotzen.
Nun sieht es Ende September so aus, als wenn es dem ersten Bällchen gelänge, dem Blütenstadium zu entwachsen …
Schauen wir mal, was der Winter dazu sagt!
Meine freche VisitorIn war spazieren gewesen, sie war die Straße abgewandert, Sie erinnern sich. Nirgendwo in der Nachbarschaft gefiel es ihr so gut wie bei uns – und sie kam reumütig und kleingeschrumpelt zurückgerutscht. Es kostete mich viel Mühe, sie wieder aufzupäppeln und herzurichten.
Die Wanderschaft hat sie verändert. Sie ist jetzt anständig und höflich und fragt vorher. Meine Blumen lässt sie in Ruhe, ebenso den Schnittlauch und was sonst per Frühlingseinsäung bei uns wachsen sollte. Könnte aber auch daran liegen, dass ihre ganze Bagage über den früheren Fressgelagen bis runter zum Wurzelwerk nichts stehenließ.
Auch in Geflügels Suppentopf macht die Visitorin eine gute Figur. Ist sie nicht wieder prächtig und sportlich obendrein?

Ich hatte die VisitorIn ja letzte Woche zum Nachbarn geschickt, Sie erinnern sich. Als ich ihn später auf der Straße traf, erzählte er, sie wäre ihm ebenfalls zu rüpelhaft gewesen und er hätte sie deshalb auch weitergeleitet. Danach hörten wir nichts mehr. Weder diesseits noch jenseits der Straße berichtete jemand von der Besucherin.
Bis heute Morgen. Jetzt schauen Sie sich an, wer mir eben hintenrum durch den Garten und ziemlich ausgemergelt entgegenkam!

Ich werde sie jetzt erst mal aufpäppeln und dann sprechen wir noch mal.
Vorhin blökte die Schelle. Die Post kommt heute früh, dachte ich und verließ meinen Schreibtisch. Erwartungsfroh riss ich die Haustür auf – da bin ich fast draufgetreten!  Sie hat was genuschelt, ob der Soundso hier wohnt und wollte an mir vorbei. Habe ich nur mit dem Finger gedroht. Daraufhin hat sie den Kopf geschüttelt und den Pfad zum Nachbarn eingeschlagen. Na, der wird sich freuen!
Sie hat was genuschelt, ob der Soundso hier wohnt und wollte an mir vorbei. Habe ich nur mit dem Finger gedroht. Daraufhin hat sie den Kopf geschüttelt und den Pfad zum Nachbarn eingeschlagen. Na, der wird sich freuen!

Im Kinderzimmer werden letzte Vorbereitungen für das Spiel getroffen.
Auch was das Wetter betrifft. 🙂

„Damit du klarsiehst, Mutter“, rauschte mein Pubertikel letzten nach der Schule gut gelaunt in die Küche: „Demnächst brauche ich einen Anzug!“
Vor Schreck platschte mir eine Bockwurst in den Suppentopf. „Was brauchst du?“
„So ein Spießerding wie der Vatter hat. Weißt schon: in gleiche Farbe ’ne enge Jacke zur hässlichen Hose.“
Ich ließ die nächste Wurst fallen. „Was willst du denn damit?? Willst du künftig im Anzug zur Schule?“
„Quatsch, Mutter! Für den Abschlussball.“
„Wie viele Jahre hat das noch Zeit?? Da kauf ich dir doch jetzt noch keinen Anzug für!“ Der sollte erst mal zusehen, dass er das Schuljahr schaffte, an Abitur war noch lange nicht zu denken.
„In fünf Wochen brauch ich den!“
„Alles klar.“ Ich hantierte wieder mit der Suppe.
„Ohne Scheiß“, Pubi war klar, dass „Alles klar“ nicht bedeutet, dass etwas klar ist. „In Sport machen wir gerade Tanzstunde.“
Warum sagte der Junge das nicht gleich. „Da langt sicher auch ein Sakko.“
„Nein. Ich habe nur Jeans und die sind verboten. Kannst du auf dem Zettel nachlesen.“
Kräftig Spesen, toll.
„Schuhe brauche ich übrigens auch. Turnschuhe sind ebenfalls verboten.“
Das wurde ja immer besser. „Musst du da wirklich hingehen …?“
„Logisch!!“ Pubi legte direkt noch ein paar Längenzentimeter zu. „Und ich nehme einen richtig schicken Anzug!“
Ich hatte mich wohl verhört. „Wieso bist du denn so scharf auf so ein Ding?“
„Ein Anzug sieht voll gut aus! Den zieh ich dann auch zum Gammeln an.“
Meine Suppe war fertig und ich beschloss, die Sache an mich herankommen zu lassen. Eine Woche verging, eine zweite, Ende der dritten fragte Pubi mitten im Tatort-Trailer: „Hast du meinen Anzug besorgt?“
„Bürschlein“ – Im Youngsterkopf haust ein sonniges Gemüt – „Den Anzug kann ich nicht einfach bestellen. Da müssen wir für in ein Geschäft. Der muss sitzen, sonst sieht es bescheuert aus.“
„Blöd aussehen will ich nicht“, stimmte Pubi zu. „Fahren wir gleich? Ich hätte jetzt Zeit.“
Entgegen diesem Vorschlag warteten wir mit der Anschaffung bis zu den Ferien.
Ostersamstag, wir besuchten die Großeltern. Die Uhr zeigte halb elf und wir hockten bereits seit einer Stunde am Frühstückstisch. Allein Pubi fehlte.
„Geh mal deinen Bruder wecken“, stellte mein Mann Geflügel an.
Geflügel flatterte los. „PUBI!“, kreischte es und stieß die Tür zur Schlafkammer auf. Während die Tür gegen den Schrank krachte, brüllte es dem schlafenden Jungen ins Ohr: „AUFSTEHEEEEN!“
Pubi muss das ziemlich mitgenommen haben, denn etliches später erschien er mächtig schlecht gelaunt am Frühstückstisch.
„Was macht ihr wegen dem scheiß Anzug für einen Stress?“ Er schnüffelte angewidert an Omas selbstgemachtem Quittengelee. „Nicht mal was Gescheites zum Frühstück gibts.“
Meine Mutter vertrat die Hausoma-Ehre: „Ich geb dir gleich was Gescheites!“
Mein Mann, der mittlerweile in der Tageszeitung badete, tauchte kurz auf und knurrte: „Ich brauch keinen Anzug.“
„Ich auch nicht“, knurrte Pubi zurück.
„Dann bleiben wir hier“, jubelte Geflügel, „weil ich brauch auch keinen.“
„Übrigens …“, mein Mann legte die Zeitung beiseite: „Mein Tanzstundenanzug ist wieder richtig modern. Kurze Jacke und mega Schulterpolster …“ Er schwelgte in Erinnerungen. „Wo ist der eigentlich?“
„Bei den Faschingskostümen“, sagte ich.
„Könnt ihr vergessen, dass ich ein Faschingskostüm anzieh!“, regte sich Pubi auf. „Ich will sowieso nicht zu dem blöden Ball. Ich hab nur wegen der Mutter ‚Ja‘ gesagt!“
„Hä?“, ich hörte wohl nicht richtig. „Meine Idee war es nicht, dass du zum Abschlussball gehst. Das wolltest du selber!“
„Einen Scheiß wollte ich! Du hast gesagt, dass ich zu allen schulischen Veranstaltungen hin muss!“
„Hat die Mama nicht“, mischte sich Geflügel ein. „Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Die Mama wollte mir Essen kochen. Dann kamst du nach Hause und die Mama hat mich vergessen. Ich wäre fast verhungert!“ Jetzt weinte es beinahe, so lebensnah erinnerte es sich.
„So schnell geht das mit dem Verhungern nicht.“ Pubi zog das Schwesterchen auf seinen Schoß. „Die sollen nicht immer mitten in der Nacht auf mich einquatschen, das könnten die sich langsam mal merken.“ Er drückte das Kleine. „Ich krieg dann immer ganz schlechte Laune.“
„Ich mag es, wenn die Mama auf mich einquatscht …“, sagte Geflügel.
Pubi grinste. „Du bist ja auch ’n dicker Wicht.“
Als die Sirene leiser wurde, fragte meine Mutter:
„Wann fahrt ihr eigentlich wieder?“
Wir schafften es an diesem Samstag dennoch, zu dritt in die nächste Stadt zu fahren. Wissen Sie eigentlich, wie schwierig es ist, einen Anzug für einen Heranwachsenden zu kaufen? In den gängigen Klamottenlägern der Jugend gab es keine. Am Ende landeten wir im Kaufhaus. Gut sortiert, und vor allem genügend Farbauswahl beim Modell Bohnenstange. Pubi zog ein dunkelblaues Jackett über, doch es baumelte wie ein Vorhang.
„Mach dich gerade!“, sagte die Verkäuferin und pikste Pubi ins Hohlkreuz. Mein Pubertikel straffte sich und siehe da: Das Jackett gewann augenblicklich Form und schmiegte sich an. Was ein adrettes Kerlchen!
Neben uns ein zweiter Tanzstundenkandidat. Der hatte allerdings weniger Glück: Einen Kopf kleiner als Pubi und das hellgraue Sakko, welches ihm seine Mutter von der Stange holte, in Heinz-Erhardt-Größe. Eine Verkäuferin sprang hilfreich dazu, doch Mutter Erhardt schickte sie dankend fort.
Unsere Verkäuferin grinste und schob Pubi in die Kabine. „Dreh dich vor dem Spiegel, hier ist das Licht besser.“
Sie reichte Pubi eine Hose. „Kann sein, dass die ein wenig kurz ist, wir wollen zuerst nach der Weite schauen.“
Weil meinem Pubi so gut wie nichts peinlich ist, kümmerte es ihn auch nicht, dass der Vorhang offen stand. Wie eine Bauchtänzerin wand er sich und versuchte, seine schmalen Hüften in die Hose zu schrauben. Dabei fluchte er leise: „Die scheiß Hose ist viel zu eng …“
„Mach den Knopf auf, Mensch!“, knurrte ich.
„Ich habe noch nie einen Knopf aufgemacht“, bekannte mein Pubi stolz.
Erhardts betraten die Kabine nebenan. Der Junge trug immer noch das Riesenjackett und auch der Vater steckte mittlerweile in einem Kartoffelsack. Mein Mann guckte irritiert von seinem Smartphone auf. Während Pubi sich noch in seine blaue Buxe wand, bekam das fremde Pubertikel eine schwarze Hose angereicht. Leider konnte ich nicht sehen, wie er es mit dem Hosenknopf handhabte, der Junge war schamhaft.
„Hast du eigentlich Schuhe?“, fragte die Verkäuferin.
„Ja, drei Paar“, antwortete Pubi. „Aber die darf ich nicht anziehen.“
„Ich habe da noch ein Paar richtig Coole!“ Die Verkäuferin zwinkerte ihm zu und verschwand.
Der Vorhang der Nebenkabine ratschte auf und das Zwergpubertikel mit der Riesenjacke trug jetzt zusätzlich eine Riesenhose. Ich musste plötzlich fürchterlich husten und setzte mich auf den nächsten Stuhl.
Der Junge schaute unschlüssig, während seine Mutter fachmännisch an ihm herumzupfte: „Ist genügend Saum drin, da kann man noch etwas herauslassen.“ Sie zog ihm wie einer Vogelscheuche die Arme breit. „Nicht dass der Anzug schnell zu klein wird.“
Just während ich mich wieder einkriegte, kam die Verkäuferin mit einem Paar schwarz glänzender Lochlederschuhe mit lila Schnürsenkeln zurück.
„Die nehme ich!“, sagte Pubi. „Können Sie gleich meiner Mutter geben!“
„Probier besser erst mal an“, sagte die Verkäuferin.
„Du brauchst sicher auch ein Hemd“, sagte sie, und ging wieder, ohne eine Antwort abzuwarten.
„Und eine Fliege!“, rief Pubi hinterher.
Mein Mann und ich stöhnten und die Verkäuferin grinste.
„Mama“, sagte Erhardts Kleiner, „ich will auch eine Fliege!“
„Nein“, bestimmte die Chefin, „Günter Jauch trägt Schlips.“
Die Verkäuferin kam mit einem echt schicken Hemd zurück und Pubi pellte den Oberkörper. Bis Hemd und Schlips richtig saßen, dauerte es. Mein Pubi stand also aufrecht und obenherum mächtig geschniegelt da.
„So, jetzt probier die Schuhe dazu“, sagte die Verkäuferin und griff hinter sich. Nichts, die Schuhe waren weg. „Wo sind denn meine Schuhe?“, fragte sie die vorbeigehende Kollegin.
„Keine Ahnung“, sagte die, „Ich komme aus der Pause.“
„Das ist jetzt blöd“, sagte die Verkäuferin nach weiterer Suche bedauernd, „das war das letzte Paar …“
„Siehste, Mutter, ich hab doch gleich gesagt, du sollst sie einstecken!“
„Nun reg dich mal nicht auf“, sagte mein Mann, „wir finden schon noch etwas für dich.“
„Gefällt dir dein Outfit?“, sorgte die Verkäuferin für Themenwechsel.
Pubi versenkte weltgewandt die Hände in den Hosentaschen und drehte sich vorm Spiegel. „Super!“, sagte er. „Das behalt ich gleich an!“
„Bloß nicht!!“, sagte ich. „Ich will den Anzug erst nach dem Ball in die Reinigung bringen!“
Als Pubi wieder vertraut in Jogginghose und Turnschuhen dastand und wir zur Kasse gingen, schaute ich noch einmal zurück. Ich wollte nichts vergessen. Vor dem Spiegel dreht sich Zwergpubi Erhardt. Riesenjacke, Riesenhose – und: Riesenschuhe.
Wenn ein Zwergengeburtstag ansteht, gibt es zwei Möglichkeiten: Man verfällt Tage vorher besorgt um den Wohnungsfrieden in Übellaunigkeit oder die Sause findet aushäusig statt. Ganz klar, ich halte mich an letzteren Plan. Wie im Vorjahr buchte ich: 1 x Indoorspielplatz* mit Sack und Pack. Auf der Fahrt griffen Geflügel und seine Gäste eines ihrer liebsten Themen auf, ebenfalls wie letztes Jahr ging es ums Kotzen.
Geflügels Freundin gab den Ring frei: „Neulich musste ich ganz viel brechen.“
„Ins Auto?“, fragte mein Kleines hocherfreut.
„In den Flur“, antwortete die Freundin stolz.
„Ich breche immer im Auto, wenn mir heiß ist.“
Der dritte Bündnispartner ergänzte: „Du hast schon mal bei Amelie auf die Hose gekotzt.“
„Stimmt“, nickte Geflügel und die Freundin komplettierte: „Im Stau war das, als wir zu Nadines Hochzeit fuhren.“
Toll, jetzt ging das wieder los!
„Leute“, mischte ich mich ein, „erzählt aber nicht noch mal von den Kartoffelhappen und den zerkauten Möhrchen! Das konnte ich das ganze Jahr über nicht vergessen!“
Alle hingen kurz ihren Gedanken nach. Plötzlich, nachdem sie sich die Sache mehr oder weniger erneut durch die Köpfe gehen lassen hatten, sagte die Freundin: „Als ich gebrochen habe, hing das Essen in meinen Haaren!“ Sie fächerte ihr langes blondes Haar auf, sodass es bis zum Kumpel auf den Nachbarsitz fiel.
„Wann war das?“, fragte der Kumpel.
„Keine Ahnung … Aber Nudeln hingen drin.“
„Gedrehte?“
„Nein“, sagte die Freundin, „ganz lange Spaghetti.“
„Ess ich total gerne.“
Geflügel fragte: „Und was hat deine Mama gesagt?“
„Habe ich nicht verstanden. Ich musste so laut würgen.“
An der Stelle schaltete ich das Radio ein.
Aber lassen Sie uns thematisch zum Indoorspielplatz vorauseilen!
Selten sehe ich so viele Kinder heulen wie in einer Indoorspielhalle. Dauert sicher nicht mehr lange und solche Plätze werden wegen Grausamkeit gegen das Kindeswohl verboten.
Ich hingegen liebe derartige Spielplätze! Nirgends kann ich so gut arbeiten wie hier. Bierzeltgarnitur mit Sitzpolster und Rückenlehne; ab und an fülle ich Becher mit Sprudel, seltener die Chipsschüssel oder die Apfelschnitzel. Normalerweise ablenkungsfrei, der Lärmpegel bleibt gleich, es ist schön warm und keiner spricht mich an.
Heute allerdings war der Wurm drin. Ständig heulte einer. Los ging es, da hatte ich noch nicht einmal die Schuhe aus. Auf der Rutsche knallten zwei meiner Hänse mit den Köpfen zusammen. Bei einer tropfte danach Blut vom Ohrläppchen, beim Andern von der Stirn. Im Lauf des Nachmittags rollte sich eine Dritte eine Schürfwunde und ein Vierter meinte, sein Kopf würde falschherum draufsitzen. Ständig beschwerten sie sich über den Schimpfwortschatz fremder Kinder – als sie jedoch dazu übergingen, mich auch bei Belangen auswärtiger Kinder zu Hilfe zu rufen, verwahrte ich mich entschieden: „Es ist gut, dass ihr euch um in Not geraten Kinder kümmert. Aber sucht deren Betreuungspersonal. Die kennen sich, von denen lassen sie sich schneller aufheitern.“
Neben meinem Bierzelttisch feierte eine Großfamilie. Das dicke Mädchen trug ein langes Spitzenkleid und hatte die Haare vermittels Lockenstab zu einer kunstvollen Turmfrisur aufgebaut. Genau das Richtige für einen wilden Spielnachmittag. So kam es, dass die dicke Prinzessin ständig plärrte. Mal trat sie sich mit den Knien auf den Kleidersaum und kam nicht vorwärts, ein anderes Mal verhedderte sich ihre Gardine in einer Aufhängvorrichtung des Kletterturms. Die Cousinen waren ähnlich gekleidet und die ganze Bagage fiel durch körperliche Ungeschicklichkeit auf.
Als die dicke Prinzessin wieder einmal plärrend in einem Turm feststeckte, wurde es einem anderen Prinzesschen offensichtlich zu blöd und es warf sich vor den Geschenkeberg der Dicken. Neugierig fetzte das Prinzesschen das bunte Papier von den riesigen Pakete. Erst eins, dann zwei – beim Dritten kriegte das die Dicke in ihrem Rapunzelturm spitz …
Ich sage Ihnen weiter nichts! Sofort kam der Kassenwart des Ladens gerannt. Er fürchtet wohl, ein Gast hätte sich den Hals gebrochen.
Eben wollte er sich beruhigt in sein Kassierstübchen zurückziehen, als ihm auffiel, dass auf der Bierzeltgarnitur der Großfamilienfeier verbotenes Essen gereicht wurde. Überall in der Halle hängen Bilder, dass das Mitbringen von würzigen Speisen nicht gestattet ist. Klar, Indoors wollen halt ihre eigene Gastronomie unters Volk bringen. Kuchen, Süßkram und Getränke dürfen Gäste hingegen supermarktgünstig selbst ankarren.
(Wo wir einmal dabei sind: Verboten ist vermittels Schild ebenfalls, dass Erwachsene auf den Spielgeräten herumturnen!)
Der Kassenwart wiegte also den Zeigefinger vor der Nase der Mutter; sie hob die Brauen: Nix verstehen. Die anderen Beleibten verstanden offensichtlich besser, denn sie begannen hektisch zu spachteln. Der Kassenwart zog zwischen zwei Schüsseln mit lecker aussehendem Inhalt ein bemaltes Schild hervor und reicht es der Mutter. Was blieb ihr anderes übrig: Sie nickt und begann den anderen Müttern die Schüsseln wegzunehmen. Die schaufelten noch schneller und der Kassenwart ging wieder.
Das Geburtstagskind steckte übrigens immer noch plärrend fest, was die Mutter veranlasste, einen wohlgenährten Jungen zur Rettung auszusenden. Der Junge knurrte, er spekulierte auf weitere Speisen. Als Tischlein-deck-dich kurzzeitig abgeräumt war, packte die Mutter der Dicken eine gelbe Cremetorte aus. Natürlich knickste oben in der Tortenmitte eine graziöse Schokoladenprinzessin. Die anderen Mütter klatschen Beifall, winkten die Kinder heran und setzten ihnen bescheuerte Papphütchen auf. Alt wie jung machte sich über die Torte her: Alle zufrieden.
Kaum war die Torte verputzt, sammelten die Mütter erneut ihre verlustig gegangenen Kinder ein – die Dicke musste wieder irgendwo befreit werden – und packten zusammen. Das Gastspiel dauerte nicht einmal zwei Stunden.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die grandiose Unterhaltung bedanken!
Ich komme sehr gerne wieder!
*Indoorspielplatz = Halle mit riesigen, fangnetzgesicherten Klettertürmen und Rutschen für Kinder bis 12 Jahre
In den letzten Wochen schlief ich in abwechslungsreich vielen Betten; erwache ich nachts, überlege ich häufig, wo ich liege …
Seien wir ehrlich, liebe Leser, ich weiß, wie sich das liest: Frau GoodWord scheint ihrer Mischpoke überdrüssig und vergnügt sich. Doch weit gefehlt: GoodWords waren erkrankt. Als der Vater eines Abends schnupfte, sackte ich mein Bettzeug und zog auf die Couch. Vatter sollte seine Ruhe haben – und die Bazillen für sich behalten. Nach zwei Nächten war Gefügel der Weg bis zu Mutters Ausweichlager vor der Glotze zu gefährlich und es bat, Mutter möge sich auf die harte Matratze im Hühnerstall betten. Leider träumte das Kleine weiterhin schlecht und kroch in der Nacht zu mir auf das 60-Zentimeter-Brett. Als mein Mini endlich schlief, zog ich in sein Mini-Bett um.
In der folgenden Nacht hatte ich genug vom kuscheltiervollgeladenen, kurzen Bett und bin abermals auf mein Sofa.
Zum Glück ging es dem Haushaltsvorstand wieder besser und ich siedelte in der kommenden Nacht ins Ehebett zurück. Wir fassen zusammen: 5 Nächte = 5 Läger.
Nun war es aber so, dass des Chefs Bazillen unbedingt auch ein weibliches Quartier probieren wollten. Eines Morgens stand ich nicht mehr auf: Die Grippe hatte mich gestreckt. Lag es daran, dass ich kleiner bin, oder weil die Zeit reif: Ich war richtig krank. Um keinen anzustecken, verlegte ich meine Schlafstatt von Neuem auf die Couch und blieb dort liegen.
Damit ich wenigstens ein bisschen herumlief, schickte mir mein Mann nun täglich Kuriere. Alle zwei Stunden kam ein anderer, ich kenne jetzt sämtliche Zustelldienste.
In der darauf folgenden Nacht schloss sich Pubi an. Solidarisch ließ er sich zuerst das Essen durch den Kopf gehen. Weil die Komponenten unvorbereitet aus ihm heraus wollten, entleerte er sie in den Papierkorb. Mitten in der Nacht stand mein Mann plötzlich an meinem Krankenlager. Jetzt war ich froh, dass sich Pubi letztens versehentlich auf seinen Papierkorb aus Drahtgeflecht gesetzt hatte. Die Fuhre, die Pubi in den neuen Mülleimer traf, konnte ich sicher durchs Treppenhaus transportieren.
Am Morgen – ich hatte mit meinen Gliederschmerzen schließlich in den Schlaf gefunden – sorgte sich mein Mann, ob wir alle noch lebten. Er wanderte sämtliche Krankenlager ab und erkundigte sich. Weil leidensbedingt keiner so recht reagierte, sprach er lauter. Zwei Stunden später, ich war endlich wieder weggedämmert, beschloss mein Pubi, dass es ihm nun gut genug ginge und er sich auf den Weg zur Schule machen könnte. Als er mit viel Getöse aus dem Haus war und ich zu guter Letzt ein Nickerchen tätigte – Sie ahnen es? – schellte ein Kurier.
Indes ging es mir täglich schlechter und auf einmal hatte ich eine Lungenentzündung. War ich vorher schon krank – das war jetzt kein Vergleich mehr. Ich japste nach Luft und sehnte mich nach meinem 38-qm-Appartement. Mein Münchener Appartement war nicht nur winzig, es gab vor allem keine Treppen. Die Distanz zwischen Bett und Klo betrug einen Meter achtzig.
„Das kannst du hier auch haben“, sagte mein Mann, „Ich stell dir einen Eimer ans Sofa.“
So krank war ich dann doch nicht, denn ich schimpfte und erinnerte ihn an seine fröhlichen Kinder.
Nichtsdestotrotz hatten wir ein Betreuungsdefizit. Kam Geflügel mittags angeflattert, reichte eine sieche Mutter nicht. Ein Huhn in Schach zu halten, braucht es ein vollwertiges Gemüt.
„Ich rufe die Krankenkasse an“, beschloss mein Mann.
„Es tut uns sehr leid, dass Ihre Frau so krank ist“, sagte die freundliche Dame. „Erzählen Sie bitte von Ihrer häusliche Situation!“
Mein Mann tat wie geheißen und zählte Geflügel, Pubertikel, die kranke Mutter und den arbeitenden Vater auf.
„Dann ist doch alles paletti.“ Die Dame war erleichtert. „Sie haben ein Pubertikel daheim, der wird sich um alles kümmern.“
„Um was soll der sich kümmern?“ Mein Mann war irritiert.
„Das kleine Kind betreuen, einkaufen, kochen … was ihre Frau normalerweise so macht.“
„Das kann der doch gar nicht!“ Mein Mann schüttelte den Kopf.
„Pubertikel können so was. Lassen Sie ihn nur machen. Die können mehr, als man ihnen zutraut!“
Mein Mann bedankte sich, und just als er auflegte, rumpelte Pubi in den Flur.
Der Schulrucksack krachte gegen die Klotür und Pubi stürmte in die Küche. „Was gibt’s zu essen?“, rief er schon auf der Treppe.
„Nichts“, sagte mein Mann. „Ab heute kochst du.“
Pubi tippte sich an die Stirn. „Wer sagt das denn?“
„Krankenkasse.“
„Von denen lass ich mir gar nichts sagen!“
„Außerdem sollst du dich ab heute um deine kleine Schwester kümmern“, fuhr mein Mann fort.
Pubi feixte. „Wäsche soll ich sicher auch waschen?“
Mein Mann nickte.
„Ihr könnt mich mal!“ Pubi fuhr den Mittelfinger aus. „Ich bin verabredet, das ist megawichtig!“ Er guckte zur Uhr. „Außerdem bist du da, du kannst das machen!“
„Morgen nicht mehr. Ich will nicht meinen ganzen Urlaub verplempern.“
„Ich spiel jedenfalls nicht die Putze!“, regte sich Pubi auf. „Ich hab Schule!“
„Und was ist mit Essen?“
„Gibst du mir Geld mit“, schlug Pubi vor, „hol ich mir einen Döner.“
„Dann bist du versorgt. Und was kriegt deine kleine Schwester?“
„Die ist rund genug. Guck dir mal die dicken Bäckchen an!“
Geflügel kreischte los, während mir ob des Lärms fast das Herz stehen blieb. Das Geplärr zu übertönen fehlte mir jedoch die Luft.
Pubi wurde immer nervöser und mein Mann fragte: „Was ist?“
„Die Bahn kommt in 10 Minuten, ich muss Gruppenarbeit für die Schule vorbereiten.“
„Hat sicher mit zocken zu tun.“ Mein Mann grinste. Dann sagte er: „Schwirr ab. Wäre aber trotzdem schön, wenn du dich in nächster Zeit mehr um deine Schwester kümmern könntest!“
„Mach ich“, rief Pubi aus dem Flur. „Ich komm um 20:00 Uhr heim!“
Nun wollen Sie sicher wissen, wie wir unsere Angelegenheit regelten. Eine Woche verlagerte mein Mann sein Büro ab der Mittagszeit nach Hause. Pubi sahen wir selten. Dafür kann Geflügel jetzt einen 4-Personen-Haushalt schmeißen. Warme Kissen machen, Wäsche sortieren, Brot abschneiden, hinter den Jungs herräumen – mein Zwerghuhn ist eine einfallsreiche Hausfrau geworden.
Verrate ich aber nicht der Krankenkasse. Die lasse ich in ihrem Glauben an nützliche Pubertikel.
Manche von uns wohnen ein Leben lang im Radius ihrer Wiegenstatt, andere treibt das Business oder das Herz durch die Gegend. Ich bin schon was herumgekommen, aber nach meiner Wiege schaue ich trotzdem regelmäßig.
Mit steigender Zahl schulpflichtiger Fortpflanze erfordert das mehr Kompromisse – und unökonomischeres Überholen. In den Weihnachtsferien war es wieder so weit: Wir schnürten die Bündel.
Während ich das Gepäck im Auto verstaute, wartete Geflügel mit seiner Kuscheleule unterm Arm am Straßenrand. Es spähte angestrengt bergab.
„Was hast du denn?“, fragte Pubertikel. „Bist du aufgeregt?“
„Guck mal“, Geflügel zeigte auf ein Nachbarhaus: „dort wohnen zwei Leute …“
Pubi schaute ebenfalls. „Stimmt nicht“, stellte er fest, „dort wohnt nur einer.“
Kluggequatsche beeindruckt meine kleine Henne ja nun nicht: „Die haben zwei Schornsteine, also wohnen da zwei Leute!“
„Du Dummerchen“, Pubi riss das Kleine an sich und drückte es, „Schornsteine haben doch nichts damit zu tun, wie viele Leute drin wohnen! Stell dir mal vor, wir hätten dann fünf Schornsteine. Wäre doch kein Platz mehr für Dachziegel.“
„Wieso fünf?“
„Erst mal ich …“, fing Pubi an, korrekt die Prioritäten abzuzählen. „Dann du, Mama, Papa und Eddy. Das kleine Schwein soll auch nicht frieren.“
„Wir sind sechs!“
„Hä?“
„Meine Eule hat’s auch nicht gerne kalt.“
Pubi grinste. „Schornsteine gleich Menge der Öfen. Plus vielleicht Heizung. So genau kann man das von außen nicht erkennen.“ Er deutete auf ein anderes Nachbarhaus: „Vier Leute, ein Schornstein. – Geschnallt?“
Geflügel nickte und mir platzte vor Stolz fast die Jacke am Kreuz auseinander.
„Na los, Leute, früher wird’s nicht!“ Ich schloss die Haustür ab und spähte zur Sicherheit noch mal in den Briefkasten.
„Wieso müssen wir immer so weit fahren??“, schimpfte Geflügel, als ich ihm den Gurt anlegte. „Oma und Opa könnten auch nebenan wohnen!“
„Da wohnen schon welche.“
Wir fuhren den Berg hinunter – ich genoss die Winterruhe und die prima Aussicht – fing mein Geflügel wieder an: „Das riesige Haus dort hat zwei Schornsteine … – Wieso wohnen da nur zwei Leute drin?“
Pubi haute sich vor den Kopf, während ich so tat, als hätte ich nichts gehört.
Als ich unten an der Kreuzung nach dem Kaffeebecher angelte, gelang es meinem Pubertikel trotzdem, den letzten Hühnerbeitrag zu überschatten: „Wohin fahren wir eigentlich??“
Damit Geflügel nicht nur an Mutters Rock baumelt, singt es seit einiger Zeit im Kinderchor. Es trällert in einer altershomogenen Truppe, will sagen: Der Chorleiter ist ein armer Mann.
Letztens hatte die Farm einen Auftritt. Ein Musical, in welchem es ums Teilen mit den Armen ging. Geflügel sollte sich als mittelalterliche Magd verkleiden.
„Als Magd will ich nicht!“, schmetterte es. „Ich geh als Indianer!“
„Indianer hatten die im Mittelalter aber keine“, sagte ich und hielt ihm den Rock hin.
„Jetzt haben sie einen!“ Das Kleine zerrte mir den Rock aus der Hand und stopfte ihn hinter die Heizung.
Während ich mich beglückwünschte, bis zum letzten Tag mit der Kostümprobe gewartet zu haben, nahte von der Treppe Hilfe.
„Wenn ich einen Auftritt habe …“ – der Vater faltete sich bedächtig auf einem Kinderstuhl zusammen – „stehe ich auch nicht im Schlafanzug auf der Bühne. Dann ziehe ich mich für Rock-Musik an.“
„So ein Quatsch“, echauffierte sich Geflügel. „Du hast doch gar keinen Rock!!“
Im Flur brach Hektik aus: Pubi kam auf Durchreise. Er schmiss den Schulrucksack in sein Zimmer, schnappte ein Utensil und wollte flott die nächste Bahn erwischen.
„Wie viele ist der eigentlich?“ Mein Mann war ob des Transit-Tumults sichtlich irritiert.
„Der macht immer so eine Welle.“ Ich winkte ab. „Lass uns hier weitermachen.“
„Wir müssen nicht weitermachen“, sagte Geflügel. „Geh ich halt als Fisch!“
Irgendwie gelang es uns jedenfalls, sie am Auftritts-Morgen in ein dunkles Kleid zu zwängen, ein Wolltuch um die Schultern und statt eines Kopftuches wenigstens ein Blümchen ins Haar. Ein wenig verspätet erschienen wir am Treffpunkt. Gewohnt fröhlich riss ich die Tür zum Veranstaltungsraum auf – und erblickte einen Jahrmarkt grimmiger Minimägde und -Knechte.
„Was ist denn hier los?“, fragte ich meine genervte Nachbarin.
„Ein Theater mit den Kostümen …“ Sie knöpfte ihre Jacke auf und zog ein Kopftuch hervor. Dann sagte sie zu mir: „Pass mal auf …“
Sie drehte ihr träumendes Geflügel zu sich und wollte ihm geschwind das Kopftuch umbinden. Das fremde Geflügel wurde augenblicklich lebendig und riss sich das Kopftuch vom Kopf. „ICH BIN DOCH KEINE PUTZFRAU!“, brüllte es.
Das ihm am nächsten stehende Geflügel riss ebenfalls sein Kopftuch herunter und brüllte: „ICH AUCH NICHT!“
Das Domino erreichte mein Geflügel, aber ehe es einstimmen konnte, schnappte ich sein Ärmchen: „Du brauchst dich nicht aufzuregen, du trägst kein Kopftuch!“
Der Chorleiter sammelte nun das Marktvolk ein und gruppierte es auf der Bühne. Dabei fiel ihm ein Junge auf: „Nanu, du bist doch gar nicht verkleidet?“
„Ich mach eine Zeitreise“, sagte der Junge.
Geflügel kam noch einmal angehüpft, es hatte Durst. Während es mit seiner Flasche beschäftigt war, raunte meine Nachbarin: „Weihnachten kann das mit den Kostümen ja heiter werden …“
„Als was müssen sie sich denn verkleiden?“ Ich stöhnte.
Meine Nachbarin blinzelte: „Als Engelchen.“
Geflügel setzte seine Flasche ab: „Das kannst du vergessen! Weihnachten mach ich eine Zeitreise!“
„Würde ich bleiben lassen …“, plötzlich eine mürrische Stimme in der Reihe hinter mir. Weil die Uhr frühen Sonntag-Vormittag zeigte, war mein Pubertikel schlecht gelaunt.
„Wieso denn nicht?“ Geflügel ließ Auftritt Auftritt sein und stellte sich auf Bruders Tennistasche, damit es besser sehen konnte.
„Hallo“, knurrte der. „Mein Rucksack ist keine Fußbank.“
„Warum soll ich denn keine Zeitreise machen? Ist das gefährlich?“ Mini wollte das jetzt wissen.
„Mann, Mutter, erklär du das, ich schlaf noch …“
„Woher soll ich das wissen.“ Ich tippte mir an die Stirn. „Ich bleib Weihnachten daheim.“
„Soll ich besser keine Zeitreise machen?“ Geflügel kletterte auf Pubis Schoß.
„Denk doch mal an den Weihnachtsmann …“ Mein Pubi funkelte mich sehr giftig an.
„Ach ja …“ Es nickte. „Ja, dann bleib ich auch hier. – Aber ich geh nicht als Engelchen!“
Meine Nachbarin feixte und ich beschloss, Weihnachten weit wegzuschieben. Heute zählte nur die singende Magd.
„Genug getrunken“, bestimmte ich, „Abmarsch auf die Bühne!“
Trotzdem war das der Moment, der Geflügels diesjährige Weihnachtsstimmung einläutete. Auf dem Heimweg schwieg es.
„Was ist denn los, Schatz? Du hast so toll gesungen, ich war unheimlich stolz auf dich!“
Mein Kleines war in Gedanken ganz woanders. „Der Nikolaus war schon mal im Kindergarten und hat vorgelesen“, sagte es stattdessen. „Er hatte ein ziemlich blödes Kostüm an. Die Mütze: vorn hoch, hinten hoch und in der Mitte Haare …“ Es simulierte mit den Armen irgendwelche Bretterwände mit einem Bachlauf dazwischen. „Allerdings glaube ich nicht, dass der echt war …“
Ich bekam einen mittelgroßen Schrecken und sah aufgrund eines schlechten Kostüms unsere Weihnachtsglückseligkeit den Bach runterrauschen.
„Der Nikolaus kann sich unmöglich den ganzen Vormittag zu uns in den Kindergarten setzen. Stell doch mal vor, wie viel der zu tun hat! Wenn er überall bis zum Mittagessen bleibt, schafft er am Tag zwei Kindergärten …“
„Wieso zwei?“
„Die Erzieherinnen essen später. Die können auch selber lesen, dann geht das schneller.“
Ich nickte.
„Aber mir hat gut gefallen, dass der Nikolaus Jans Papa als Gehilfen geschickt hat.“
Mir wollte immer noch nichts einfallen …
„Der kann bestimmt auch Weihnachtsmann …“, überlegte Geflügel weiter. „Mama, frag ihn doch mal, ob er Weihnachten bei uns daheim den Weihnachtsmann spielt!“
Wo ich herkomme, sind alle Leute mächtig Weihnachtsfans. Innen und außen dekorieren wir die Häuser üppig mit Tannenwedeln und erhängen kleine Püppchen. Man kann sich bei uns im Dezember schlecht bewegen, aber das muss man auch nicht, es ist ja kalt.
Seit ich von daheim weg bin, halte ich es mit der Tradition, wie es mir in den Kram passt. Weihnachtszeug räumen wir eine Woche vor Totensonntag hin, die Mühe soll sich ja lohnen. Wir verteilen sechs Umzugskisten Holzwaren und Kerzenarrangements im Haus. So was dauert. Ginge es nach Geflügel, winkten Weihnachtsmänner und Engelchen noch bei 30 Grad aus dem Bücherregal. Im Freibad schwitzen und am Abend unterm Tannenbaum Weihnachtslieder singen.
Von der Deko abgesehen – kulinarisch habe ich es weniger drauf. Weil wir letztes Jahr am zweiten Advent noch keinen einzigen Keks produziert hatten, fingen wir in diesem Jahr in der zweiten Novemberwoche damit an. Ein wenig grauste mir: Ich fürchtete mich vor Fettfingern an der Wand und Teigklumpen im Teppich.
„Hab dich nicht so“, beruhigte mich mein Mann.
Zum einen ist er ein Mann, zum anderen ist es stockfinster, wenn er das Büro verlässt.
Solchermaßen vom Ehegespons bestätigt, legten Geflügel und ich also eines Nachmittags los.
„Du ziehst eine Schürze an!“, bestimmte ich.
„Letztens bei Ikea wolltest du mir keine kaufen“, schimpfte es.
„Für zwei Mal im Jahr Plätzchen backen, kauf ich nicht extra einen Doppelpack Kinderschürzen. Du bist groß genug, du nimmst eine von meinen.“
Geflügel jubelte. „Dann will ich die mit dem Strick um den Hals!“
„Rühr dich nicht vom Fleck, ich gehe kurz in den Keller und hole das Ausrollbrett!“
„Ich bleib brav hier stehen und fummel mit der Butter.“
„Untersteh dich! Bewach die Butter, das langt!“ An der Tür drehte ich mich noch einmal um. Das Kleine stand auf der Fußbank, seine Kuscheleule unterm Arm und guckte in die Rührschüssel.
„Nicht fummeln!“, sagte ich noch einmal.
„Mach ich nicht.“ Es nickte.
Trotzdem hielt ich es für nötig, die Treppe hinunter zu rennen. Ich hatte die Tür des Vorratsraumes gerade geöffnet, als es über mir schepperte.
„Himmel …“, stöhnte ich und zog eilig das schwere Holzbrett hinter dem Regal hervor.
Als ich oben ankam, hockte mein Geflügel vor einem Küchenschrank und stopfte wahllos Tischdecken hinein.
„Was ist denn hier passiert?“
„Ich hab schon mal die Schürzen rausgeholt.“
„Was haben die mit den Tischdecken zu tun?“
„Die Schürzen lagen drunter. Da hab ich gezogen.“
„Und was hat eben so fürchterlich gescheppert?“
„Das war das Eimerchen mit den Ersatz-Schlüsseln.“ Mein Mini wirbelte ein paar Tischdecken hoch. „Das hab ich aber noch nicht wieder gefunden …“
Statt zu backen, faltete ich jetzt Tischdecken und stapelte sie in den Schrank zurück.
„Wann geht’s denn endlich los?“ Mein Gefieder wurde ungeduldig.
„Such schon mal die Ausstechformen raus.“ Irgendwie musste ich sie ja beschäftigen. „Aber nimm Weihnachtsformen!“
Geflügel warf sich quiekend vor einen anderen Schrank und riss die Holztüren auf. Im gleichen Moment krachte und dröhnte es erneut – und die große Blechdose mit unserem gesamten Besitz an Ausstechformen lag auf dem Boden. Ich knurrte und dachte voller Liebe an meinen Mann.
„Da hat so ein Depp die Blechdose auf das Nudelholz gestellt“, entschuldigte sich Geflügel.
Weil nicht viele Deppen infrage kamen, holte ich tief Luft und sagte nichts.
Meine Henne kramte in den Formen und gackerte zufrieden vor sich hin. Als ich endlich den Tischdeckenschrank schloss, lag hinter mir eine Giraffe. An deren Schwanz hing ein Elefant, den eine Kuh schob. Auf der Kuh hockte ein Schmetterling und gerade wollte sich ein Osterlamm in die Zoowanderung einreihen.
„Haben wir nicht gesagt, wir backen Weihnachtsplätzchen?“
„Ich hätte als Nächstes schon einen Baum genommen …“ – ein Tornado wühlte durch die Ausstechformen – „ich finde nur die Kirschen nicht …“
„Schatz, Weihnachten: Da fällt Schnee, es ist kalt, Glöckchen klingen, der Tannenbaum leuchtet …“
„Nehmen wir statt Weihnachstbaum lieber das Krodkodil!“, unterbrach es mich. „Das ist genauso grün.“
Leg der Hund seinen Haufen drauf, mir sollte das egal sein: Hauptsache Plätzchen! Plötzlich fiel mir ein, dass wir das Problem mit der Symbolik schon im letzten Jahr hatten. Da waren es Delfine, die Geflügel unbedingt backen wollte. Wider Erwarten waren die gewaltig gut angekommen.
„Wo sind eigentlich die beiden Delfinausstecher“, fragte ich, nachdem ich das Chaos gescannt hatte.
„Ja, das frag ich mich auch …“ Geflügel hüpfte zum Fenster.
„Hast du die Delfine etwa einkassiert?“
„Das war bestimmt mein Bruder, der hat die sicher gebraucht …“
„Was hab ich gebraucht?“ Pubertikel war heimgekommen. Er schmiss den Schulrucksack vor den Tresen und während er nach dem Himbeersirup angelte, machte sich das Kleine aus dem Staub.
„Ich glaub, die hat was angestellt …“, sagte Pubi und kippte sein Glas halb voll Sirup. Erst wollte ich etwas zum Mischungsverhältnis loswerden, doch dann winkte ich ab und ging mein Zwerghuhn suchen. Schließlich entdeckte ich es oben im Zelt. Der Vorhang war zugezogen, und als ich mich setze, raschelte es drinnen aufgeregt.
„Was ist los, Engelchen?“, fragte ich.
„Das mit dem Nikolaus sorgt mich …“, schluchzte das Kleine.
„Was denn genau?“ Ich zog es aus dem Zelt.
„Man muss doch Schuhe putzen und vor die Tür stellen …“
„Ja …“
„Am Morgen stehen unsere Schuhe nicht mehr draußen, sondern auf dem Küchentisch …“
Ich nickte und streichelte das Köpfchen.
Jetzt heulte es richtig los. „Ich bin heute in Hundescheiße getreten!“
„Ist nicht schlimm …“ Kurz schaute ich zum Himmel. „Bei uns legt der Nikolaus die Geschenke sowieso in die Hauspantoffeln.“
Statt sich einzukriegen, plärrte mein Mini nun aber noch mehr.
„Was?!“, fragte ich gereizt. Mir langte das mit der Hundescheiße schon. Deutlich erinnerte ich mich der Flugbahn, welche die Straßenschuhe von der Treppe genommen hatten. Im Flur waren sie aufgeschlagen und mit der Sohle an der Wand liegen geblieben. Mir war das gleich missfallen.
„Voll unfair ist das …“ Dicke Tränen platschten auf ihren Pullover. „Guck doch mal, was ich für kleine Schuhchen hab!“
„Wenn in Papas Riesenlatsch ein Pinguin steckt, glaube ich nicht, dass der Papa das Viech behält.“
„Ja“, schniefte mein Kleines. „Der Pinguin steht ja auch auf meinem Wunschzettel …“
„Apropos Viehzeug: Vielleicht fällt dir bei der Gelegenheit ein, wo die Delfinausstecher sind?“ Immerhin hatten wir Pläne für den Nachmittag.
Mein Geflügel verschwand wieder im Zelt und raschelte erneut. Dann klatschten zwei Delfine gegen den Schrank. „Ich weiß aber nicht, wie die hier raufgekommen sind.“
„Siehste, Mutter, ich hab doch gesagt, dass die was angestellt hat!“ Pubi kam ins Zimmer. Er wollte ins Kino und brauchte Geld. „Kannst ruhig noch einen 5er drauflegen, dann geh ich vorher zu McDonalds!“
„Gegessen wird zu Hause!“ Was meint der Junge eigentlich, wofür er Taschengeld einstreicht?
„Ich geh mit Pommes essen!“, jubelte das Kleine. „Warte, ich zieh mich schnell an!“
Pubi wurde sichtlich nervös. „Mutter, tu was!!“, regte er sich auf, als ich nicht reagierte.
Nun fiel mir aber genau in dem Moment ein, dass ich lange keine Mails abgerufen hatte. Ich stand also auf und überließ den Kindergarten sich selbst.
Meine Mails der letzten zwei Stunden waren noch nicht einmal vollständig durchgerasselt, als meine Fortpflanze einträchtig die Treppe herunter kamen. Das Kleine küsste den Bruder zum Abschied und er sagte: „Lass dich nicht abwimmeln. Sag der Mama, ich hab’s erlaubt!“
„Was hast du erlaubt??“ Was meinen Sie, wie schnell ich aus meinem Stuhl war!
Pubi rief: „Bin weg! Bahn kommt gleich!!“ Die Haustür krachte ins Schloss.
„Was hat er erlaubt?“, fragte ich mein Mini, das glückselig neben meinem Schreibtisch auftauchte.
„Mein Bruder hat mir erlaubt, den ganzen Nachmittag auf deinem Rechner Filmchen zu gucken!“
„Backtradition“ ist unser letzter Schwank für 2014. Wir bedenken uns für die Treue und die vielen, vielen unglaublich lustigen Kommentare! ❤
GoodWords wünschen Euch eine wundervolle Weihnachtszeit und einen gepflegten Rutsch!
Auf Wiederlesen in 2015! 🙂
Eure Familie GoodWord
Vater Goodword muss geschäftlich nach München. „Einen Haarschnitt brauche ich diese Woche auch“, überlegt er beim Sonntagsfrühstück.
„Mach mal was Modernes …“ Pubertikel döst in der Müslischale. „Oder nimm mehr Gel.“
„Was willst du denn in München?“ Bei Geflügel sind die Reisepläne endlich durchgeklackert. „Etwa mit dem Flugzeug??“
Der Vater nickt.
„Flugzeug!“ Das Kleine klettert auf Vaters Schoß. „Hast du keine Angst, dass dir beim Landen deine Öhrchen wehtun?“
„Solche Riesenlöffel tun nicht weh.“ Pubi rührt träge in der Schüssel.
„Deine schon.“ Der Vater kneift ins Weiche der Pubi-Lauscher.
„IST ES DRIN, DASS MAN HIER MAL IN RUHE WAS ISST?“, explodiert mein Pubi. „Nicht genug damit, dass ihr mitten in der Nacht Fangen spielt, rumschreit und eure Decken durch die Gegend schmeißt“, der Löffel klirrt in die Schüssel, „jetzt kann man nach so ’ner kurzen Nacht nicht mal ungestört in sein Müsli stieren! – Da geh ich ja noch lieber zur Schule, da hab ich wenigstens meine Ruhe!“
„Bin mir nicht sicher, ob die am Wochenende für dich aufsperren …“
„Wie alt seid ihr eigentlich?“ Pubi tippt sich an die Stelle, wo gemeinhin der Kuckuck sitzt.
„In die Schule geh ich jedenfalls nicht!“ Geflügel schüttelt sich. „Ich bleib schön bei Mama und spiel mit ihr! Sie mag es nämlich nicht, wenn wir alle weg sind.“
Auf den Schreck ziehe ich mir gleich einen frischen Kaffee.
„Wir könnten …“, Geflügel brütet, „wir könnten … KOFFERPACKEN SPIELEN!“ Es verschafft sich Gehör, indem es lauter schreit als das Mahlwerk der Kaffeemaschine.
„Hä?“ Pubi schiebt den letzten Löffel Müsli rein. „Ich fahr nirgendwo hin!“
„Ist doch nur fürs Spiel.“
Die Kaffeemaschine kriegt sich wieder ein und Geflügel schaltet auf normallaut: „Ich fahr auch nicht mit dem Papa mit. Schon wegen der Öhrchen!“
Der Kaffee duftet, meine Finger genießen die Wärme der Tasse – meinetwegen: Spielen wir halt Gedönseinpacken.
„Ich packe in meinen Koffer …“, beginne ich: „ein Kopfkissen.“
„Haben die in München etwa keine Kissen??“ Geflügel ist schockiert, beruhigt sich aber schnell: „Wenn ich nachts zu dir ins Bett krieche, bringe ich ja auch mein Kopfkissen mit.“
„Egal. Ist doch nur fürs Spiel.“
Geflügel ist dran. „Ich packe in meinen Koffer: ein Kopfkissen und eine Flasche Wasser.“
„Boah, ich hasse Wasser!“, regt sich Pubi auf. „Pack was Gescheites zu trinken ein!“
Ich stöhne und gucke in meinen Kaffee.
„Ist doch nur fürs Spiel“, beruhigt das Schwesterchen.
Ich bin gespannt, wann das mit dem Spiel der Letzte bei uns begreift.
Pubi ist dran. Er packt ein Kopfkissen ein, mit angewidertem Gesicht die Flasche Wasser – und während er noch nachdenkt, was er als Drittes mitnehmen könnte, funkt Geflügel dazwischen: „Eines sag ich dir: Dein blödes Handy lassen wir daheim!!“
Mein Geflügel fürchtet sich neuerdings daheim. Sobald es das Haus betritt, bindet es sich vermittels Strick fest an meinen rechten Knöchel. Der Hühnerstall liegt verwaist und Spinnen fahren mit den Autos durchs Zimmer. Demnächst wollen die Acht-Beiner das gesamte obere Stockwerk annektieren, denn auch Pubertikel lässt sich nur zum Schlafen blicken.
Als es mir nach zwei Wochen zu albern wurde, von der kleinen Maid aufs Klo eskortiert zu werden, suchte ich das Gespräch.
„Ich geh nicht hoch, da kommen Böse ins Haus!“, schmetterte sie.
„Wie sollen die hineingelangen? Die müssen unten bei mir vorbei. Tür ist abgeschlossen und ich lasse niemanden rein!“
„Die schleichen natürlich oben rum.“
„Und dann?
„Durch den Schornstein.“
„Ist doch Quatsch. Auf dem Dach ist ein schmaler Schlund. Guck mal bei den Nachbarn: Siehst du die Regenabdeckung? So was haben wir auch. Wer soll so blöd sein und sich da durchquetschen?!“
„Weihnachtsmann.“
„Außerdem brennt der Ofen. Durchs Feuer kriecht keiner.“
„Doch. Wolf.“
„Der sengte sich den Schwanz an und machte, dass er fortkam.“
„Ja. Aber beim zweiten Mal stellte er sich geschickter an. Kippte zuerst einen Eimer Wasser runter.“
„Wo hat er jetzt noch mal das Wasser her?“ Irgendwie rann mir die Zeit davon.
„Holt er aus dem Teich …“ Sie zeigte nach draußen.
„… und schleppt den Eimer bis aufs Dach!“ Mein Pubi verhedderte sich vor Freude mit dem Schulrucksack im Treppengeländer. Es polterte und er knurrte, woraufhin Geflügel mir zitternd an den Hals sprang: „Siehst du! Kommt schon einer!!“
„Mensch, das bin doch ich!“
Jedenfalls bringt solcher Tumult meine kleine Henne noch lange nicht aus dem Konzept: „Oder er schmeißt erst eine Decke rein …“, überlegte sie weiter.
„Blödsinn. Dann friert er nachts!“ Pubi hatte sich wieder gefangen und startete zum zweiten Anlauf in die Küche. „Außerdem klaut dich sowieso keiner. Du plärrst zu viel!“
Während Geflügel den Schnabel aufriss, deckelte Pubi geschwind seine Ohren. Doch dann kam ihm eine Idee: „Und wem das nicht langt, den verhau ich! Ich hol dich schon zurück!!“
Das Kleine stürzte sich auf den Bruder und schmatze ihn ab. „Siehste, Mutter“, er sah mich triumphierend an, „wenne mich nicht hättest, wär das hier voll eskaliert!“
Nichtsdestotrotz grauste sich mein Geflügel weiter. Deshalb schläft es in Mutters Bett ein und der Vater bugsiert das unhandliche Ding nachts in die Kinderstube. Dabei muss er aufpassen, dass er nicht mit dem Hühnerkopf am Türrahmen hängen bleibt.
Nun sammelt das Kind seit einer Weile Glubschis. Das sind diese Kuschelviecher mit den riesengroßen Glitzeraugen. Mittlerweile elf dieser Angsthasen finden in meinem Bett Ruhe und wollen nachts mit dem kleinen Mädchen ins Spinnenquartier.
Bei acht Stück fing es an, dass ich zweimal gehen musste. Hatte ich wenig Bock drauf. Zumal Geflügels Kuscheleule und ein großes Pferd mit von der Partie sind.
„Du hast einen MaxiCosi“, sagte ich eines Morgens. „Stell den abends ans Bett, dann muss ich die Viecher nur reinpacken. – Steht der MaxiCosi nicht da, pennen die Glubschis bei Mama!“
Eine Woche klappte alles bestens: Viehzeug einstapeln, rübertragen, Henne zudecken und küssen – Feierabend.
Nach einer Woche und einem Tag suchte ich kurz vor Mitternacht den MaxiCosi. Spähte ins Zimmer, guckte ins Zelt; sogar den Schrank zog ich auf: Nichts. Rannte noch einmal nach unten, scannte das Erdgeschoss: Nada.
„Hast du’s endlich?“ Mein Mann legte seine Brille auf die Fensterbank.
Bin ich also drei Mal wegen des Zottelzeugs hin und her.
Am Morgen fragte ich Geflügel: „Wo war der MaxiCosi letzte Nacht?“
„Du hast doch gestern gesagt, ich soll aufräumen!“
„Wohin hast du ihn denn geramscht?“
„Unters Bett.“
Mein Mann wollte an uns vorbei, er brauchte Socken.
„NICHT DA REIN!!“, brüllte Geflügel. „MEIN BRUDER SCHLÄFT NOCH!!“
„Jetzt nicht mehr“, sagte der Vater und ließ die Sockenlade zurollen.
Kaum trafen mein Mann und ich unten an der Kaffeemaschine zusammen, kriegte Geflügel Sehnsucht. Es stellte sich vor Pubis offene Zimmertür und kreischte: „MAMA! MAMAA!“
Ich rannte ins Treppenhaus, doch das kleine Ding trompetete wie angestochen weiter: „MAMAAAAAA!“
„Was ist denn??“ Pubi tat mir echt leid.
„Wo ist meine Erdbeere?“
Wegen einer Erdbeere brüllt die das ganze Haus zusammen und das Nachbarhaus gleich mit?
„Wirst du gegessen haben.“
„Die ist nicht zum Essen!“, empörte es sich.
„Was weiß ich …“ Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach und außerdem wollte ich zu meinem Kaffee. Drehte mich um, plärrte es wieder: „MAMAAAAA!“
„Maaaann“, so langsam reichte es mir. „Was willst du denn noch?“
„Wo ist jetzt meine Erdbeere?“
„Du hast doch gestern aufgeräumt. Guck mal unters Bett!“ Pubis Schlaf konnte mir mittlerweile gestohlen bleiben.
Das Kleine wetzte los und ich betrat die Küche. Die können bei mir daheim theatern, was sie wollen, aber bittschön nach dem Kaffee!
Ich setzte mich zu meinem Mann auf die Bank – Füße auf den nächsten Stuhl – kam unser Nachwuchs mit einer großen Dose in Erdbeerform angeflattert.
„Aha“, sagte ich. „Was hat es nun mit dem Ding auf sich?“
„Ich wollte nur mal reingucken, was drin ist.“
Bei den Großeltern auf dem Land ist alles früher: Bäume verlieren im Herbst schneller ihre Blätter, man beginnt zeitiger sein Tagwerk und ohnehin war früher alles besser.
Wenn wir die Großeltern besuchen, schläft Pubertikel in der Kammer neben der guten Stube. In der steht auch das Telefon. Es bimmelt mit maximaler Lautstärke, damit meine Leute keinen Anruf verpassen. Egal wo sie sich aufhalten.
Jeden Morgen, kurz vor sieben, fängt der Terror an!
Die erste Schachtel will von meiner Mutter wissen, wie es ihr geht. Die Nächste möchte sich beschweren, dass die Schnecken in diesem Jahr überhandnehmen. Gewiss ließe sich das auch am Vormittag klären – zumal meine Mutter dann aufgestanden wäre. Das Bett ist nämlich der einzige Platz auf dem ganzen Grundstück, wo meine Leute ihr dämliches Telefon nicht hören!
Mein Pubertikel versteht da jedenfalls keinen Spaß. Das Wichtigste an Ferien: Er! Schläft! Aus!
Wenn die Sonne zum Zenit klettert, lässt sich mit einem verschlafenen Pubi rechnen.
Vorher drehen wir Däumchen oder blättern in der Zeitung.
Letzten Sonntag reisten wir spät abends an. Ich sah den Stress am nächsten Morgen schon kommen, sagte aber nichts. Als wir uns kurz vor 10:00 Uhr in der Küche um warme Brötchen versammelten, fragte meine Mutter: „Wo steckt Pubi?“
Ich winkte ab, ich hatte Halsschmerzen.
„Hat heute früh eigentlich wer angerufen?“ Mein Vater feixte.
„Du trinkst jetzt Salbeitee!“, bestimmte meiner Mutter.
„ … wir könnten ihm auch das Telefon ans Bett legen und „Suchen“ drücken“, überlegte mein Vater. Die Halsgeschichte war ihm gleich.
„Au ja, gute Idee!“ Geflügel flitzte los.
„Lass mal“, krächzte ich. „Lass ihn pennen!“
Geflügel kam zurück und trat der Oma auf den Fuß, die mit einer riesigen Tasse zum Tisch balancierte.
„Heiß!“, schimpfte meine Mutter.
In der Tasse schwamm ein nicht minder mächtiges Tee-Ei.
„Zehn Minuten ziehen lassen!“ Meine Mutter drohte mit dem Finger und ich salutierte. Eine Viertelstunde später erinnerte ich mich des Tees und zog das Ei heraus. Das Wasser war so hell wie vor fünfzehn Minuten.
„Ihr macht mich fertig“, stöhnte meine Mutter und kramte ihre Salbeibüchse aus dem Schrank.
Irgendwann im Laufe dieses bunten Frühstücks kreuzte Pubi auf. Er schleppte sich zum Tisch und brach schwerfällig über einem Stuhl zusammen.
„Was ist, Großer?“ Mein Vater gab den Mitfühlenden.
„Dieses scheiß Telefon!“, schimpfte Pubi los. „Kommende Nacht nehm ich’s mit ans Bett und dann stauch ich die morgen früh dermaßen zusammen!!“
„Ja, mach das.“ Großvater nickte. „Zeig denen, wo’s lang geht. – Wie spät war es denn?“
„Kurz vor halb zehn!!“
„Allerhand.“ Mein Vater schüttelte den Kopf. „Die trauen sich was.“
Nächster Morgen, wir anderen wieder vergnügt am Frühstückstisch. „Und?“, fragte mein Vater, „ob einer angerufen hat?“
„Bestimmt!“ Ich nickte und titschte genüsslich in Mutters Salbeitee. Diesmal waren Blätter drin, das Wasser war pissgelb.
„Riecht wie gute Suppe.“ Geflügel hing mit dem Köpfchen über meiner Tasse.
„Du kannst auch einen kriegen“, sagte meine Mutter.
„Aber mach mir Nudeln mit rein.“
„Das ist ein Tee!“
„Mir langen auch Eier …“
Es war deutlich vor zwölf, als Pubi zu uns stieß. Er sah noch derangierter aus als gestern. Mein Vater rückte ihm einladend den Stuhl zurecht und stütze sich dann auf die Ellbogen. „Erzähl!“
Zusammenfassend war die Sache so gelaufen:
Natürlich hatte mein Pubi das mit dem Telefon-zum-Bett-nehmen vergessen. Der Terrorknochen schellte also wie gewohnt. Mein Pubi stürmte ins Wohnzimmer, brüllte rein: „Wir schlafen noch!“, und knallte den Hörer in die Ladeschale.
Er hatte das Bett noch nicht wieder erreicht – bimmelte das Ding erneut!
Eine Frauenstimme, doch Pubi ließ sie nicht ausreden.
„Ich habe Ihnen doch bereits gesagt, dass wir alle noch pofen!“ Haute den Hörer zurück, wollte endlich in sein Bett: DRRRING!!
„So langsam nerven Sie.“ Diesmal blieb mein Pubi ruhig.
„Ich habe schon zwei Mal angerufen …“ Die Dame am anderen Ende sammelte sich. „Wie geht es euch denn?“
„Und, wer war das jetzt??“ Mein Vater war hochvergnügt.
„Das weiß ich doch nicht! Denkste, ich hab mich weiter mit der unterhalten?“
„Was hast du denn dann gemacht?“
Pubi begann auf seinem Smartphone zu fummeln.
„Wenn du was spielst, will ich mitspielen!“ Geflügel erklomm die Rückenlehne seines Stuhles.
„Ich spiel nicht!“ Pubi grinste zufrieden. „Ich hab mir jetzt den Wecker gestellt. Wenn Montag die Schule wieder anfängt, steh ich um 6:20 Uhr auf. Als Erstes ruf ich die an und frag sie, ob ich ’n dicken Pullover anziehen soll!“
Unlängst beschloss mein Pubertikel, er wolle sich verstärkt selbst um seine Ernährung kümmern, wenn er spät heimkommt …
Voll bester Vorsätze stürmte mein Youngster neulich nach dem Training in die Küche. Zeit, das Licht anzuschalten, hatte er nicht. Aus zwei Töpfen kippte er Nudeln und Hackfleischsoße auf einen flachen Teller und haute das Ganze in die Mikrowelle. Ebenso schwungvoll riss er den Teller nach zwei Minuten wieder heraus und stürzte zum Tisch.
Offensichtlich hatten Nudeln und Hackfleischsoße für den Abend schon andere Pläne und machten sich vom Acker.
Am Tisch angekommen, war der Teller fast leer. Also ging Pubi seine Nudeln suchen. Trotz Dunkelheit entdeckte er die Feierbirnen – als er sie platt trat.
Nun weiß sich mein Pubertikel ja zu helfen. Den größten Haufen Würstel schloss er im Spüllappen ein; mit dem Geschirrtuch schmierte er die Tomatensoße breit. Kurz überlegt er, wohin mit dem Lappen: Er schwankte zwischen Mülleimer und auswaschen – entschied sich dann aber für recyceln. Hierfür riss er den Wasserhahn bis zum Anschlag auf; das Geräusch machte mich im Zimmer nebenan aufmerksam. „Alles in Ordnung?“, fragte ich.
„Immer. Alles bestens.“
Weil der Wasserwerfer weiter mit fünf Litern sekündlich ins Spülbecken dröhnte, ging ich das überprüfen.
Ich sage Ihnen weiter nichts!
Das Spülbecken war zu zwei Dritteln mit brodelnder brauner Brühe gefüllt und ungezählte Hackfleischwürstel sausten im Kreis. Sah aus wie beim Synchronschwimmen.
„Was ist das denn?“, fragte ich.
„Kannst wieder gehen, ich hab’s im Griff.“ Mein Pubi wuselte herum. „Mikrowelle hab ich schon gesäubert.“
Erst jetzt schaute ich zur Mikrowelle. Ein Lavastrom quoll dickflüssig heraus und tropfte gemächlich am Küchenschrank hinunter.
„Mann!“, wetterte ich. „Was wird das?“
„Alles gut, ich mach das schon.“ Pubi lief hin und her trat Tomatensoße breit.
„Warum brennt denn hier kein Licht??“
„Hatte ich noch keine Zeit für“, sagte mein Pubi aufrichtig und haute mit der Hand auf den Lichtschalter. Ein roter Dreifingerabdruck blieb zurück.
„Raus!“, sagte ich.
„Was du dich nur einmischst, ich mach das schon …“
„Klar“, ich nickte. „Wenn’s morgen festgetrocknet, putz ich drei Stunden hinter dir her.“
„Ich kann nix dafür, dass du ’n Putzfimmel hast.“
Jedenfalls schmiss ich meinen Pubertikel mit seinem Reste-Teller aus der Küche und machte mich an die verstopfte Spüle. Mit einer Pinzette pulte ich Wurm für Wurm aus dem Abfluss, bis das Wasser wieder zügig weglief. Unterdessen hatte es sich die Tomatensoße mit den breitgetretenen Nudeln zwischen den Dielenbrettern gemütlich gemacht. Weil sie auf Lappen-Ansprache nicht reagierten, trieb ich das Gelage mit einem Zahnstocher auseinander.
Nächster Tag – Geflügel und ich waren eben heimgekommen – stieg ich schnell nach unten in die Waschküche. Mütter haben eben immer Stress. Geflügels erster Gang hingegen gilt stets der Küche, es ist dauernd hungrig. Ich war noch nicht richtig unten, rief Geflügel: „Wo kommen denn die Regenwürmer her? Guck mal! Die sind aus dem Schrank gefallen!“
Man kann bei mir daheim keine Arbeit ungestört zu Ende bringen! Ich schlurfte nach oben. Mit spitzen Fingern hockte Geflügel vorm Tellerschrank und hielt etwas Helles hoch. „Wie süß der ist! Ganz klein ist er noch …“
Ich wollte mir den Wurm gerade ansehen, kam mein Pubertikel herein: „Den kannst du essen. Der ist von meinem gestrigen Mittag.“
„Wie kommt er dann in den Schrank??“
„Da bin ich jetzt überfragt …“ Pubi grinste und machte sich aus dem Staub.
Später saß ich mit Geflügel im Garten und genoss die Herbstsonne. Plötzlich fragte meine kleine Henne: „Mama, findest du die grauen Haare eigentlich schön?“
„Wieso?“
„Werden immer mehr, du funkelst richtig!“ Sie fummelte mir auf dem Kopf herum. „Soll ich rauszupfen?“
Selbstredend wartete sie keine Antwort ab, sondern zog genüsslich an einem meiner Haare.
„Aua!“, sagte ich. „Das macht man nicht langsam! Sondern wie mit Heftpflaster: ‚Zack!‘, weg!“
„Sie hat so viele Graue“, Pubi warf sich mit einem Pudding in den nächsten Stuhl, „weil sie sich immer über uns ärgern muss.“
„Über mich nicht, ich bin brav!“
„Du vor allem …“ Pubi schaufelte Pudding und wehrte mit dem Ellbogen die kleine Schwester ab, die nach dem Becher rangelte.
„Du …“, das Kleine ließ vom Pudding ab: „Wieso sind Papas Haare fast weiß?“
Pubi schob den letzten Löffel in den Mund. „Zusätzlich muss der sich noch über Mama ärgern. Guck mal bei mir, ich hab bestimmt auch schon welche!“
„Wo ist eigentlich dein Lateinbuch?“, fragte ich meinen Pubertikel.
„Jetzt fangen die schon wieder mit ihren blöden Vokabeln an! Ehe ich auch noch graue Haare krieg, geh ich lieber spielen!“ Das Kleine rannte ins nächste Gebüsch.
„Das muss ich mir merken …“ Pubi sah ihr hinterher. „Wenn die mir wieder auf den Sack geht, sag ich: Mama, frag mich Vokabeln ab!“
Mein Pubi hatte tatsächlich gelernt und wir kamen zügig voran. Bei der zweiten Lektion rief mein Geflügel: „KOMMT SCHNELL! ICH HAB WAS ENTDECKT!“
Keiner von uns reagierte.
„MAMA! HIER! WIE SCHLIMM!“
Pubi sah mich an. Ich winkte ab und fragte weiter: „exitus?“
Just in dem Moment, als mein Pubi: „Ende und Ergebnis“, antwortete, klatschte Geflügel mir eine Gartenschüppe ins Schulbuch. Darauf die abgenagten Knochenreste eines Frosches …
Aus Gründen der Pietät und aus Sorge um das Essverhalten meiner Leser, hier nur ein kleiner handchirurgischer Ausschnitt. Wer eine Ganzköperaufnahme dieses wundervoll erhaltenen Krötenskeletts sehen möchte, scheue sich nicht, mir eine Mail zu schreiben! 😉
In den Ferien schrauben GoodWords die Mindeststandards fürs Zusammenleben ganz weit nach unten: Man spuckt nicht in den Flur, maust kein Geld aus elterlichem Geldbeutel und Straßenbahn wird nur mit Ticket gefahren. So was in der Art.
Da schockierte es das GoodWordsche Pubertikel schon außerordentlich, als Mutter zu Ferienanfang bestimmte: „Du lernst Lateinvokabeln!“
„WAAS?? Wieso das denn?? Ich hab Ferien!!“
„Eben. Hast du mal richtig Zeit.“
„Ich bin doch nicht bescheuert! Ich kann das alles!“
Natürlich war ich auf diese Behauptung vorbereitet und wedelte mit dem letzten 6er-Vokabeltest. Mein Pubertikel tippte sich an die Stirn und verzog sich beleidigt in sein Zimmer.
Keine zwei Minuten später galoppierte er in die Küche, wo ich gerade gegen eine Pfanne Bratkartoffeln focht. „Okay, mach ich. Aber heute ist der erste Ferientag, heute muss ich mal chillen! Morgen fang ich an. Kann ich abhauen?“
Ohne Essen. Ich nickte. Er hatte ja Ferien.
Nächster Tag schwimmen; dann Tennis und was weiß ich. Kam auch Etliches an Besitz abhanden, siehe unsere „Siebensachensaldo“-Story. Ich brauchte halt auch mal meine Ruhe. Und die nahm ich mir. Bis zum letzten Feriensonntag.
„So, Kerlchen“, sagte ich, als ich kurz nach elf Uhr vormittags die Treppe zum Pubizimmer hinaufstieg und das Kind noch selig ratzte: „Wie schaut’s aus?“
„Ey, wat willst du denn?? Haste mal auf die Uhr geguckt??!“
„Latein, mein Großer.“
„Hab jeden Tag früh und abends Vokabeln gelernt. Kann jetzt alles.“
„Konntest du vor den Ferien auch schon …“ (Ich kann mir das einfach nicht verkneifen!)
„Klar, Mann, Mutter. Aber jetzt noch besser!“
„Gut, dann frag ich dich nachher ab.“
„Ich will aber Tennis spielen!“
„Liegst ja noch im Bett. – Nach dem Mittagessen überprüfen wir.“
Zwar straffte ich mich innerlich, doch mein Pubertikel widersprach nicht.
Auf dem ersten Treppenabsatz wartete Geflügelchen auf mich. Sie hatte gelauscht. „Mir gefällt nicht, dass mein Bruder nicht mit dir Schule spielen will! Er weiß doch, wie gern du das machst.“ Sie zuppelte am Saum meiner Bluse: „Wenn du möchtest, spiel ich mit dir.“
Sie zog mich in ihr Zimmer und drückte mich auf den Besucherstuhl vorm Kaufmannsladen. „Stell mir mal eine Rechenaufgabe!“
Ich dachte nach …
„Pass auf“, sagte ich: „Du hast 3 Euro und möchtest einen Ball und einen Badeanzug kaufen.“
„Will ich nicht!“, unterbrach sie mich. „Ich will einen Bikini!“
„Gut“, sagte ich: „Von deinen 3 Euro möchtest du einen Ball und einen Bikini kaufen.“
Meine kleine Henne nickte.
„Der Ball kostet 2 Euro, der Bikini kostet 2 Euro. Kannst du beides kaufen?“
Geflügel guckte traurig und schüttelte den Kopf. Doch dann huschte ein Sonnenstrahl auf die Hühnerstirn. „Du zahlst mit Karte, kriegen wir beides umsonst!“
Ich schüttelte den Kopf: „Karte verloren.“
„Um Gottes Willen, dann müssen wir doch verhungern!“ Spornstreichs schwammen die braunen Äuglein in einem See.
„Engelchen“, ich zog das Kleine auf meinen Schoß. „Ich habe meine Karte nicht verloren.“
„Dann sag das auch nicht …!“ Geflügelchen zog die Nase hoch.
„Ist gut. Ich habe sie daheim vergessen.“ Dann wiederholte ich: „3 Euro hast du. Der Ball kostet 2 Euro, der Bikini auch 2 Euro. Wieviel kannst du kaufen?“
„Was ist denn auf dem Bikini drauf??“
„Schatz …“, ich streichelte ihr übers Köpfchen. „Du wolltest doch rechnen. Ist ganz egal, was auf dem Bikini drauf ist! Er kostet 2 Euro. Der Ball auch. Wenn du beides willst, wieviel Geld brauchst du?
„4 Euro!“
Na bitte. Mutter wollte sich gerade lächelnd zurücklehnen, als das Kleine fragte: „Was ist jetzt nochmal auf dem Ball drauf??“
Die Zeit verrann und mir kam an diesem Sonntag – wie schon die ganzen Ferien – immer wieder etwas dazwischen. (Bin eben nicht nur Pubertikel-Mutter)
Irgendwann kreuzte mein Youngster auf. „Gleich bin ich weg. Bin mit Robin zum Tennis verabredet!“
„Und die Vokabeln??“
„Dann mach hin, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit!“
Ich warf einen Blick in das aufgeschlagene Lateinbuch, sagte: „Tyrannus*?“, und rührte weiter in meinem Suppentopf.
Nach angemessener Bedenkzeit knurrte ich: „Weißt du nicht mal das erste Wort?? Mann, Wortstamm ‚Tyrann‘, da muss es einem doch klingeln!“
Keine Reaktion.
„Hallo??“ Ich drehte mich um. Keiner außer mir in der Küche. „Kerl, wo steckst du eigentlich??“
„Bin im Keller, hol mir eine Flasche …“, tönte es dumpf von Untertage.
Plötzlich eine Detonation!
Schrie keiner um Hilfe, ich hörte auch niemanden fluchen: Musste draußen gewesen sein.
„Bürschlein, geht das hier mal weiter??“, rief ich nach eine Weile.
„Kleines Malheur passiert …“
Also doch! Ich stürzte in den Vorratskeller.
Pubi hatte sich in die Ecke zwischen Regal und Sportzeug-Haufen gezwängt und beobachtete fasziniert die halbvolle Limoflasche, die in einer großen Pfütze schwamm. Gelbe Fontänen spritzten gleichmäßig aus dem Plastikgehäuse. Mit einem Blick erfasste ich, dass es der klebrigen Brühe gelungen war, wirklich jeden Winkel des Regals zu wässern.
„Du Rindviech!“, schimpfte ich los. „Was stehst du hier rum! Hol einen Eimer, Mensch!“
„Weiß nicht, wo einer ist.“
„Einen Schritt rückwärts und du sitzt drin!“
Ich wollte absolut nicht wissen, wie es ihm gelungen war, die Flasche in einen Springbrunnen zu verwandeln – wir reden jedoch von meinem Pubertikel und der wollte genau jetzt loswerden, was passiert war:
„Ich hab nichts gemacht!“ Er stellte sich zwischen mich und den Eimer. „Ich fummel die Flasche aus der Folie …“ Er bückte sich und griff nach der letzten Limoflasche. „Wie ich mich eben wieder aufrichte, hau ich mir den Kopf an der Türe an. Guck hier!“ Er zeigte auf die Verschlusseinrichtung der Kühlkammer. „Vor Schreck rutscht mir die scheiß Flasche aus der Hand … Guck, das war höchstens soviel überm Boden!“ Pubi stand leicht gebückt und die Flasche baumelte vergnügt von seiner Hand. Noch ehe er den Vorgang zu Ende erklärt hatte, geschweige denn wiederholt, wurde ich wild: „Mach das du hier raus kommst, oder ich dreh durch!!“
Pubi trollte sich. „Voll die Billigqualität“, nuschelte er. „Wie die sich erst aufgeregt hätte, wäre die dusselige Flasche in meiner Bude explodiert …“
Mit dem gelben Gesabber verfuhr ich, wie man das gemeinhin mit ungewollten Flüssigkeit macht: auftunken, dann nass abwischen.
Nach kurzer Zeit steckte Pubi erneut den Kopf in den Vorratskeller: „Wie’s hier aussieht, Mütterlein, brauchst du mindestens noch drei Stunden. Ich hau dann jetzt ab!“
So langsam kriegte ich einen zuviel! „Schnapp dein Lateinbuch und lass dich vom Papa abfragen!“, wetterte ich. „Und anschließend schwingst du in deiner Bude den Staubsauger!“
„Das mit dem Abfragen verstehe ich ja gerade noch“, empörte sich mein Pubertikel, „aber was haben diese dämlichen Latein-Vokabeln mit staubsaugen zu tun?!“
„Nichts“, stimmte ich zu. „Mutter wienert Keller; Pubi unterm Dach!“
Fünf Minuten später besuchte mich mein Mann: „Fertig.“
„Die ganze Lektion? Einschließlich Grammatik??“
„Er kann alles.“
„Klar …“ Ich stöhnte.
„Tipptopp sauber hier“, sagte mein Mann anerkennend. „Von mir aus kann er die nächste Flasche in den Heizungskeller schmeißen!“
* tyrannus (lat.) = Gewaltherrscher
Weil mein Pubertikel sich beim Freeride-Sprung über eine Grube verschätzt hatte, verbrachte er letztes Jahr den ersten Tag der Osterferien in der Notaufnahme und den Rest der Ferien im Bett.
Damit sich das in diesem Jahr nicht wiederholt, ließ er sich am Tag vor den Ferien das Bike klauen. So was macht er nicht etwa klassisch: Schließt das Bike an eine Laterne und wenn er zurückkommt, hat es ein Bedürftiger mit dem Bolzenschneider abgezwackt – Nein! Wenn mein Pubertikel etwas macht, dann bloß nicht so wie alle anderen!
Bis zu den Osterferien besaß das Kind ein richtig gutes Freeride-Bike. Stabile und zuverlässige Verarbeitung, es sollte ihm ja nicht bei seinen waghalsigen Sprüngen unterm Hintern zusammenbrechen. Cool anzuschauen war es außerdem.
Eine elterliche Regel lautete: Nicht mit dem Bike zur Schule fahren!
Nun war es aber so, dass in den letzten Wochen ab und an der öffentliche Nahverkehr streikte. Am ersten Streiktag fuhr Pubi brav mit seinem verrosteten Hollandrad. Doch bereits am nächsten Morgen huschte er klammheimlich mit dem Bike aus der Garage. Irgendwie dachte ich an jenem Morgen schon, ich sehe es nicht wieder. Wie überrascht war ich, als am Nachmittag das vertraute Rollgeräusch über den Kanaldeckel der Einfahrt donnerte.
Zuerst schimpfte ich mein Pubertikel, dann aßen wir zu Mittag.
„Was du dich nur aufregst, Mutter, es stehen immer zwei Lehrer vor dem Radkeller. Die lassen keinen Dieb rein!“
Dritter Tag, Streik vorbei – Pubi wieder heimlich mit dem Nobelrad in die Schule. Langsam platzte mir der Kragen.
„Lehrer stehen jetzt immer vor dem Radkeller, denen gefällt es da.“
„Entweder nimmst du das alte Rad, oder du fährst Bahn! Haben wir uns verstanden?“
„Klar“ Pubi nickte. „Ist eh mächtig öde, den Berg raufzustrampeln.“
Ich hatte die Sache damit vergessen, nicht so jedoch Mülheims fahrradkriminelle Subjekte.
„Ey, Bruda, voll geiles Fahrrad, ey! Lass ma fahren!“
„Ne, Mann, besorg dir selber eins.“
„Mach isch ja! Mach isch. Lass ma fahren, ey!“
„Nein, warum sollte ich, kenn dich doch gar nicht!“
„Hier, meine Nummer. Gib ma deine! … Siehst du, Bruda, jetzt kennen wir uns.“
Nächster Tag, der Typ wartet schon an der Bahn: „Ey, lass ma dein vollgeiles Fahrrad fahren!“
„Ne. Bin mit der Bahn, siehste doch.“
Dritter Tag, Treffpunkt Bahnhaltestelle:
„Ey, Bruda, lass ma dein vollgeiles Fahrrad fahren! Will auch eins. Lass ma Probefahrt machen. Kriegst du morgen wieder. Isch schwör!“
Und was macht mein Pubertikel? Sie ahnen es? Mein Pubertikel fährt heim und holt sein Bike, während der Typ und ein paar seiner Cousins oben an der Straße warten.
„Voll nett, ey. Kriegst du morgen wieder. Isch schwör!“
Nächster Tag, Pubi kommt zum Treff, der Typ auch: „Ey, Bruda, Bike ist geklaut. Voll scheiße, ey. Sorry, Mann!“
„Wie, geklaut?“, Pubi fällt aus allen Wolken. „Du hast doch geschworen!“
„Ja, Mann. Voll scheiße gelaufen. Isch fahr Innenstadt, kommt Typ und sagt: ‚Darf isch mal fahren?‘ – Isch sag: ‚Klar, Mann, aber nur eine Runde!‘ – Typ sagt: ‚Geht klar!‘ Fährt Runde, kommt wieder, fragt: ‚Darf isch noch eine?‘ – Isch sag: ‚Klar, Mann.‘ Typ fährt – Kommt nisch wieder.“
„Ja und, wer war das??“ Pubi ist schockiert.
„Keine Ahnung. Kenn den nisch.“
„Und jetzt?“
„Darfst du nix verraten, wenn rauskommt, muss isch acht Monate in Bau!“
„Und mein Rad?“
„Isch halt Augen offen, Bruda. Isch muss los. Verrat nix!“
Weil Biken nun ausfällt, muss mein Pubertikel die Ferien anders verbringen. Er beginnt mit Fußball. Wir sprächen nicht von meinem Pubertikel, verliefe das Spiel rund. Pubi steigt in der Mannschaftskabine in seinen Sportdress und weil er keinem was klaut, tut das mit seinen Plörren auch niemand. Der andere wusste das offensichtlich nicht und nahm sich des Pubis Smartphone. Wir fassen zusammen: Kein Bike, kein Handy – und die Ferien waren noch nicht einmal richtig angelaufen.
„Mutter, lass mich bitte an deinen Computer, damit ich mich über Facebook verabreden kann.“
Für den nächsten Tag wollten die Kumpanen grillen.
„Hilfe!“, sagte ich zu meinem Mann.
„Da passiert nichts, mach nicht so einen Stress!“, beruhigte er mich.
Bürschlein zog also gleich nach dem Aufstehen, gegen früher Nachmittag, mit Grillfackeln und Aluschalen los. Neuerdings schleppt er auch grundsätzlich einen kompletten Satz Wechselkleidung einschließlich Jacke mit, wenn er das Haus verlässt. Wieso er das in seinen Schulrucksack stopfe und nicht mit einem Freizeitrucksack losziehe, wollte ich wissen.
„In die Natur muss man tarngrün gehen!“, entrüstete er sich.
Ich winkte ab.
Zwei Stunden hörten wir nichts, dann dudelte bei meinem Mann der Whatsapp-Ton. Mein Mann reagierte nicht.
„Guck mal nach“, sagte ich. „Könnte dein Sohn sein.“
„Quatsch“, sagte mein Mann, „der ist grillen.“
„Eben“, sagte ich.
Mein Mann stöhnte und griff nach dem Iphone.
Dann stöhnte er noch mal. Nur lauter.
„Was ist los?“, fragte ich.
„Der Rucksack ist ihm von der Eisenbahnbrücke gefallen …“
„Na und? Soll er ihn halt holen.“
„In die Ruhr ist er gefallen“, knurrte mein Mann.
„Wer? Der Schulrucksack??“
„Mensch, Weib, es sind Ferien!“ Mein Mann wirkte gereizt.
„Wer liegt denn jetzt im Wasser??“ Vielleicht konnte er sich mal klarer ausdrücken!
Mein Mann sprang auf. „Ich fahr da jetzt hin!“
„Pubi oder der Rucksack??“, rief ich ihm hinterher.
Die Ferien nahmen ihren Lauf und mein Pubi verabredete sich für den Abend zu einem Tennismatch in seinem alten Verein.
„Der Papa fährt heute Abend auch nach Oberhausen, er nimmt dich mit.“
„Ne, keinen Bock. Ich fahr mit der Bahn. Vorher gehen wir ins Freibad.“
„Was macht ihr?? Wir haben 10 Grad!“
„Egal. Sonne scheint.“
Zwei Stunden später der Whatsapp-Ton auf meines Mannes Handy. Mein Mann kam gerade von der Arbeit und wollte ein wenig ruhen.
„Geh ran, Mensch“, ich drückte ihm sein Iphone in die Hand. „Ist bestimmt dein Sohn!“
Mein Mann knurrte und als er das Gerät entsperrt hatte, knurrte er noch einmal.
„Was ist diesmal passiert?“ Innerlich zitterte ich.
„Diesmal hat er seinen Tennis-Rucksack in der Bahn stehen gelassen!“
Die restlichen Ferientage verbrachten wir friedlich bei den Großeltern auf dem Land. Bilanz dieser verdammt teuren Osterferien: ein geklautes Fahrrad und ein geklautes Smartphone. Verloren: eine vollständige Tennisausstattung mit Schläger und Dress, Badebekleidung, zwei Rucksäcke, zwei Eau de Toilette, eine Kapuzenjacke und ein Shirt.
Als sich mein Pubertikel vorhin zum Training verabschiedete, kam er noch einmal ins Haus: „Mutter, ich will schnell fahren, ich nehm dein neues Rennrad!“
„Untersteh dich!!“ Da kriegte ich ja gleich Herzflattern.
„Wieso das denn nicht?? Nenn mir einen vernünftigen Grund! Einen einzigen nur!“
Seit meinen Münchener Balkonzeiten besitze ich einen Satz billiger, weißer Plastikstühle. Dreimal zogen wir gemeinsam um, in meinem letzten Haus staubten sie im Keller – jetzt lungern sie im Garten herum.
Sie merken es: Ich trenne mich ungern von Sachen. Kann man alles noch gebrauchen. Sowieso wird sich bei einem meiner Mitbewohner spätestens vier Wochen, nachdem ich ein Gedöns entsorgte, das dringende Verlangen danach einstellen. Kann man sich die Lamentiererei sparen und den Krempel gleich behalten.
Jetzt ist es aber so, dass ich für ein richtig gutes Foto fast alles mache. Exzellente Lichtverhältnisse unter den Bäumen, ein putziges Viech auf der Wiese – egal wofür ich flink meine Kamera zücke und Richtung Garten halte: Immer ist einer der dämlichen Stühle mit drauf.
Letzte Woche ist mir dann der Kragen geplatzt. Ein Eichhörnchen klaute meine Weihnachtsnüsse und verbuddelte eine nach der anderen auf der Wiese. Ich rannte zum Fotoapparat. Als Kamera und ich bereit waren – wühlte der Puschelschwanz genau unter einem Stuhl!
Als Erstes rief ich meinen Mann an, anschließend den Sperrmüll. Meinem Mann klappte die Kinnlade runter: „Ehrlich, du trennst dich von deinen Stühlen?? Hätte ich nicht gedacht …“
Solche Stichelei überhöre ich. „Bei der Gelegenheit können wir gleich ein paar Kinderfahrzeuge mit entsorgen …“
„Fahrzeuge auch??“ Mein Mann strahlte durchs Telefon.
Vorigen Freitag sollte der Sperrmüll kommen. Am Abend ging ich mit Geflügel zum Aussortieren in den Garten. Mit mir kann man alles verhandeln– nur eine Frage des Arguments – aber nicht mit meiner kleinen Henne! „WAAAS? DU WILLST MEIN KAPUTTES BOBBYCAR WEGSCHMEISSEN??“ Der Hühnerkopf lief rot an. „DAS GEHT NICHT!“, teilte sie der Nachbarschaft mit und feuerte den Grund hinterher: „DAS BRAUCHE ICH NOCH!!“
„Deswegen parkt es seit einem Jahr unter der Birke.“ Ich nickte. „Nichtsdestotrotz stellen wir es jetzt raus. Den Kipplaster und die Wippe auch.“
„NEIIIIIIIIIIIIIN!“
Ich erinnerte mich des Eichhornshootings und machte trotz des Gebrülls klar Schiff.
Irgendwann gab mein Geflügel auf und ratterte auf den trennungsbereiten Fahrzeugen durch die Einfahrt. Ihre Kuscheleule hielt sie unter den Arm geklemmt, sie wartete aufs Pubertikel.
Mitten in der Nacht fiel mir ein zu klein geratener Handgepäckkoffer ein. Mit ihm war ich auch schon mehrfach umgezogen. Ich holte den Koffer aus dem Vorratskeller und stellte ihn an den Straßenrand. Fahrzeuge, Stühle und Wippe waren verschwunden, die hatte schon jemand abgetragen. Ich freute mich, weil mich dauerten die Sachen.
Am Morgen, ich richtete mich gerade mit einem Kaffee am Schreibtisch ein, schnaufte die Müllabfuhr den Berg herauf. Der Laster hielt, ein Mann stieg aus, spähte ums Haus, dann fuhr er weiter. Auch der Handgepäckkoffer hatte noch in der Nacht einen neuen Besitzer gefunden.
Danach war es ruhig und ich begann meine Arbeit. Gegen später Vormittag rief Meersau Eddy nach mir, er fühlte Appetit auf Wiese. So ist es immer: Mitten in meinen lesenswertesten Ideen kriegt einer Hunger. Also schnappte ich ein Eimerchen und eilte nach draußen. Bloß nicht den Gedanken verlieren! Als ich in die Gierschkolonie hinter dem Rhododendron abbog, traute ich meinen Augen nicht! Ein Bobbycar, ein Kipplaster und eine Wippe hockten unterm Tannenbaum. Dahinter winkten vier weiße Plastikstühle. Alles tief ins Gebüsch geschoben und vom Haus aus nicht zu sehen. „Dusselige Plagen!“, knurrte ich und rupfte für Eddy eine handvoll schmackhafter Wildkräuter.
Meine kleine Sau wartete vergnügt an der Terrassentüre und ich rief erneut beim Sperrmüll an.
„Wir waren doch erst heute bei Ihnen …“ Die freundliche Dame wunderte sich.
„Meine Kinder … alles Spielzeug wieder da. Sie verstehen?“
Die Dame lachte. „Nächste Woche, gleiche Zeit. Ist Ihnen das recht?“
Und wie mir das recht war!
In der nächsten Woche stellte ich es schlauer an: Am Vorabend setzte ich mein Geflügel zu „Heidi“ an den Fernseher und schleppte heimlich aus dem Garten zur Straße.
„Wohin willst du mit meinem Bobbycar, Mama?“
„Der Papa muss einen Baum stutzen, in der Garage steht es sicherer.“ Mann, die soll fernsehen, kriegt doch sonst auch nichts mit, wenn die Glotze läuft!
Heidi rannte mit den Ziegen und ich mit der Babywippe.
„Muss die auch in die Garage?“
„Ja, mein Schatz. Pass du genau bei Heidi auf und erzähl mir nachher, was passiert ist!“
„Gerade frühstückt Heidi, es gibt Brot und Käse, der Öhi macht Ziegenmilch warm …“
„Nachher, habe ich gesagt. Jetzt bringe ich erst deine Sachen in Sicherheit!“
„Ich will auch was essen. Machst du mir ein Brot mit Käse und Ziegenmilch?“
Ich stöhnte und stellte meine Wippe ab. Essen beim Fernsehen. Meinetwegen. Hauptsache das Kind mischt nicht weiter mit!
Käsebrot und Pudding klärten die Sache für mich. Den Sperrmüll stellte ich halb unter den Carport, damit er vom Fenster aus nicht zu sehen war. Irgendwie vergaß ich das Zeug auch gleich, war ja fort.
Nächster Nachmittag: Ich fahre mit Geflügel zum Einkaufen. Biege oben auf die Hauptstraße – liegt vor einer der Villen am Waldrand ein großer Haufen Sperrmüll. Zwischen Weinregalen stapeln weiße Plastikstühle. Ich wundere mich noch, wieso die auch so billige Stühle haben, die können sich wahrlich teureres Stuhlwerk leisten – als Geflügel ruft: „Guck mal, Mama, die haben auch so ein kaputtes Bobbycar wie ich! Und so eine Wippe habe ich auch! Wieso steht das denn am Straßenrand? Haben die nicht Angst, dass das denen einer klaut?“
Jetzt langt es mir aber! Nochmal will ich das Zeug nicht in meinem Garten wiederfinden!
„Ich vermute …“ Erst quatschen, dann denken. In meinem Kopf gähnt ein Loch.
„Was vermutest du?“ Das Kleine hängt gespannt an meinen Lippen.
„… einen Moment, muss eben auf den Verkehr achten!“
„Welchen Verkehr, wir sind doch allein auf der Straße …“
„Die ziehen um. Gleich kommt der Wagen wieder und lädt die Sachen ein!“
„Kann ich verstehen, ich möchte auch nicht dort wohnen.“
„Wieso das denn nicht?“
„Mitten im Wald. Nachts kommt der Wolf. Beißt ins Bobbycar …“
Ein Seitenblick: Nein, sie will mich nicht foppen. Zusammengerollt kauert sie auf dem Beifahrersitz. Ganz klarer Fall: Bis die beim Sperrmüll das mit dem Zwischenlager geregelt haben, fahren wir woanders lang!
Als wir in die nächste Straße einbiegen, schellt mein Mobiltelefon. „Pubertikel“, leuchtet im Display. „Mutter, suchst du bitte aus dem Handgepäckkoffer mein Geld raus, ich bin gleich da und muss dann fix wieder weg!“
„Was denn für ein Handgepäckkoffer?“
„Der schwarze im Vorratskeller, den nie einer nimmt!“
„Wieso ist da dein Geld drin??“ Verdammt stickig im Auto. Ich drücke den Scheibenöffner.
„Ihr habt doch gesagt, wenn ich zum Boxen will, muss ich das Geld selbst beschaffen. Jetzt habe ich genug gespart!“ Mein Pubertikel macht eine stolze Pause. „Heute ist Training. Ein Vierteljahr kann ich mitmachen!“
Astrologisch gesehen ist mein Geflügel ein Fisch. Das ist auch der Grund, warum wir jeden Sonntag schwimmen gehen. Ginge es nach mir, könnte ich gut auf die Planscherei verzichten, ich friere sowieso die ganze Zeit. Aber was ist schlimmer: Zwei Stunden Gänsehaut – oder bis Mitte der Woche Gespräche, wie unfair es ist, das kleine Ding nicht gedöppt zu haben.
Sonntag war es wieder so weit: Keiner röchelte, keiner zog die Nase hoch – ich konnte mich nicht vorm Schwimmen drücken. Andere Eltern auch nicht, es ging zu wie in einer Makrelenbüchse. Es fing schon damit an, dass wir keine freie Kabine fanden. Mein Kleines schreckt so etwas nicht, es stieg im Gang aus seiner Buxe. In meinem Alter präsentiert frau sich nur mit Feigenblatt – auch mein Mann zog es vor, zu warten.
„Die Mama ist dünner, ich geh mit der Mama in eine Kabine!“
„Du bist doch schon fertig!“, wehrte ich mich.
„Soll mich derweil hier draußen einer klauen?“
„Bewach du mal besser die Tasche!“, sagte mein Mann. „Kannst auch schon den Tauchring raussuchen.“
Herrlich, wenn man seinen Wandschrank für sich allein hat! Geflügelklein kramte vor der Tür und ich beeilte mich. Als ich mich eben nach dem Türöffner bückte, hörte ich eine Frauenstimme: „Du hast aber viel Zeug dabei, Schätzelein … Wie komme ich hier vorbei?“
Ich riss die Tür auf. Der Gang war mit Handtüchern, Jacken, Shampoo und Duschgel ausgelegt. Mein Geflügel hatte die Schwimmtasche ausgeräumt und hockte inmitten einer Kleidersammlung.
„Was treibst du denn hier??“
„Ich kann den verflixten Tauchring nicht finden …“ Ohne aufzublicken kramte sie weiter und ein rosa Socken mit Sternchen hob ab. Just in dem Moment, als er auf den Haufen stürzte, jubelte mein Kleines: „HIER IST JA DER RING!“
„Lag ganz unten in der Tasche und die ist jetzt leer, nehme ich an …“
Das Kleine nickte. Es drehte die Tasche um und klopfte auf den Boden. Dabei rollte eine Münze heraus und entwischte unter eine Kabine. Mein Geflügel warf sich auf die Knie und robbte blitzschnell hinterher. Als es bis zum Hintern unter der Kabinentür verschwunden war, kreischte eine Frau: „SCHÄTZELEIN! DU SCHON WIEDER!“
Ich knurrte und zog mein Geflügel am Bein heraus. Stolz öffnete sie ihre kleine Hand: „Guck, ich hab das Geld!“
Später im Becken, wir waren noch nicht einmal richtig nass, fragte mein Geflügel: „Was haben wir zu Essen dabei?“
„Engelchen, du weißt doch, dass man hier drin nichts essen darf!“ Ich zeigte auf das Wandbild mit der durchgestrichenen Wurst. „Im Auto kriegst du einen Apfel.“
Mein Geflügel nickte und rannte zur Rutsche. Sie kann zwar schwimmen, aber solche Menschlein behält man besser im Auge. Ich verfolgte, wie sie die Treppe zur Rutsche hinaufwetzte, und wollte mich eben gemächlich zum Rutschauslauf begeben, als ich gewahrte, dass mein Kleines empört den Mund aufriss und schockiert den Eingang blockierte. Zwei Jungen redeten hitzig auf sie ein, woraufhin sie sich setzte und losdüste.
Unten schnippte mein kleiner Korken aus der Rutsche und vergaß die Arme zu bewegen. Ich erwischte sie am Bein und zog sie aus dem tiefen Wasser. „Was war denn los?“
Sie hustete und japste nach Luft: „DA DRÜBEN …!“– Fuchsteufelswild pikte sie mit dem Zeigefinger zum anderen Ufer – „DIE ESSEN BRÖTCHEN! … GENAU UNTER DER WURST!!“
Jetzt ist es so, dass mir die vespernde Familie auch schon aufgefallen war. Beide Söhne kurz vorm Eintritt in die Pubertät – beide mit orangenen Schwimmflügeln. Mutter schien wie ich zu frieren, weil trug Wollhose und Kopftuch. Allein der Vater war unauffällig. Sah man vom Brötchen ab.
„Ich glaube, die gehen nicht oft schwimmen …“, sagte ich zu Geflügelchen.
„Na und?!“ Meine kleine Henne machte sich steif. „Ich habe auch Hunger!“
„Könntest ja fragen, ob du was abkriegst …“, schlug ich vor.
„NEIIIN!“ Zwei Arme krallten sich wie Schraubstöcke um meinen Hals. „Da kommt der Bademeister, der wird übel schimpfen.“
„Dann kannst du ja aufhören, mich zu würgen.“ Ich zog an einem Ärmchen. „Komm, gehen wir ins Wellenbad!“
„Mach doch mal nicht so einen Stress, Mama. Ich will hören, was er sagt!“ Sie entklammerte sich endgültig und paddelte zum Beckenrand.
Das wurde ja noch schöner! Manche Kinder bugsieren ihre Eltern von einer peinlichen Situation in die Nächste. Ich dümpelte ebenfalls zum Rand, tat aber unbeteiligt. Was meinen Sie, wie schnell ich das aufgab, das Schauspiel war verdammt unterhaltsam:
Bademeister: „Sie dürfen im Badebereich nichts essen!“
Mutter kramt in der Tasche, Vater kaut.
Bademeister: „Verstehen Sie mich?“
Vater beißt erneut ins Brötchen, Mutter zieht zwei Milchschnitten aus dem Kühlfach.
„Wenn Sie essen möchten, besuchen Sie bitte unsere Cafeteria!“
Die Jünglinge mit den Schwimmflügeln entreißen Mutter das Kuchenzeug.
„Ihr auch!“, herrscht der Bademeister sie an.
Die Halbstarken fetzen die Verpackung ab und schieben den Kram in die Futterluken.
Bademeister winkt ab und geht.
„Und jetzt?“ Geflügel zittert. „Jetzt holt er die Polizei, oder?“
„Bestimmt“, antworte ich. „Wo das nun geregelt ist, können wir endlich ins Wellenbad gehen.“
Etliches später kommen wir auf dem Weg zur Dusche wieder an den Landratten vorbei. Sie spachteln immer noch. „Keine Polizei da …“, wundert sich Geflügel. „Ach ja, die müssen erst heim, ihre Badehosen holen!“
Im Duschraum sind wir dann allein. Das kommt selten vor. Normalerweise steht unter jedem der zwölf Brauseköpfe ein nasser Mensch, heiße Luft wabert und es ist mächtig laut. Gerade haben wir uns für eine gemütliche Ecke entschieden, als eine Dame mit Pudelmütze die Waschsauna betritt.
Sie stellt sich dicht neben Geflügel und dreht den Duschkopf auf. Das Wasser scheint kalt, denn die Dame quiekt. Das Geräusch wiederum macht Geflügel aufmerksam. Es schaut die Dame an, arbeitet sich hoch zu deren Kopf – da greift auch schon ein kleiner Arm nach mir.
Natürlich ist mir klar, was meine Geflügelmaid loswerden will und ich halte ihr schnell den Mund zu. Als sie mich daraufhin anfunkelt und sich loswinden will, zwinkere ich ihr zu und schüttele leicht den Kopf. Bei dem Gerangel gelangen irgendwie die Füße der Dame in mein Sichtfeld. Leck mich fett, die steht auf High Heels in der Dusche!
Die Dame reißt sich die Pudelmütze vom Kopf und steigt unter den Wasserstrahl. Aus den Augenwinkeln erhasche ich einen kurzen Blick auf verklebtes Haar. Mir bleibt keine Zeit, weiter über ihre schicken Schuhe nachzudenken, denn schlagartig wird das Wasser um uns herum rot.
„Was ist denn hier los??“ Ich springe beiseite und versuche der dunkelroten Pfütze, die sich rasend schnell über dem weißen Fliesenboden ausbreitet, auszuweichen.
„KIRSCHSAFT!“, schreit Geflügel entzückt.
„Oh Gott, Sie bluten, sind Sie verletzt??“ Eilig scanne ich die Dame, kann aber keine klaffende Wunde entdecken.
Geflügel hat sich auf den Boden gehockt und will eben den Zeigefinger in die Brühe tunken.
„Untersteh‘ dich!“ Ich reiße ihr Ärmchen hoch und sie auf die Füße. Die Dame guckt ebenfalls irritiert. Dicke rote Bäche stürzen von ihren Schultern, über Bauch und Rücken und strömen verästelt an den Beinen entlang, ehe sie in die Brühe prasseln und zum Abfluss eilen.
„Am Wasser liegt es nicht …“ Ich gucke an die Decke. Der Wasserstrahl ist hell und durchsichtig. Plötzlich leuchtet das Gesicht der Dame ebenfalls rot. Es ist ein anderes Rot, ein Glühendes, eines von innen. Sie packt sich in die Haare und zieht eine blutgetränkte Hand heraus. „Ich wollte Wasser sparen, ich habe mir daheim die Haare gefärbt …“
Eines weiß ich: In nächster Zeit gehen wir nicht schwimmen! Da stelle ich mich krank!

Käme das Pubertikel nach seiner Mutter, litten seine Erzeuger ziemlich unter Langeweile. Nehmen wir zum Beispiel meinen heutigen Vormittag, der sich bereits gestern wie folgt einstielte …
Auf den allerletzten Drücker steigt mein Pubertikel früh in seine Treter, hat die Türklinke schon fast aus der Wand gerissen – fällt mir ein: „Ich komme erst nach 19.oo Uhr heim, hast du Schlüssel?“
Mein Pubertikel sammelt sich. „Nö … ich nehm‘ deinen Bund!“ Im Flur wird hektisch geklimpert, der Schlüsselkorb kracht auf den Boden und der Jung will sich verdünnisieren.
Das glauben Sie nicht, wie schnell ich an der Haustür war. „Nix da!“
Jetzt kann ich das brave Kind schlecht bis zum Dunkelwerden draußen stehen lassen. Gut, es wäre eine Überlegung wert – aber im Winter tut man das nicht. „Ich mach‘ meinen Hausschlüssel ab und deponier‘ ihn draußen, wenn ich gehe.“ (Klar, unter den Blumentopf neben der Türe, wo man sowas halt versteckt.)
Heute Morgen wusste ich davon natürlich nicht mehr und wie ich vorhin heimkomme … bin ich noch eine Runde durch Mülheim gegurkt, Hausschlüssel organisieren.
Passiert ist mir sowas ja schon einmal: Das Pubertikel noch ein herziges Minikerlchen, Freitagmittag, und mein Mann übers Wochenende in Heidelberg. Null Schlüssel weit und breit – nicht mal ein Autoschlüssel – lag alles behütet im Haus.
Nun war aber Sommer und beide Flügel des Doppelfensters zum Garten gekippt. Und wissen Sie was? Es ist ganz leicht, Fenstergriffe von außen zu öffnen und einzusteigen! Das habe sogar ich beim ersten Anlauf und ohne kriminelle Energie geschafft.
Also, Leute, macht die Fenster zu, wenn Ihr geht!
Althergebracht ist bei uns die Weihnachtsbaum-Beschaffung durch den Haushaltsvorstand geregelt. Wenn ich da jedoch drauf warte, ließe sich Ostern mit einem Baum rechnen.
Was meinen Sie, wen ich gestern beim Baumkauf auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums getroffen habe?
Einen meiner Liebsten: Hawaiihemd-Gartenzwerg!
Fast hätte ich ihn nicht erkannt. Er wirkte blass und trug einen dunklen Anorak überm Blaumann. Doch dann formte er die Hände zu einem Trichter und bölkte über die Tannenschonung: „HAM SE IHREN FÜHRERSCHEIN AUFFER MÜLLDEPONIE GEMACHT?!!“
Gut, ich gebe zu, ich parkte ein wenig regelwidrig. Rechts halb auf dem Zebrastreifen; mit der anderen Hälfte im Baumverkauf. Zur Haupteinkaufszeit traute ich mir das nicht. Da würde ich meine anderthalbmannhohe Tanne schultern und über das Parkareal schlendern – doch 11.oo Uhr in der Früh behindern muskelschwere Weiber kein Schwein.
Haiwaiihemd-Gartenzwerg hat übrigens eine Zwergin! Sie scheint nicht weiter bedauernswert, denn sie pflichtete ihrem Vorgartenchef unter Kopfnicken und ebenfalls per Handtrichter bei: „Ja, Sie spinnen wohl!“
Habe ich nur abgewunken und mich dem feixenden Baumverkäufer zugewandt. Flugs wurden wir handelseinig und vier Minuten später war ich wieder weg.
Nun war ich aber mit der kleine Henne angereist und wie wir eben vom Parkplatz rollen, informiert sie mich: „Hier ist übrigens mein Lieblingsladen … Weißt du das?“
„Nein.“ In vierzig Minuten habe ich einen Termin.
„Könnten wir nicht mal kurz …“ Sie lässt nicht locker.
Ich gucke zur Uhr. „Gut, kurz. – Keine Minute länger!“
Im Sturzflug flattert mein Geflügel in die Spielzeugabteilung. Wir sind mit einem beleibten Ehepaar im Gartenzwergalter allein. Die beiden interessieren sich zwar für Barbies, aber sie stehen bis zu den Pferden. Denen wiederum gilt Geflügelchens Aufmerksamkeit. Eben nimmt es verzückt ein Riesenfilly aus dem Regal, als die Frau zu ihrem Mann sagt: „Das hier bekommt Leonie zu Weihnachten von Tante Christa.“
Geflügelchen horcht auf und folgt interessiert dem Zeigefinger. Hochzeits-Barbie! Meine kleine Henne legt die Stirn in Falten.
„Und das hier …“, die Frau nimmt Ken mit Smoking und Wechselwäsche aus dem Regal, „auch.“‚
Mein Kleines flüstert: „Tante Christa kann Leonie nicht leiden.“
„Wieso das denn nicht?“
„Barbie … scheußlich!“ Sie streichelt dem Riesenfilly über den Kopf und presst es an ihr Herzchen.
„Norbert“, hebt die Frau erneut an, als ich eben beschloss, hier schleunigst zu verschwinden, „Norbert, sollen wir nicht die Kutsche für Leonie mitnehmen? Die stellen wir ihr unter den Baum, da wird sie Augen machen.“
Geistesgegenwärtig schnappe ich mein Geflügelchen am Arm und ziehe sie zum anderen Ende des Ganges: „Komm, wir gucken bei den Spielen!“
Doch es ist bereits zu spät. „Leonie war nicht brav!“ , stellt mein Geflügelchen fest.
„Wie kommst du darauf?“
„Vom Weihnachtsmann kriegt sie nichts. Damit sie nicht weint, schenken ihr Tante Christa und die Oma was.“
„Keine Ahnung …“, sage ich vage. „Kann schon sein. – Schau mal, ein Pferdequartett!“
Aus den Augenwinkeln sehe ich, dass die Großeltern uns folgen. Eben drücke ich meinem Engelchen das Kartenspiel in die Hand, als die Frau hinter mir stehen bleibt: „Ah, Norbert, hier dieses Barbiepuzzle bekommt sie von Tante Jutta …“
„Siehst du, was hab ich gesagt!“ Geflügel schaut mich triumphierend an.
„Lass uns mal eben das Filly zurückbringen, das kannst du dir ja vom Weihnachtsmann wünschen.“ Gleich platze ich. Mein Termin – und im Übrigen will ich nicht, dass Omma und Norbert mitsamt der buckligen Sippschaft so kurz vorm Fest Geflügelchens Weihnachtsglauben demontieren. Dieses Jahr macht uns keiner den Weihnachtsmann madig!
„Kannst du es nicht kaufen?“ Geflügelchen knetet dem Filly die Ohren. „Wir könnten es dem Weihnachtsmann schicken, damit er es mir mitbringt?“
Unauffällig schiele ich zum Preisschild. Ich glaub‘, ich steh‘ im Wald!
„Oder ich behalt’s gleich …“, bietet Geflügelchen an.
Doch plötzlich färbt sich der Hühnerkopf rot. „Was ist, wenn der Weihnachtsmann versehentlich die Wunschzettel vertauscht??!“ Eine kleine Hand quetscht sich in meine. „Stell mal vor, er bringt mir, was die böse Leonie sich gewünscht hat! … Barbies! SCHEUSSLICH!!“ Da schnippen doch echt Tränchen aus den braunen Kullern…
„Mach dir keine Gedanken …“ Ich kniee mich auf den Fliesenboden und drücke das Kleine ganz fest. „Hast doch selber gesagt, Leonie kriegt nix. Der Weihnachtsmann hat also auch keinen Wunschzettel von ihr!“

Mit dieser Geschichte, hochgeschätzte Leser, empfiehlt sich die GOOD WORD-Familie für eine Weile.
Wir wünschen Ihnen eine heitervergnügte Weihnachtszeit!
Bleiben Sie uns gewogen und auf Wiederlesen! 😉
Nur Stunden vor dem ersten Advent fragte ich meine Mannen: „Wie schaut’s aus, wer backt mit Plätzchen?“
Alle begeistert, das wird eng in der Küche …
Als der Teig malträtierfertig dalag, waren zwei Drittel meiner Unterstützer verschwunden. Nur mein Geflügelkind harrte mit ungebrochener Begeisterung vor dem Tresen aus.
Wir Frauen arbeiteten hart. Während wir das letzte Blech aus dem Ofen bugsierten, tauchen die Verschollenen auf. Als sie sich endlich trollten, passten die verbliebenen Gaumenschmeichler in die Dose.
Nächster Tag, ich komm heim: Dose leer!
Dafür stand auf dem Tisch, dort wo sich Pubi gemeinhin breit macht, eine vulkangleiche Aufschichtung von Grünkohl. Ein Kasseler-Kotelett ragte aus den Krater.
„Was soll das?“, fragte ich.
„Kein‘ Hunger.“
„Warum packst du dann den Teller so voll?“
„Erst beim Hinsetzen bemerkt …“
Da er letzte Woche schon keinen Kohldampf schob, fand ich es angebracht, ein Gespräch über Nahrungsmittel zu führen: „Du weißt, dass für dein Kotelett ein armes Schwein sein Leben ließ?“
„Ein schlachtreifes Schwein“, prustete mein Pubertikel los, „wiegt 100 kg!“ Er spießte das Kotelett auf und fuchtelte damit herum. „Ist leichter.“
„Eine Idee, wie sich das Schwein vom Kotelett trennte?“
Pubi stilisierte die Hand zu einem Messer und säbelte an seinem Hintern rum.
Aber wenigstens wurde ihm dabei klar, dass seine Mutter nicht behauptete, es läge eine ganze Sau auf dem Teller. „Kennst du eigentlich Protestschweine?“, lenkte er ab. „Die bringen bis 350 kg auf die Waage.“
„Dir helf ich gleich!“, herrschte ich den Kerl an.
„Dänische Protestschweine“, feixte Pubi, „sehen aus wie die dänische Flagge. Rot mit weißen Streifen.“ Er zückte sein Smartphone: „… Ende des 19. Jahrhunderts durfte die dänische Minderheit um Husum ihre Nationalflagge nicht hissen. Sie protestierten, indem sie diese Schweine züchteten und durch die Gegend sauen ließen. Gerne im Vorgarten“, fasste er zusammen.Seine Nachbetrachtung: „Eine Dänin bist du offensichtlich nicht …“, überhörte ich und klopfte ihm anerkennend auf die Schulter.
„Und was ist hier passiert?“ Ich hielt ihm die leere Plätzchendose unter die Nase. Musste er nicht meinen, dass mir sowas über dem Schweine-Exkurs entfiele.
„Habe ich auch protestiert.“
„Wogegen diesmal?“
„Keine gescheiten Süßigkeiten zu finden! Im ganzen Haus nicht!“
Geflügel flatterte die Treppe runter: „JUHU, WIR BACKEN WIEDER!“ Dann legte sie ein Fingerchen an den Mund und flüsterte zum Ausgemergelten: „Sei anständig brav, Freitag kommt der Nikolaus!“
Gestern beim Mittagessen sagte ich zu meinen Kindern: „Übrigens, meine Lieben, morgen gehe ich zu einem Seminar.“
„Boah, nicht schon wieder!“ Die Gabel verdrückt sich aus Pubertikels Klammergriff und landet scheppernd in den Erbsen. „Dann gibt’s wieder nichts Gescheites zu essen!“
„Du warst doch erst!“ Solidarisch klirrt das Besteck meines Gefügels ebenfalls aufs Prozellan. „Außerdem kannst du alles. Was willst du denn schon wieder lernen??“
Die Standpunkte der Kinder sind dargelegt, jetzt darf ich: „Bei meinem letzten Seminar lag noch Schnee!“ Die beiden haben sie wohl nicht alle.
„Na und?“ Mein Pubertikel echauffiert sich: „Meinst du, das haben wir deswegen vergessen?“
„Hat er nicht“, pflichtet das Geflügel bei. „Als er letztens bei McDonalds zwei von den labberigen Brötchen aß, sagte er, er sucht sich eine andere Mama, wenn er noch mal Spaghetti Bolognese aus dem Ding da zu essen kriegt.“ Sie zeigt auf die Mikrowelle.
Ich bin entsetzt. So nachhaltig erleben meine Kinder meinen Wunsch nach Bildung.
„Und du?“, frage ich das Kleine.
„Ich bleib bei dir.“ Es schiebt seine kleine Hand in meine Hosentasche. „Aber koch bitte keine Möhrchen mehr!“
Dem Pubertikel scheint klar zu werden, dass das Seminar nicht zu verhandeln ist, denn er fragt: „Was soll’s denn zu Mittag geben?“
„Ich dachte an eine Suppe …“
„Komm mir bloß nicht mit vegetarischem Scheiß!“
Geflügel horcht auf: „Was ist vegetarischer Scheiß?“
„Ohne Tiere“, der Bruder.
„Tiere ess ich sowieso keine!“
„Klar isst du Viecher. Fleisch halt.“
Endlich erbebt das Kleine wieder: „… aus was für Tierchen besteht Fleisch?“
„Will die mich verarschen?“ Mein Pubertikel guckt gereizt. „Schweine, Rindviecher, Zicken, vor allem aber …“, er kneift ins Ärmchen, „solches Hühnergeflügel wie du!“
So schnell kann der Kerl nicht mal die Hand wegziehen, wie ich ihm das Geschirrtuch vor den Latz pfeife, um mir ja rechtzeitig die Ohren zu bedecken.
Aber das Geplärr bleibt aus.
„Bist selber ein Suppenhuhn!“ Mein Geflügel stemmt sich gegen den Stuhl.
Pubertikel feixt. „Hast es begriffen? – Vegetarier sind solche, die kein Fleisch essen.“
Die kleine Geflügelmaid nickt: „Tierchen will ich nicht mehr essen …“
„Du möchtest also Vegetarier werden?“ Pubertikel legt den Arm ums Schwesterchen.
„Will ich nicht! Ich werd Schriftstellerin!“
Neulich erschwamm mein Geflügel Seepferdchen. Das Wetter war jämmerlich, weder Kühlschrank noch Keller boten ein dem Anlass entsprechendes Festmahl. Deswegen beschloss die zu Ehrende: „Wir gehen Pommes essen!“
Auf einen verregneten Samstagabend im Herbst – nun denn …
Selbst der per Whatsapp vom freudigen Ereignis unterrichtete Pubi war überzeugt, man solle nicht zu McLabberbrötchen fahren, sondern die ortsansässige Gastronomie unterstützen. Pommes frittierten die schließlich in jeder Küche. Das Geflügel war es zufrieden und wir zogen los.
„Flammkuchen!“ Pubi klappt die Speisekarte auf. „Mutter, lies! Herrliche Flammkuchen!“
Geflügelschwester wirft ein: „Wenn du hier drin Feuerchen machst, schmeißen die dich bestimmt raus …“
„Hä?“ Pubi ist schwer mit der Karte beschäftigt, ihm tropft der Zahn.
Er entscheidet sich für Garnelen-Flammkuchen im Spinatbett, das Schwimmgeflügel bekommt seine Pommes und wir Alten was Altersgerechtes.
Alle zufrieden – doch plötzlich legt der Pubi sein Besteck beiseite. Von Füllmenge gehandicapt nuschelt er: „Meint ihr, es kommt gut, wenn ich dem Koch einen Verbesserungsvorschlag mache?“
Er fragt vorher??
Mein Mann hustet, bestimmt hat er sich verschluckt.
Zur Sicherheit vergewissere ich mich: „Bitte?“
„Na, was zu verfeinern“, mampft das Kind.
Mein Mann beruhigt sich. „Lass mal hören“, quetscht er hervor.
Pubi gelingt es, ein wenig Platz in seiner Futterluke zu schaffen: „Die Garnelen, die passen voll nicht zu! Schmecken nach nichts …“ Er kaut. „Fehlt Salz und ein deliziöser Schuss Maggi!“
Mein Mann hustet erneut und Pubi bezwingt seinen Flammkuchenrest. „Wem sag ich das jetzt? Der Bedienung oder geh ich in die Küche?“
„Lass bleiben.“ Mein Mann stellt ihm den Salzstreuer vor die Nase. „Augen auf!“
„Maggi hab ich gesagt!“, beharrt der Pubi.
„Untersteh dich!“, mische ich mich ein. „Wir wohnen hier!“
Die Geburtstagsrunde in Hörweite ist mit sich beschäftigt.
„Geh ich halt nochmal mit meinen Kumpanen essen. – Dann sag ich’s dem Koch!“
Mein Mann feixt: „Brauchen wir ja keine Angst zu haben, überfordert dein Budget.“
„Nix da!“ Pubi angelt eine Karte vom Tisch der abgelenkten Runde: „Kostet nur 50 Cent mehr als eine Woche Taschengeld! Das leih ich mir.“
„Habt ihr aber noch nix getrunken.“
„Bringen wir mit.“
„Mögen die im Restaurant gar nicht.“
„Wieso das denn? Ist doch teuer genug!“
Mein Mann stöhnt, entscheidet sich dann aber doch für einen betriebswirtschaftlichen Abriss …
Dem Geflügel wird das Gequatsche zu blöd. „Darf ich mich bisschen umgucken?“
Ich nicke. Das Geflügel schnappt seine Kuscheleule und streunt los. Sie kommt nicht weit: Die Geburtstagsrunde schwelgt in Schenkelklopfern, während Geschenke gereicht werden. Mein Kleines stützt sich auf die Brüstung hinter dem Jubilarentisch und horcht. Nach kurzer Zeit streicht sie die Haare hinters Ohr und reckt es weit nach vorn. Ihrem entspannten Gesichtsausdruck entnehme ich, dass sie nun gut folgen kann.
Auch der Pubi macht Fortschritte. Er scheint den unternehmerischen Ansatz kapiert zu haben: „Gehen wir jetzt – oder krieg ich noch einen Flammkuchen?“
„Zahlen Sie bitte an Ausgang“, sagt die adrette Bedienung zu meinem Mann.
„Wir könnten auch hintenrum raus …“, überlegt der Pubi.
Unauffällig winke ich dem Geflügelchen, doch das denkt nicht daran, dem Bezahlvorgang beizuwohnen: „Wartet“, juchzt es hinter der Holzverschalung, „ich will erst sehen, was die Oma im letzten Geschenk kriegt …“
Die Oma dreht sich um: „Welches kleine Fräulein haben wir denn hier?“
Mein Geflügel erstarrt.
„Komm, setz dich zu uns!“ Die Oma rutscht ein Stück auf der Bank und lächelt. „Wir haben gerade Eis bestellt.“
ZACK, baumelte das Federding an meinem Arm und wir konnten gehen.
Erster Tag nach den Ferien: Da bin ich schon bisschen beschäftigt.
Als ich am Abend die Haustüre aufschloss, wollten meine Jungs gerade los. Fußballtraining für alte Herren – neuerdings mischt der Pubi dort mit.
Die hünenhafte Sporttasche lagerte quer vor der Treppe, deshalb kam ich schlecht in die Bude. Ich fragte, wie lange sie bleiben wollten. Mein Pubi hockte mit aufrechter Frisur an der Bar und zockte auf seinem Handy. Ihn ging das nichts an.
„Was ist jetzt?“, rief mein Mann aus dem Flur. „Wo bleibst du?“
„Hab’s gleich, muss eben noch einen Truppenaufzug einweisen!“ Pubi wischte weiter genüsslich auf seinem Display herum.
Konnte ich gut eine Runde mit meinem Gemahl plaudern: „Schatz“, rief ich aus dem Kühlschrank, „check die Pubi-Plörren! Der ist da defizitär!“
„Dem zieh ich gleich die Hammelbeine lang!“ – War mein Mann etwa schlecht gelaunt? – „WENN DU NICHT SOFORT AUF DER MATTE STEHST, BLEIBST DU DAHEIM!“
Pubi sprang vom Hocker: „Komme!“
Als er an mir vorbeiwieselte, raunte er: „Macht der wieder einen Stress …“
Die Jungs mit viel Getöse zur Tür hinaus – bevor ich mich um den Saustall kümmerte, guckte ich erst mal nach meinem Geflügel. Das lag heimelig in Mutters Bett, seine Kuscheleule fest im Arm und atmete tief. Am liebsten hätte ich mich danebengelegt. Da aber Leute meines Alters nicht kurz nach 20.oo Uhr schlafen gehen und sich das Badezimmer eh auf dem Weg befand, ging ich Haare waschen. Sowas dauert …
Plötzlich – mitten im schönsten Gematsche – schellt das Telefon. Welcher Hirni ruft noch nach der Tagesschau an?! Mit zusammengekniffenen Augen angelte ich nach einem Handtuch. Meine Hand irrte durch ein leeres Fach. Das konnte doch nicht sein, meine Leute wissen immer, wo sie Handtücher finden! Ich reckte mich ein Stück und schließlich erwischte ich ganz hinten einen Zipfel. Zog daran, würgte das Ding fix um den Kopf und rannte runter zum Telefon.
Im Display die Nummer meines Mannes! Just als ich einatmete, er brauche nicht extra anzurufen wenn Fußball ausfiele, es würde mir genügen, wären sie auf einmal wieder da – sagte er: „Wir haben keine Schuhe.“
„Du solltest doch Pubis Sachen kontrollieren!“
„Meine Schuhe hab ich auch nicht! Badeschlappen ebenfalls nicht! Du musst sie uns schnell bringen!“
Hatten die sie noch alle??
„Meine Schuhe stehen im Heizungskeller“, fuhr er fort. „Und Pubis …“
„Seh ich selber“, störte ich seine Überlegung. Pubis Turnschuhe langweilten sich dort, wo vorhin der Hüne die Treppe blockierte.
„Und jetzt schick dich, Weib, wir warten vor der Halle!“
Die Nacht war fast frostig, es regnete und unterwegs zur Autobahn fragte ich mich: In welcher Halle sind die eigentlich?
Ich wählte die Nummer meines vergesslichen Angetrauten – diesmal ging der Pubi ran: „Wo bleibste, Mutter, Spiel geht gleich los!“
„Hättest du deinen Krempel überprüft, liefest du mit der Startelf auf! – Außerdem brauche ich bis Oberhausen eine Viertelstunde!“
„Watt?! Bisse verrückt?? Da hätt ich gleich fernsehgucken können!!“
„Mach den Kopf zu und erzähl deiner herzensguten Mutter, vor welcher Halle ihr campiert!“
Der Pubi fängt also an zu erklären – erstaunlich präzise, ich konnte gut folgen – fahr auf die A3 auf, überholt linke Spur ein schwarzer Audi. Ich guck‘ aufs Kennzeichen (Ich gucke immer auf Kennzeichen!) – entzückt mich das dermaßen, dass ich’s laut lese: „WAT – IS 1“
Mein Pubi erleidet einen altersbedingten Kollaps und brüllt: „WAT IS DA JETZT NICHT ZU CHECKEN, MUTTER??!!“
„Schon gut, erzähl ich dir andermal. – 8 Minuten, stell die Uhr!“
Als ich links zur Halle abbiegen will, schaltet die Ampel auf Rot. Vor bestem Oberhausener Leuchtreklame-Hintergrund zeichnen sich weiter vorn die Umrisse eines Männleins ab. Das Männlein hüpft und winkt. Plötzlich winkt auch etwas neben mir. Ich guck‘ rüber: junger Mann mit Krawatte. Reckt den Daumen hoch und freut sich. Kennen tu‘ ich den nicht. Vermisst er auch was? Winke ich halt mal zurück. Die Ampel schaltet Grün, er grüßt und gibt Gas. Zum Fußball wollte er nicht.
Auf dem Parkplatz vor der Halle reißt Pubi die Beifahrertür auf, krallt die Schuhe und haut ab. Natürlich übersieht er ein Drittel.
„HALLOOO!“, rufe ich hinterher. „Ich wollte nicht mit rein!“
Pubi macht kehrt, beugt sich wieder ins Auto, schnappt die Schlappen. Dabei streift mich sein Blick. Er zuckt zusammen. „Bloß nicht!“, stößt er hervor. „Krasser Kopfschmuck!“
Ich gucke in den Spiegel: Rotes Handtuch, weiße Punkte, fette Hello-Kitty …
Kurz vor 23.oo Uhr schleppte sich mein Pubi daheim über die Schwelle: „Mann, hab ich einen Muskelkater … ich schaff die Treppe nicht rauf … Heut Nacht schlaf ich unten …“
„Junge“, beruhigte ich ihn, „nächstes Mal komm ich später. Da föhn ich mir erst die Haare!“
Ich gehe ja immer gerne ins Kasperletheater. Einerseits weil mich das an daheim erinnert, andererseits der Kinder wegen. Alle Herbste wieder reist ein süddeutsches Puppentheater zu uns nach Mülheim. Kasperls schlagen auf der Wiese ein Zelt auf, Bühnenbild in eine Ecke, weiße Plastikstühle davor (solche, wo man nicht kippeln darf) und los geht es.
Mein Geflügelmädchen und ich schneien eine Viertelstunde vor Anpfiff ins Zelt und kommen in Reihe 8 von 10 zu sitzen. Es ist Familientag und zwei dick verpackte Erwachsene zählen auf ein Kind. Wegen der zu befürchtenden Haltungsschäden sitzen die Ausgewachsenen aufrecht, der Herr vor mir behält gleich noch den Hut auf. Seine Frau beginnt zu schwitzen, stellt den Daunenkragen hoch und öffnet die Jacke weit, damit Luft ran kommt.
Ich frage mein Geflügelchen: „Kannst du sehen, oder soll ich dich auf den Schoß nehmen?“
„Ich seh genug – wenn ich auf deinem Schoß sitze, sieht der Junge hinter mir nichts.“
Der Herr mit Hut nimmt unterdessen sein goldlockiges Enkelkind auf den Arm und die Oma mit dem Daunenkragen schmiegt sich an die beiden. Daraufhin tauschen Geflügelchen und ich die Plätze.
Ein Gong ertönt, der Titel wird durchgesagt: „Kasperle und das Gespenst“
Hinter mir stöhnt eine Frau: „Das hatten die doch letztes Jahr schon …“
Ihre Freundin regt das mehr auf: „Voll der Beschiss! Ich geh denen gleich sagen, dass wir das schon gesehen haben!“
Vorhang ratscht auf, erstes Bühnenbild: Schlosspark.
Die Frau: „Ist das das Schloss vom letzten Jahr?“
Die Freundin: „Natürlich! Wirst sehen, gleich kommt Kasperle!“
Der Junge auf ihrem Schoss. „Mama, Kasperletheater beginnt immer mit Kasperle.“
„Psscht!“, macht die Freundin.
Nach Kasperle hüpft die Prinzessin auf die Bühne.
Die Freundin zur Frau: „Siehst du, gleiche rotbackige Prinzessin wie letztes Jahr.“
Der Junge: „Prinzessinnen sind immer rotbackig.“
Doppeltes „Pssscht!“ der Frau und der Freundin.
Die Prinzessin beschwert sich, dass sie seit ihrem Urlaub nicht schlafen könne. Die Frau: „Ja, ja, das wissen wir noch.“
Vorhang wogt zu, Ende 1. Akt.
Der Junge: „Kommt noch eine Folge?“
Die Freundin: „Was meinst du, was das gekostet hat! Wir bleiben bis heute Abend!“
Im nächsten Akt verbringt Kasperl die Nacht erst mal bei der Prinzessin. Tief sägend hält er Ausschau nach dem Gespenst.
Der Junge: „Kasperle schnarcht so laut wie dein neuer Freund.“
Das Gespenst taucht auf und haut Kasperle mit einem Knüppel auf den Ratzkopf.
In der Reihe neben uns beißt ein kleines Mädchen zitternd in den Pferdeschwanz seiner Mutter.
Kasperle schnippt aus dem Schlaf, zerrt dem Gespenst das Bettlaken von der Rübe – steckt der Räuber darunter.
Das kleine Mädchen neben uns brüllt: „ICH WILL SOFORT HIER RAUS!“
Die Frau hinter mir: „Haben wir das jetzt letztes Jahr gesehen oder nicht? Ich mein, letztes Jahr war die Hexe drunter …“
Die Freundin: „Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern …“
Das kleine Mädchen und die Mutter in unserer Reihe gehen.
Der Junge: „Voll spannende Folge.“
Eine der beiden Grazien hinter uns bekommt eine Whatsapp-Nachricht. Sie hat die Brille nicht dabei, deshalb liest die andere vor. Meine Herren, da bin ich aber rot geworden.
Das Bühnenbild wechselt wieder, diesmal sind wir im Wald beim Teufel. Die Nebelmaschine spuckt und in der ersten Reihe bricht ein Tumult aus: „DER WALD BRENNT! KASPERLE, ES BREEEEEENNT!!“
An mehreren Stellen vor uns springen Mütter auf und bleiben so lange stehen, bis in der ersten Reihe Ruhe einkehrt. Der Akt ist zu Ende – Zuckerwattepause.
„Worum geht’s eigentlich?“ Die Frau hinter mir. „Ich bin irgendwie abgelenkt.“
„Ist doch egal“, antwortet die Freudin, „haben wir doch schon gesehen.“
„Kann ich Zuckerwatte?“, fragt der Junge.
Kein Verb – und nun? Zum Glück wissen Mütter immer Rat:
„Nein, Zuckerwatte schmeckt nur nach Zucker. Das ist ungesund!“
Vorhang zum letzten Akt surrt auf: Das Krokodil schenkt Kasperle einen leuchtenden Zauberstab.
Die Freundin hinter mir: „Siehste, ich wusste doch, dass wir das schon gesehen haben! Derselbe Glitzerstab wie im letzten Jahr!“
Plötzlich fällt ein Schatten auf mich – der Herr mit Hut ist irgendwie gewachsen. Er setzt Goldlöckchen auf Daunenkragens Schoß und dreht sich um:
„Der Gleiche!“, knurrt er mich an. „D-e-r G-l-e-i-c-h-e !“
Als das Schauspiel vorbei ist, wird hinter mir Resumee gezogen:
„Nächstes Jahr sparen wir uns das Geld. Dreimal guck ich mir das nicht an!“
Anfang Juli war ich bereits fett in Urlaubslaune: Jobs ausgeliefert, Kühlschrank spärlich befüllt – wenn’s nach mir gegangen wäre, hätten wir nach dem Frühstück die Fliege machen können.
Weil es aber nicht nach mir ging und meine Mischpoke noch im Joch stand, rief ich aus Langeweile meine Mails ab. War die Heizkostenabrechnung drunter. Was glauben Sie, wie fix Essig aus meiner Urlaubsgrille wurde! Einen halben Herzklabaster erlitt ich!
Als ich wieder sitzen konnte, rief ich meinen Mann an.
„Reg dich ab“, sagte der, „Urlaub ist bezahlt.“
Nachdem ich gebührend gewettert hatte, analysierte ich die Rechnung. Beim zweiten Kaffee war die Nachzahlung in Ordnung. Ich fand heraus, dass die Gasler im Vorjahr vergessen hatten, abzurechnen. Wo keine Jahresrechnung erfolgt, wird auch kein Monatsabschlag erhoben.
Die im Callcenter sagten, das hätte mir auffallen müssen. Natürlich. Sofort übertrug ich in meinen Kalender: „Monats-Erster: Kontrollieren, ob Gasabschlag bezahlt!“
Nun fragen Sie: Wo sie’s doch verbraucht hat – was empört sie sich?
Es ist so: Für eine Abschlagszahlung wird die letzte Jahresrechnung durch 12 verheißungsvolle Monate geteilt. Bei mir bedeutete das demnach seit Juli eine monatliche Rate für zwei Haushalte. Uns – und nochmal solche wie uns.
Über meiner Recherche beschloss ich: Ab jetzt wird Gas gespart!
Derweil kam mein Pubertikel aus der Schule. Postwendend kommandierte ich ihn in den Keller: „Schalte bitte den Warmwassertank aus!“
Zuerst lief das wie üblich: „Wo ist der Keller?“
„Unterm Dach!“
Mein Pubi guckte irritiert und stiefelte los.
Kaum war er unten, bölkte er: „UND DER WARMWASSERTANK, WO SOLL DER SEIN?“
„Im Heizungskeller!“
„HIER IST KEIN SCHALTER! DAS DING LÄSST SICH ÜBERHAUPT NICHT ABSCHALTEN!“
„Am Tank, mach die Augen auf!“
„… soll die ihren Scheiß doch selber ausschalten, ich schick die doch auch nicht, mein Handy ans Ladekabel zu hängen.“ (Dachte er wohl, ich höre das nicht …)
Irgendwann fand er den Schalter und wir verbrachten wundervolle Duschabende im Garten.
Nichtsdestotrotz drehte der Gaszähler weiter! Guckte ich auf meinen Protokollats-Zettel, kriegte ich schlechte Laune. Heizung aus und im Gasrohr betrieb!
Am Wochenende war ich mit Pubi allein daheim. Obligatorischer Kontrollgang zum Gaszähler: weiter gerückt.
Sagte mein Pubi: „Mutter, ich guck im Internet, was der hat!“
Ich war einverstanden – mir war schon klar, er wollte facebooken.
Nach einer Stunde fragte ich: „Und, was herausgefunden?“
„Nö, noch nichts …“
Weil die Idee aber nicht blöd war, suchte ich zu vorgerückter Stunde selber. Wenn Sie keine weiteren Gasgeräte betreiben, aber trotzdem Verbrauch verzeichnen, haben Sie ein Gasleck! Schließen sie sofort den roten Haupthahn!
Himmel, war ich da erschrocken!
Bin ich also hurtig in den Keller und habe den Hahn abgedreht.
Vorhin wollte ich Mittagessen kochen: Jetzt ist auch noch der dämliche Gasherd kaputt …
Wenn schon Ferien, dachte ich mir in einer Sommernacht, könnten wir früh auch was Gescheites essen. Brötchen!
Ich schwang mich also kurz nach 8.oo Uhr zart bekleidet auf’s Rad (die Wetterfrösche schwätzten von Starkregen ab 11.oo Uhr) und sauste meinen Heimatberg runter. Zum Lieblingsdiscounter.
Ohne Ablenkung, weil ohne mein Geflügel angereist, pfiff ich hurtig Lebensmittel von rechts und von links in den Einkaufswagen. Ratzfatz stand ich an der Kasse.
Ein Auge schwiff zum Fenster: Starkregen.
Das andere guckte zur Uhr …
Half ja nichts.
Ein kurzer Plausch mit der Kassiererin: Ihr war das Wetter egal, aber sie guckte anteilnehmend und erklärte, sie führe kein Rad. Mir war das Wetter mittlerweile auch egal, ich hörte nämlich meinen Magen. Freudig klappte ich meinen Geldbeutel auf – EC-Karte weg! Leicht angestresst wühlte ich in den anderen Fächern. Nix. „Kann ich auch mit Kreditkarte?“
Die Kassiererin nickte.
Natürlich funktionierte das nicht.
„Ich habe kein Bargeld bei. Ich muss erst heim, welches holen!“
Wieder nickte die Kassiererin. „Wie lange wird das dauern?“ Sie zeigte auf die Familienpackung Eis. (Kokos mit weißer Schokolade. Lecker!)
„Halbe Stunde. Mindestens …“
„Dann pack ich das zurück in die Kühlung.“ Sie verließ ihr Kassenkabuff. „Und sie kommen auch wirklich wieder??“
„’türlich!“ Ich nickte heftig. Mein Magen. Außerdem hatte ich das Band nicht zum Spaß voll Futter gestapelt.
Strampelte ich also meinen Heimatberg wieder rauf.
An der Haustür empfing mich das Geflügelkind: „JUHU! Brötchen! Ich bin total verhungert!“
„Musst dich gedulden, mein Schatz, Mama hat ihre EC-Karte verloren …“ Schnell drückte ich mich am Kleinen vorbei.
Verflixt! Geheimfach ebenfalls leer.
„Mama, ich hab Geld!“ Sie düste los und holte ihre kleine Sau.
„Schenk ich dir alles!“ Das gelbes Schweinderl landete sanft in meinem Schoß. „Ganz goldenes Geld ist da drin. Hab ich mit meinem Bruder getauscht. Polier ich seitdem jeden Tag.“ Jetzt bekam das Schweinderl den Wanst gestreichelt. „Guck fix rein, wie das glitzert!“
Ich schraubte den Ringelschwanz ab. „Kupfernes Geld …“, korrigierte ich sie. „Was hast du ihm dafür gegeben?“
„Große silberne Geldstücke. Waren mir zu schwer. Und außerdem waren sie schmutzig … Komisch, dass meinen Bruder das nicht stört …?“
„Mein Engelchen …“ Ich nahm das Kleine in den Arm. „Es ist sehr lieb, dass du mir dein Geld schenkst … Aber leider reicht das nicht mal für zwei Brötchen.“
„Verhungern wir jetzt …?“ Braune Äuglein tauchten in einen See. Doch flugs kamen sie zurück ins Licht: „Mama, du isst das eine Brötchen – und das andere, was nicht komplett ist, teile ich mit meinem Bruder! Wir sind kleiner, wir brauchen nicht so viel.“
Ich konnte nicht anders, ich musste mein Geflügelchen küssen. Dabei fiel mir die Tasche meines Sportrades ein. (Seit dem letzten Platten heize ich nicht mehr ohne Notgeld durch die Gegend!)
Es hatte aufgehört zu regnen und ich war endlich wieder auf dem Weg nach unten. Den Pubi könnte ich mir beim Frühstück vornehmen.
Beim Discounter war jetzt deutlich mehr los als bei meinem ersten Besuch. Am Radständer – quer und dreifach angekettet – ein altersschwacher Drahtesel. Da habe ich erst einmal ausgiebig gefeixt. (Trotz knurrendem Magen!) Genauso schnell verging mir das allerdings wieder – Herrschaftszeiten, wo war mein verfluchter Schlüssel??
Ich rang mit mir, das kann ich Ihnen verraten; aber dann nahm ich doch wieder den Berg unter die Pedale …
Zu Hause ein Spalier aus zwei Kindern: Rechts weihräucherte das Geflügel mit meinem Schlüsselbund, links tippte der Pubi den Zeigefinger an die Stirn. “Mutter, wie oft willste jetzt noch hin und her radeln?!“
Da drückte ich ihm meinen Geldbeutel in die Hand und wünschte ihm eine gute Fahrt.
„Und wir beide“, sagte ich zu meinem Engelchen, das bereits empört den Mund aufriss, „beginnen den Tag mit einem Eis!“
Letztes Wochenende sirrte und schwirrte es in meinem ganzen Haus. Nicht einmal auf dem Klo hatte man seine Ruhe.
Aber lassen Sie mich ein paar Worte zur Rahmenhandlung verlieren!
Am Abend vor der Abreise in den Urlaub langte mein Pubertikel so tief in seine Peilo-Kiste, dass meinem Mann der Kragen platze und er des Teenies Smartphone kassierte.
Mein Pubi war schockiert.
„Wat soll ich jetzt die ganze Zeit machen?? Ich langweil mich doch zu Tode!“
„Interessiert mich nicht“, sagte mein Mann, „kannst lesen.“
Sie werden es nicht glauben: Mein Pubertikel las tatsächlich! Den ganzen Urlaub lang. Kaum stieg er aus dem Wasser, haute er sich tropfend in eine Ecke und deckte sich mit Buchstaben zu. Einen Thriller nach dem anderen schaufelte er in sein jugendliches Köpfchen. Da er redselig ist, weiß ich jetzt alles über menschliche Verderbtheit und ich werd‘ den Teufel tun und noch einmal ohne Mikrofasertuch in eine Kneipe gehen. (Ich will da nicht putzen! Mensch, wegen der Fingerabdrücke!)
Die Reise beendet, die Familie zurück im Heim: Der Pubi fröhnt weiter dem Leserausch. Samstag in der Dämmerung – ich war mit Klarschiffmachen nach einem ausführlichen Grillmahl beschäftigt – plötzlich eine gewaltige Erschütterung.
Das Geflügel springt mich an: „HILFE, MAMA, EIN ERDBEBEN!“ Sie hängt so unvermittelt an meinem Arm, dass Grillsauce vom Tellerstapel suppt.
„WAS HAST DU ANGESTELLT??“, brülle ich ins obere Stockwerk.
„Nix. Hab mir nur ein neues Buch geholt.“
„Und dabei ist das Bücherregal umgefallen?? “
„Nö. Ich bin von deinem Bett gesprungen.“
Das Geflügel verleiert die Augen und steigt von mir runter.
Eine Viertelstunde später habe ich das mit der Mülltrennung in der Küche beendet und will das kleine Mädchen ins Bett stecken. Die Nacht ist pechschwarz und windstill. Wir steigen die Treppe rauf und kehren im Bad ein. Über der Putzerei vergeht eine weitere Viertelstunde. Es kommt mir komisch vor, dass so viel Viehzeug rumflattert, aber Badezimmerfenster ist ja geschlossen. Muss am nahenden Herbst liegen.
Als ich endlich oben um die Ecke biege, trifft mich fast der Schlag!
Alle Lichter an!
Das Fenster sperrangelweit offen!
Die Scheibe zitterte, als ich das Fenster zuschmiss und:
„WAS IST DENN HIER LOS??“, brüllte.
Gemächlich kommt mein Pubi angetrottet, ein Buch vorm Kopf: „Du hast geläutet, Mutter?“
„Ich helf dir gleich!“, herrsche ich den Kerl an. „Was reißt du nachts das Fenster auf??“
„War warm, wollt ich lüften …“ Er unterbricht sich und wedelt kräftig mit dem Buch. „EY, DU KACKVIECH, HAU AB!“
Das behaarte Flattertier versteht’s und eiert ins Treppenhaus – die Messingamphore auf der Heizung kriegt sich wieder ein.
„Und das Licht?“, frage ich weiter.
„Welches Licht?“
„MAMA, BEI MIR SIND MÜCKEN!“, ruft das Geflügel dazwischen. „An der Wand sitzen welche und eine auf meinem Kopfkissen!“
Der Pubi: „Bei mir sind die auch! Wo kommen die scheiß Viecher heute her?“
Ich stöhne …
„Hol mir die Fliegenklatsche!“, befehle ich dem Pubi.
„Weiß nicht, wo die ist.“
„Boah, Junge, ich auch nicht!“
Geflügel: „HIER SIND NOCH MEHR MÜCKEN!“
Hilft nix, müssen wir das klassisch erledigen: Festbeleuchtung an, aus dem Hinterhalt anschleichen, draufhauen. Eben justiere ich den erste Vampir im Fadenkreuz, hole aus – hüpft hinter mir der Pubi: „Alda, flatter gefälligst einem anderen gegen den Kopp! Hier steh ich!“
Mücke weg.
„Ich will einen Tomatenstrauch …!“, jammert mein Geflügel
Der Pubi beschwert sich: „In so ner Situation denkt die an’s Essen …“
„Denk ich gar nicht!“, protestiert das Geflügel. „Wenn ich bei Oma bin, stellt sie mir immer einen abgebrochenen Tomatenzweig ans Bett. Mücken mögen das nicht riechen und sie beißen mich nicht!“
„Stechen!“, verbessert der Pubi. „Die Mücken stechen dich und saugen dein Blut.“
„Sollen die aber nicht!“ Jetzt weint das Kleine fast.
Irgendwie hat es mir da gelangt, da habe ich meinen Mann geholt.
Nach dem achtzehnten zermalmten Viech hörte er auf zu zählen. In den nächsten Tagen bin ich beschäftigt: Kadaver streicheln.
Letzte Woche gab es richtig schönen Regen. Da brauchte man nicht gießen und der Wasserhahn für draußen blieb zu, weil für die Fische genug von oben nachlief. Nach dem großen Regen matschte mein Geflügel auf der Terrasse und kippte Regenwasser aus sämtlichen Töpfchen und Schalen in den Teich. Mittendrin, sie hatte gerade ihren Kipplaster rückwärts an die Wasserkante gelenkte, ein paar gelbe Blumen umgefahren und die Ladefläche hochgehievte, setzte ich Rabenmutter dem Wasserspiel ein Ende: Wir mussten los.
„Komme!“, rief das Geflügel. „Ich mach noch schnell den Plätscherbrunnen an, damit die Fische Sauerstoff kriegen. Total heiß heute!“
Ich warf einen Blick zum Thermometer. Immerhin, 17,5 Grad im Schatten.
Als wir am frühen Abend zurück kamen, war vom Wasser nicht viel zu erkennen. Flockige Schaumberge standen zwischen den Seerosen. Wie Zuckerwattehügel sah das aus. Mein Mann stand mit aufgerollten Hosenbeinen am Ufer und schöpfte mit einem Eimer das Zeug ab.
„Was ist denn hier los??“ Ich war entsetzt.
Das Geflügel: „Hurra, Badewanne! Ich will schon so lange mal wieder in eine Badewanne!“
Mein Mann raunzt das Kleine an: „Hast du etwa Schaumbad in den Teich gekippt?“
Statt einer Antwort schnippen Tränchen aus den Äuglein: „Wenn … (schnief) … du mich schimpfts (SCHNIEF), … werd ich ganz traurig. (HEUL)“
Spornstreichs wird der Vater ob der Tränchen ebenfalls traurig, also mischt sich Mutter ein: „Du kannst doch kein Schaumbad in den Teich gießen! Das vertragen die Fische nicht!“
Geflügel: „Da sind auch… (schnief)… Molche drin.“
Der Vater findet seine Sprache wieder: „Die vertragen das genauso wenig. Tiere brauchen sauberes Wasser.“
„Aber, Papa, wir haben keine Badewanne, also haben wir auch kein Schaumbad!“
Ich musste zugeben, da ist was dran. Auch mein Mann nickte. „Was ist das dann für ein Zeug?“
Wir drei zuckten ratlos die Schultern.
„Pubi?“
Mein Mann winkte ab: „Der ist doch nicht bescheuert!“
Nun …
„Wir verdünnen“, sagte mein Mann und drehte den Schlauch auf, während das Kleine den Besen nahm und einen Zuckerwattehaufen zusammenkehrte. Plötzlich ein Kullern und eine große Plastikflasche nahm Reisaus.
„Meine Seifenblasen!“ Das Geflügel ließ Schaum Schaum sein und schraubte begeistert den Verschluss ab. „Komisch. Flasche ist leer. Habe ich doch vorgestern noch mit gepustet …“
Da fiel’s mir ein: Die Seifenblasenflasche lag im Kipplaster. Manchmal klappt das mit dem korrekten Zuschrauben von Flaschen beim Geflügel nicht. Das Zeug ist dann wohl ausgelaufen, hat sich mit dem Regenwasser zusammengetan und ist überm Matschen im Teich gelandet.
Fassen wir zusammen: Seifenblasenflüssigkeit schäumt bei konstantem Teichsprudel gut und die versehentliche Zusetzung von einer Flasche schadet der Teichfauna nichts. Nach einer Woche alle wohlauf. Auf dem Bild ist die zurückgelassene Larvenhaut einer geschlüpften Libelle zu sehen. Man achte auf die Versorgungsstränge, die aus dem Ausstiegsloch am Rücken baumeln. So verbleibe ich also wie in der letzten Woche: Guten Appetit! 🙂
Meine grünen Würste von gestern schlugen manchem Leser unvorbereitet ins Kopfkino. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Deshalb setzten wir heute noch eins drauf.
Wer von Ihnen einen leicht aus der Ruhe zu bringenden Magen hat, dem rate ich, die Lektüre zu unterlassen.
Aber genug der Einweisung, lassen Sie uns beginnen!
Hätte ich mich nicht fürs Schreiben entschieden, wäre ich bestimmt ein berühmter Rationalisator geworden. Weil Mensch aber nicht alles machen kann, verbindet er seine Talente. Genau deswegen lagert bei uns die Schwimmtasche das ganze Jahr fertig gepackt im Keller. Es läuft so: Schwimmen, Krempel trocknen, ab in den Vorratsraum. Bis auf die Badeschlappen vom Geflügel. Weil, bei aller Liebe zur Optimierung, bescheuert bin ich ja nicht. So ein Kleingeflügel wächst schnell, ergo auch schnell aus seinen Schlappen.
Am Wochenende zappelt das Kind auf der Treppe. Gerade noch rechtzeitig fällt Mutter ein: „Geh die Schlappen holen, dann hauen wir ab!“
„Ich hab schon Straßenschuhe an …“
„Ziehst du sie eben wieder aus.“
Das Geflügel gackert vor sich hin: „ … die Mama immer mit ihren blöden Schlappen … Alle Mädchen im Schwimmbad haben pinke Crocs. Ich wühl dann wieder stundenlang am Beckenrand, bis ich meine Schlappen find …“
Ihr Ideenfindungsprozess scheint abgeschlossen, denn sie plustert sich auf: „Ich – brauch – keine – Schlappen !“
Mutter wirft vier Äpfel in die Schwimmtasche: „Brauchst du, im Schwimmbad kann man sich Fußpilz holen.“
Das kleine Ding erstarrt: „An der Kasse?“
„Im Nassbereich. Da wo du barfuß rumläufst.“
„Pilze haben wir lange nicht gegessen …“ Sie guckt verträumt.
Ich sehe den Konflikt und setzte mich auf die Treppe: „Fußpilz ist nicht zum Essen. Der juckt zwischen den Zehen und man muss zum Arzt, eine Salbe holen.“
„Mach ich nicht! Geh ich nicht! Kannst du alleine holen!“
„Ziehst du Schlappen an, kriegst du keinen.“
Sie düst ab.
Während der Fahrt schnallt sie sich los und kriecht in den Kofferraum.
Ich: „Was wird das?“
„Moment …“
Sie wuchtet die Schwimmtasche vor und klettert zurück in ihren Sitz.
„Fräulein!“
Nach längerer Anreise endlich in der Kabine: Bikinis, Badehosen, Handtücher, Proviant … „Wo, verflixt noch eins, sind die Schlappen???“
„Brauchst du nicht weiter suchen, habe ich rausgetan.“
„Wie, rausgetan??“
Einer der Jungs hämmert an unsere Kabinenwand: „Schmeiß mal unsere Schlappen rüber!“
Das Geflügel: „Na vorhin, im Auto …“
„Mensch, was soll das denn??“ Die machen mich echt irre.
Geflügel strahlt: „Wir gehen jetzt alle vier ohne Schlappen schwimmen und anschließend fahren wir zu Oma. Keiner kann so gut Pilze braten wie Oma!“
Sommer und grillen, das gehört bei mir zusammen. Keinen Sommer: Gibt’s auch kein Grillgut. Aber damit geben wir uns nicht mehr zufrieden! Samstag hatte die bei mir daheim die Faxen dicke: Der Eine wollte sein Steak, der Andere versalzene Fackeln. Uns Frauen war es egal, Hauptsache gut durchgebrutzelt. Vom Himmel hätte fallen können was wolle – zur Not wären wir in die Garage gezogen.
Ich ging also am späten Nachmittag einkaufen. Wer denkt, zu dieser Zeit gibt’s nur leere Regale – von wegen! Dichte Grilltheken-Bestückung bei deliziöser Auswahl. Daheim verteilte ich eben auf Aluschalen, hatte mächtig Kohldampf, rief mein Mann: „Fertig gegrillt!“
„Hä?“
„Hier, guck, Wurst ist fertig!“
„Quatsch, ich hab doch gar keine gekauft …“
„Guck doch!“ In der Grillzange klemmte ein Klumpen und das Ganze wedelte dicht vor meinem Gesicht.
„Halt still, ich kann überhaupt nichts erkennen …“
Ich sage Ihnen weiter nichts! Pfui Teufel! Zwei grüne Würstchen. Kuschelig und dicht behaart.
Vor Wochen hatten wir schon mal dem Sturm gestrotzt, doch als dann der Regen losprasselte – klar, in solcher Hast kann man was vergessen.
Jedenfalls musste ich nun erst den Grill putzen!
Das dauerte. Mürrische Zweibeiner strichen mir um die Füße, wobei einer von den Nörglern nur halb so groß ist wie ich. Endlich fertig, die Köstlichkeiten auf dem Grill arrangiert, mein Mann schmeißt den Brenner an: Spuckt das Ding heftig und dann schweigt es. Gasflasche leer.
Die jungen Zweibeiner brüllten los. Das muss die Viecher im Wald bestürzt haben.
Ich fragte: „Pfanne?“
Der Pubi schnaubte missbilligend. Seine Geflügelschwester antwortete ebenfalls nicht. Stattdessen spurtete sie in die Küche und rappelte mit einer Schachtel Streichhölzer, als sie zurück kam. Mein Nachwuchs begab sich zur Wiese und errichtete einen Scheiterhaufen. Das Geflügelmädchen hüpfte durch die Büsche und zog trockene Äste raus, hingegen der Pubi sich am Holzstapel bediente. Wir ließen machen, mein Mann nahm sich ein Bier.
Eine Stunde später gab es endlich was zu essen. Der Wind pfiff und es war ziemlich kalt. Aber das Dornengestrüpp, das ist jetzt weg.
Über Sinn und Unsinn von Garantieverlängerungen lässt sich trefflich streiten, aber beim Laptop stehe ich voll drauf.
Anfang des Jahres war es so weit: Meine Verlängerung lief aus. Wenige Wochen zuvor schellte eines Morgens ein freundlicher Techniker, ließ sich an meinem Schreibtisch nieder und baute ein neues Motherboard ein.
Am nächsten Morgen war das neue Motherboard kaputt.
Kam der Mann eben noch einmal.
Diesmal trug er ein hellblaues Hemd und er verschmähte meinen Kaffee. Danach lief alles.
Eines kühlen Wintermorgens nun fragte mein Mann: „Lust auf einen kleinen Streit?“
Ich: „Klar, was liegt an?“
Er wedelte mit einem Mailausdruck über meiner Kaffeetasse. Ich schnappte den Brief und riskierte ein Auge. „Boah, nicht schon wieder! Ich hab noch genug vom letzten Mal!“
„Was heißt denn hier schon wieder? 3 Jahre ist das her.“
„Habe ich trotzdem nicht vergessen!“
„Wir können uns das Theater sparen“, mein Mann feixte, „am Ende machst du eh, was ich will.“
Daraufhin zeigte ich ihm erst mal meinen Mittelfinger.
Aber ich will Sie nicht weiter im Unklaren lassen! In der Mail wurde eine weitere Garantieverlängerung angeboten. Eine Verlängerung von der Verlängerung. Jeder weiß, wo die Schwachstellen von Laptops liegen: Zum Beispiel im Display, welches nicht für jahrelanges Auf- und Zuklappen geeignet ist. Somit kostet diese verlängerte Verlängerung die Hälfte des Neupreises.
Bei uns der Punkt für turnusgemäße Streiterei, weil mein Adminstrator bestimmt: Sobald Garantie weg, wird das Ding verkauft!
Jetzt erhielt mein schicker Laptop aber schon einige Austauschteile. Einschließlich neuem Display, da könnte man durchaus noch ein, zwei Jahre …
„Nix!“ Mein Mann hatte offensichtlich keinen Bock auf Gespräch, denn er legte ein kleines schwarzes Ding neben meine Kaffeetasse. „Hier“, sagte er, „dein Neuer!“
„… was soll das sein?“ Ich klappte das Ding auf. „Taschenrechner?“
„Nörgel nicht, schreib mal was!“
„ .. will ich nicht, ist mir zu klein. Hab ich viel zu große Finger für.“
„Blödsinn, Putzen funktioniert auch.“
Gerade wollte ich um den Tisch herum, als mein Pubertikel mit einem Satz Streichhölzern zwischen den Lidern in die Küche kam: „Warum weckt mich denn keiner … hab ich heute kein Training?“ Er schleppte sich zum Tisch und brach auf dem Stuhl neben mir zusammen.
„Vorsichtiger, Mensch!“, schimpfte ich. „Irgendwann geht was kaputt.“
Pubertikel rüttelte am Stuhl: „Deutsche Eiche. Das hält.“ Dann entdeckte er das Ding: „Für mich?“
Ich patschte auf die Flosse, die Platzset einschließlich Kaffeetasse zu ihm ranzog.
„Der Neue deiner Mutter“, sagte mein Mann. „Sie will ihn aber nicht …“
„Der ist voll geil … !“ Mein Pubi drehte und fummelte.
„Schluss jetzt!“ Ich nahm das Ding, ging zu meinem Schreibtisch und suchte erst einmal den Stecker.
„Hast deinen Kaffee vergessen, liebstes Mütterlein!“ Die Tasse knallte auf meine Schreibtischplatte und Brühe schwappte über. „Wo ist der Alte?“
Ich zeigte auf meinen Mann.
Verwirrt stützte sich mein Pubi in die Pfütze, woraufhin die Tischplatte stark kippte.
Ich sog tief Luft ein.
Allein mein Pubi ließ sich nicht beirren: „Ich brauche dringendst einen Laptop! Meine Kumpel haben alle einen. Ich bin der Einzigste mit einem Standgerät! Echt, ey!“
Am Ende legte ihm der Osterkerl mit den langen Löffeln meinen alten Laptop unter die Birke. Aus dem Miniding und mir ist ebenfalls eine produktive Einheit geworden. Vier Stunden Akkulaufzeit und dabei leicht wie ein Brot. Ich will nichts anderes mehr!
Alle glücklich, doch gestern Abend …
Mein Pubertikel zockt selig mit seinen Kumpeln. Er bekommt Durst, löscht – und beim Zurückkommen in seine Bude bricht er schwerfällig wie gewohnt über seiner Sitzgelegenheit zusammen. Leider ist Pubi nicht der Ordentlichste. Er schmeißt sich also auf seinen Sitzball, unter dem Ball liegt ein Hausschuh, der Ball bricht zur Seite aus, Pubi fängt sich geistesgegenwärtig am Tisch und krallt in seiner Not ins Display …
Hätten wir mal besser vor zwei Monaten verkauft!
Gemeine Laus-Parasiten machen vor nichts halt. Ganz gleich, ob wuschelige Kopfbehaarung oder Blumenkasten: Die Laus haut drauf. Hinterrücks fällt sie in Scharen ein und heckt wie ein Karnickelstall. Da sie deutlich kleiner, geht das mit dem Nachwuchs auch viel schneller.
Vor vier Wochen stürzte so ein verlauster Staat in mein kleines Kirschbäumchen. Vielleicht handelte es sich nur um ein Versehen – allein sie blieben.
Mensch guckt sich das ein paar Tage an. Es dauert ihn, mit anzusehen, wie die zarten Triebe einschrumpeln, furchtsam zurück zum Stamm kriechen und schließlich eine unreife Kirsche nach der anderen einen pockigen Stil bekommt. Ameisen finden das gut und wandern geordnet zum Melken.
Ich finde das aber nicht gut. Immerhin reden wir von meiner ersten Ernte!
Früher zermalmte ich die Läuse zwischen den Fingern. Im Alter werde ich irgendwie zu weich für das Gematsche aus Innereien. Mit jedem Kind ein ganzes Stück fürsorglicher (Gottseidank habe ich nur zwei). Aber einerlei, die Viecher müssen weg!
Was tun?
So man keinen Rat weiß, fragt man das Internet.
Zuerst las ich, Mensch soll Spülmittel draufgießen.
Das verwarf ich sofort, weil wenn die Kirschen hernach nicht schmeckten, könnte man sie gleich den Läusen lassen.
Bisschen weiter unten riet jemand, das lausige Gelumpe mit schwarzem Tee zu besprühen.
Die Idee gefiel mir. Bei mir daheim trinkt keiner schwarzen Tee, nichtsdestotrotz lagert eine doppelte Familienpackung Earl Grey im Vorratsschrank. (Was dabei rauskommt, wenn mein Mann einkauft)
Eine Kanne kochendes Wasser, 10 Teebeutel rein, abkühlen, aufspühen. Am Abend wiederholt und jeder, der am Baum vorbei ging, nahm die Sprühflasche und gab es den Läusen erneut.
Nichts passierte … Die Population jubilierte, die Ameisen waren schwer beschäftigt.
Am dritten Tag verlor ich die Lust und beschwerte mich bei meiner Blognachbarin und Gartenfee Sabine (http://ratzerennt.wordpress.com/). Die wiederum besprach sich mit einer anderen Gartenfee und zack, klebten sie mir den ultimativen Lauskiller-Tipp an die Pinnwand: Marienkäfer-Larven zum Bestellen!
Das fand nicht nur ich saulustig!
Aber dann habe ich mich eingelesen: Ein Marienkäfer mampft im Jahr mehrere Tausend Blattläuse. Als Larve ist er besonders gefräßig. 30 Larven sind für 10 Euro zu bekommen. Super Idee: hauseigene Glückskäferchenzucht! Bestellte ich sofort. Die Mindestbestellmenge sollte reichen, der Baum geht noch in den Kindergarten.
Gestern, ich war auf meinem abendlichen Kontrollgang durch den Garten, komme ich auch am Kirschbaum vorbei. Erst wollte ich das Elend nicht schauen und konzentrierte mich auf den frischen Haufen Katzenscheiße. Auf dem Hinweg war ich mitten rein getrampelt. Aber dann guckte ich doch. Nanu, wo waren denn meine Blattläuse??
Ich bog die Zweige nach unten, um besser sehen zu können. Das glauben Sie nicht: keine einzige Blattlaus!
Entweder regnete es denen zu viel oder der Tee brauchte länger. Ich wendete und drehte und zupfte: nicht eine Mini-Laus! Nichts!
So sehr mich das freut – was gebe ich jetzt meinen gefräßigen Marienkäfer-Babys? Bestimmt reisen die morgen an. Hat einer von Ihnen Läuse??
35 Grad gestern. Alle zufrieden?
Wie gewöhnlich saß ich unter mehreren textilen Lagen am Schreibtisch: Shirt, Pullover und Strickjacke. Ich passte auf, dass mir der Kaffee zum Fingerwärmen nicht aus ging und gegen Mittag streifte ich Pulswärmer über. Eine Decke für die Knie habe ich im untersten Fach, denn in meinem Homeoffice ist es ziemlich kalt.
Sie ahnen es: Das geht so nicht den ganzen Tag!
Am Nachmittag schwang ich mich auf’s Tandem, das Geflügelmädchen aus dem Kindergarten zu holen. Die 14 km hin waren herrlich: Ab Schloss Broich war meine Gänsehaut geglättet und in Alstaden benetzten erste Schweißperlen meine Stirn.
Jetzt dauert das aber, bis so ein kleines Kind endlich seine Plörren beisammen hat. Es musste mehrere Gespräche führen (weil tagsüber fehlt die Zeit), die Schuhe waren nicht zu finden und das Fach mit den Kunstwerken wollte sie auch mal wieder ausräumen. Außerdem hätte sie gerne eine kleine Kollegin mit heim genommen – und da kann ich hundertmal sagen, dass der Drahtesel draußen steht, worauf ergo kein Platz für Dritte ist …
Irgendwann, endlich, wir standen vor der Türe. Mittlerweile transpirierte ich stark. Dem Kind was zu essen in den Hand gedrückt – und los! Kurz vor Schloss Styrum bedauerte ich, das Auto daheim gelassen zu haben. Ich fühlte mich schwach.
(Liebe Ortsfremde! Dem Namen nach kennen Sie jetzt alle Mülheimer Schlösser. Weitere haben wir nicht.)
Wir schlichen also dahin. Das Geflügelmädchen jammerte: „Mir ist so heiß … ich schwitz so sehr … Können wir Pause machen?“ Und mir wurde immer unwohler, wenn ich daran dachte, dass es ab Schloss Broich nur noch bergan ging. Ich sagte also zu meinem Geflügelmädchen: „Wir rasten an der Ruhr.“
Das kleine Ding jubelte: „Hurra! Im Wasser ist es herrlich kalt!“
„Ich habe nicht gesagt, dass wir IN der Ruhr rasten.“
„Nicht? Schade …“
Wunderbar frisch war es, als wir den Pfad an der Ruhr einschlugen. Kein Sonnenstrahl drang durch das Blattwerk der alten Bäume. „Wir suchen uns eine Bank“, bestimmte ich.
Stellen Sie sich eine romantisch umwucherte Bank an einem kühlenden Fluss vor. So eine Bank steht da. Doch dort hatte jemand etwas vergessen! Säuberlich vor der Bank abgestellt: ein Paar dunkelblauer Pumps aus Samt. Mein Geflügelmädchen jauchzte und wollte in die Schuhe schlüpfen.
„Untersteh dich!“ Ich schaute mich um. Wo war die Trägerin? Zum Schwimmen ist der Platz gänzlich ungeeignet. Das Ufer fällt steil ab. Dichtes Knöterichgesträuch, Brennnesseln und Strömung gestatten keine Badefreuden. War sie etwa ins Wasser gegangen? Wir setzten uns auf die Bank. Unauffällig scannte ich das Buschwerk rundherum. Ich sog tief die Luft ein, konnte aber keinen verwesten Gestank ausmachen. Lagen auch keine Gliedmaßen rum. Trotzdem: Obacht! Man weiß ja nie.
Mein Geflügelmädchen konnte nicht von den Schuhen lassen. „Innen sind sie silbern, Mama, schau doch!“
Ihre kleinen Füßchen stießen immer wieder zart gegen die Pumps. „Hör doch nur, wie schön die klackern …!“
Ganz verzückt guckte sie zwischen mir und den Pumps hin und her. Ich stöhnte innerlich und verfluchte das Wetter, welches mich schwächelnd hier auf die Bank zwang. Ich muss irgendwie die Augen verleiert haben, anders kann ich mir nicht erklären, wieso ich plötzlich halb hinter der Bank etliche kleine Kartoffelpuffer mit viel Schnittlauch entdeckte. Noch sehr frisch sahen die Dinger aus. Pfannenfrisch!
Jetzt langte es mir! Ich habe Phantasie – oder wie würden Sie sich das erklären, wenn am Wasser einer schicke Schuhe und sein Mittagessen vergisst?
„Genug ausgeruht“, sagte ich zu meinem Geflügel, „weiter geht es!“
Braune Äuglein flehten mich an: „Können wir nicht doch die Schuhe …?“
„Nix. Wenn die Frau merkt, das sie barfuß unterwegs ist, will sie ihre Schuhe holen. Und dann wäre sie traurig.“
„Aber so bin ich traurig …“
„Zu Hause kriegst du ein Eis.“
„ … könnten wir nicht lieber der Frau ein Eis dalassen?“
Liebe Besitzerin der dunkelblauen Samtpumps!
Bitte holen Sie ihre Schuhe ab!
Gegen 16.OO Uhr kommen wir wieder an der Bank vorbei.
Es stresst mich, einem kleinen Mädchen zu erklären,
dass vergessene Schuhe keine herrenlosen Schuhe sind.
Bei uns im Pott gibt es viele Schrebergärten. Kolonialisiert liegen die gerne mal zwischen Autobahn und Eisenbahnschienen. Wo halt Platz ist.
An einer Kolonie in Oberhausen komme ich täglich vorbei. Stünden nicht die Papier- und Altglascontainer auf deren Parkplatz – ich wüsste nichts von ihrer Existenz. Die Außenhecke ist hoch und dicht. Drinnen, zur Parzellentrennung, ist hohes Gehecke streng verboten. So wie jeder Furz hochdiszipliniert geregelt ist. Aber Kleingartenverordnung hin oder her – ich will etwas ganz anderes erzählen!
Vor ungefähr vier Wochen roch es schon mal zwei Tage nach Sommer. Am Morgen des zweiten Tages halte ich früh bei meinen Lieblingscontainern. Irgend so ein Depp hat vor dem Papiercontainer einen Minikühlschrank entsorgt. Ich stelle meinen Altpapierkorb auf den Elektroschrott und zupfe gemächlich ein Blatt nach dem anderen heraus, während ich überfliege, ob das Wegschmeißen gerechtfertigt ist. Plötzlich ein Geräusch hinter mir! Ich drehe mich um: ein braun gebrannter Gartenzwerg mit Schubkarre, Blaumann und Haiwaihemd. Er guckt mich an, sagt nichts und lädt eine elektrische Heizung ab. Ich bin baff …
Der Zwerg entfernt sich. Die blitzsaubere Schubkarre und sein silbernes Haar glitzern in der Morgensonne. Dann verschwindet er im Tor zur Laubenkolonie. Mittlerweile habe ich meine Sprache wieder. Zu spät.
Vorgestern halte ich wieder bei den Schrebergarten-Containern. Es ist Nachmittag, der große Parkplatz leer, nur an der Straße stehen ein paar Autos. Ein oberkorrekter Verkehrsteilnehmer parkt etwas mehr als einen Meter entfernt vom Ende der Parkbucht. Weil die Einfahrt zum Parkplatz aber mehr als großzügig breit ist, stelle ich mich den Moment dahinter. (Halten zum Be- und Entladen, nennt sich dieser Vorgang übrigens korrekt) Dieses Mal scanne ich nicht, was ich wegschmeiße, sondern pfeife mein Altpapier hurtig in den Container. Mit eins stemmt sich einer gegen seine Hupe! Vor Schreck fällt mir fast der Korb aus der Hand. Silberner Mercedes, glitzert im Licht, Fenster unten, Hawaihemd: mein braun gebrannter Gartenzwerg! Theatralisch kurbelnd steuert er sein stäubchenfreies Schiff durch die immer noch mindestens drei Meter breite Einfahrt. Auf meiner Höhe hält er: „DU BLÖDE KUH! DU LEBST HIER NICHT ALLEINE! STRASSENVERKEHRSORDNUNG, FALLS DU ÜBERHAUPT LESEN KANNST!“
Wir haben uns jetzt zweimal gesehen. Per „Du“, meinetwegen, wir kennen uns: „Bist doch durchgekommen, du Ochse!“
„MINDERBEMITTELTE PLINSE! BEKNACKTES LANDEI! DAS IST JA NICHT ZU FASSEN!“
Mein neuer Freund, der Gartenzwerg, lässt mich zum zweiten Mal sprachlos zurück. Diesmal zusätzlich in einer Staubwolke, so impulsiv latscht er auf’s Gas.
Was meinen Sie, wen ich heute Morgen bei Aldi getroffen habe?
Ich suche mal wieder bei Obst und Gemüse – diesmal nach abgerissenen Kohlrabiblättern für die Meersau – stellt sich einer neben mich und drückt an den Pfirsichen rum. Schön in eine Frucht nach der anderen würgt er seinen schrumpeligen Daumen. Ich schaue hoch: Haiwaihemd-Zwerg!
„Die werden nicht besser, wenn Sie die alle antatschen“, raune ich ihm zu.
Planmäßig explodiert der Kleingärtner: „KÜMMERN SIE GEHIRNAMPUTIERTE BORDSTEINSCHWALBE SICH UM IHREN EIGENEN SCHEISS!“
Wenn Menschen abends heimkommen, sind sie verschiedengradig erschöpft und unterschiedlich tranig.
Ich zum Beispiel bezog gestern an einem oberen Fenster Posten und guckte ein Loch in den Garten.
Als ich so träumte (und richtig schön war’s!) – stellte ich Augen plötzlich scharf auf Scheibe: Da prangte eine Sammlung feinster Fettfinger! Alles drauf: Fingerspitzen, Handballen … fest umrissen, traumhaft klar und keine verschmierten Ränder. Wie gerne hätte ich einfach weiter geglotzt – stattdessen wischte ich nun verärgert über einen Schmiergriffel. Nichts passierte. Ich hauchte kräftig dagegen, wischte erneut: nix.
Mir dämmerte es: Die sind von außen.
HIER WOLLTE JEMAND EINSTEIGEN!“, brüllte ich durchs Haus.
Mein Mann kam gelaufen: „Wo?“
Er riss das Fenster auf: „Unten steht die Treppenleiter!“
Ich riss das andere Fenster auf: „Muss ein sportlich Mensch gewesen sein.“
„Hast du im Haus was bemerkt?“
Alles wie immer, ich schüttelte den Kopf.
„Wo ist eigentlich der Pubi? Der fehlt!“
In dem Moment schellte es. Ich stürmte die Treppe runter. Durch das Türglas sah ich ein bekanntes Bike schimmern. Ich machte auf, brandete mir ein japsender Wortschwall entgegen: „Mutter, warum gehst du nicht an dein Handy?? … Ich hab zig Mal versucht, dich zu erreichen! … Ich kann doch nicht schwarz fahren!!“
„Das stimmt. Das ist verboten. Dafür hast du ein Schokoticket*.“
„Liegt im Flur … Unten auf der Bank … Ich musste zur Nachhilfe … Hatte die Tür schon zu, fiel mir der Fahrschein ein … Schlüssel liegt auch inner Bude … Und du bist nicht ans Handy!!“
„Voll ärgerlich. Was haste gemacht?“
„Hab ich versucht einzusteigen … Bei mir oben war Fenster gekippt … Hast du letztens in deiner Kolumne beschrieben: Total easy, ein gekipptes Fenster zu öffnen!“
Die Fettgriffel, alles klar! „Hats funktioniert?“
„Wäre ich dann mit dem Rad?!“
Schlüssig argumentiert, musste ich zugeben. „Und wie bist du zu dir hoch geklettert?? Du bist doch nicht etwa wieder über die Dachrinne geturnt!“
„Mitter Leiter.“
„Die stand in der Garage.“
„Hab ich hinten raus geschoben.“ Er sammelte sich und er japste nicht mehr ganz so stark: „Dieses Mal wäre das Fenster auf alle Fälle dran gewesen. Sei froh, dass mir das letztens schon rausgefallen ist!“
(*Schokoticket: Fahrschein für Schüler)
Einkaufen geht mir echt auf die Nerven. Wertvollste Zeit ist das, die man zwischen Flaschen, Eiern und Würsten verplempert.
Was könnte Mutter in der Zeit nicht alles anstellen! Sie könnte sich ein bisschen mit ihrem Mann rumstreiten, sie könnte eines der Kinder föhnen – oder sie könnte auch einfach etwas arbeiten. Da liegt es auf der Hand, dass sie das Wagenschieben gerne so weit hinauszögert, bis die Woche um ist. Es sei denn, das Brot ist alle. Doch auch dieser missliche Umstand lässt sich lösen: Der Handel bietet sortenreich Knäckebrot.
Gestern war es wieder so weit: ausgemergelte Nager im Kühlschrank. Einer lag im Butterfach, der andere dort wo der Joghurt hingehört. Ich machte mich also stöhnend auf den Weg, natürlich unterstützt vom Geflügelmädchen. Die hatte sich, damit man sie besser sieht, einen Ring aus Leuchtstäben um den Bauch gebunden.
Bei einem meiner bevorzugten Discounter befindet sich die Quengel-Ecke gleich hinter dem Eingang. Das gefällt mir, da werden die Gespräche über Nutz und Unnutz von Schleckereien am Anfang abgehandelt. Hernach widmet man sich, dieser Last befreit, in Ruhe dem daheim vergessenen Einkaufzettel.
Das kleine Mädchen bedachte wie immer wortreich und mit viel Hin und Her alle Familienmitglieder. Nachdem das geschafft war, sagte Mutter: „Jetzt kannst du schon mal nach deiner Zeitung gucken, ich mache derweil den Einkauf.“
Das Kind düst ab. – Leider nicht lange. Ich bin noch nicht mal bei den Äpfeln, da kommt sie angerannt: „Mama, die haben wieder Fillyzeitung!“
„Du darfst dir eine nehmen, haben wir doch ausgemacht.“
Kind rennt weg. Mutter denkt sich: Naja, und sucht für die Meersau einen großen Kopf Eisbergsalat. Packt ihn, ohne hinzusehen in den Wagen und hält jetzt Ausschau nach einer Schale Möhrchen, ebenfalls fürs Viech.
„Mama, guck, dieses Mal liegt ein pinker Puschelstift bei der Zeitung bei!“
Ich sehe gar nicht hin und sage nur: „Toll.“
„Guck doch mal, der hat sogar Glitzer!“
Ich werfe einen Blick auf die Zeitung. „Prima.“
„Mama, und guck, hier das Filly, das habe ich noch nicht.“
„Ist gut, Kind, ich möchte jetzt einkaufen!“
„Mama, was steht hier?“
„Schatz, jetzt langt es. Quassel mich nicht voll, ich muss mich konzentrieren, sonst vergesse ich die Hälfte! Wenn wir daheim sind, lese ich dir die Zeitung vor.“
„Ich hol schon mal Joghurt!“, ruft das kleine Mädchen und rennt mit der Zeitung los.
„Wo liegen denn die Leuchtstäbe?“ Plötzlich eine Stimme hinter mir. „Ich brauche nämlich welche.“
Ich drehe mich um und sage bedauernd. „Die sind nicht von hier, die haben wir mitgebracht.“
Die weiß gekleidete Dame mit der Cote d’Azur-Sonnenbrille lässt sich nicht beirren: „Ich habe meine Leuchtstäbe seinerzeit alle verschenkt …“
„Das ist schlecht“, antworte ich und will nach den Berner Würsten für den Grill greifen.
Der Dame ist das egal. Sie will jetzt meine Aufmerksamkeit. „Für eine Fete brauche ich Leuchtstäbe …“
Ich mache mechanisch „Hm“, und scanne die Wurstauslage. Zwei Sachen auf einmal kann ich nicht. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie ein Stapel Joghurtbecher angewankt kommt. Eine Zeitung ist auch dabei.
Die Dame streckt ebenfalls die Hand in die Wursttheke, lässt aber das Thema nicht fahren: „Die Fete … in drei Wochen ist sie“, sagt sie bedächtig. Da krachen die Becher runter. Bis auf einen landen alle in meinem Wagen.
Nach außen störe ich mich nicht daran, innerlich platze ich gleich. Während mein kleines Ding den heruntergefallenen vom Boden klaubt, richte ich die Becher im Wagen auf, weil Joghurt am Deckel können die bei mir daheim nicht leiden.
Die Dame scheint von dem Ganzen nichts mitzubekommen, denn sie setzt besonnen fort: „Anstatt Kerzen … Die sollen auf dem Tisch leuchten, wissen Sie?“
Ich antworte nicht mehr, sondern ziehe nur die Luft ein.
Mein kleines Mädchen zupft an meinem Rock und flüstert, dass es bis zur Joghurt-Theke schallt: „Jetzt sag ihr endlich, sie soll dich nicht vollquasseln! Du vergisst sonst die Hälfte!“
Samstag in der Früh verlangte mein Mann nach einem Lumpen und wedelte damit über seinen Drahtesel. Nebel. Und dann: Oha, das Rad ist schwarz! Natürlich putzte mein Mann nicht einfach so; er wollte ausradeln.
Auf der Straße war es morgenstill: nur Vögel, die Sonne und wir. Wir waren noch nicht weit gekommen – rot verklinkertes Reiheneckhaus – wienerte der Erste seinen Wagen. Vor der Garage, inmitten seines blühenden Vorgartens. Ging uns nix an, darf er ja. 500 Meter weiter wurde es aber interessant! Wieder Reihenhaus, diesmal Mittelhaus, weiß verklinkert und breiter aufgesetzt. Mein Mann sagte: „Wow!“
Ich fragte: „Was?“
Er nickte zur Tiefgarage. Ich guckte. Die Abfahrt blendete. Eine rechtschaffene Hausfrau mit Eimer und Schrubber und Schweißflecken unter den Achseln – Sie feudelte die Garage!!
Ich konnte nicht anders, mir entfuhr ebenfalls ein: „Wow!“
„Schade“, mein Mann feixte. „In unserer Garage passiert so was nicht.“
Eine Stunde später, auf dem Rückweg, ist vor dem rot verklinkerten Reihenhaus immer noch Betrieb. Der Wagen funkelt – jetzt putzt der Mann die Garagenfenster.
Da habe ich gleich zweimal hingeguckt!
Ich sagte zu meinem Mann: „Schade, in unserer Garage passiert so was nicht.“
„Möchtest du, dass ich das Garagenfenster putze?“
Also, wenn er schon so fragt …
„Gut“, sagte er, „aber nur, wenn du dafür den Boden wischst!“
Fenster hat mein Mann in seinem Leben noch keine geputzt. Soviel steht fest! Diese Vereinbarung war also nicht koscher, da konnte ich gut einschlagen.
Daheim hatte ich unsere Abmachung fast wieder vergessen (immerhin liegt ein steiler Berg zwischen den Rot-Verklinkerten und unserer Hütte), sagte mein Mann: „Lass uns jetzt Ortsbegehung machen!“
Er schellte an der Haustüre: „Pubi nehmen wir mit.“
Wenn er das so wollte …
Der Pubertikel kam die Treppen herunter gestürmt.
„Komm mal mit in die Garage“, sagte mein Mann.
Pubi hörte auf zu grinsen.
Das Tor fährt hoch, mein Mann bekräftigt noch mal: „Du: Boden – ich: Fenster.
Ich, Hände in den Taschen, nicke. Tor ist offen und ich baff: „Kein Fenster?“
Keiner sagt was.
Pubi druckst: „Dat Fenster, äh … dat is … rausgefallen is dat.“
„Das seh ich. – Von alleine?“
„Ja, einfach so.“
„Und woher weißt du das?“
„Ich bin da durch. Ich hab den Aufmacher nicht gefunden.“
„Wieso fällt dabei das Fenster raus, du bist doch schon zig Mal eingestiegen?“
„Bin mit dem Schläger hängen geblieben.“
„Versteh ich nicht. Wofür braucht man einen Schläger, wenn man sein Rad holt?“
„Das scheiß Loch ist viel zu klein!“ echauffierte sich da mein Pubertikel. „Ich musste zum Tennis. Spät war’s. Und dann passte der Rucksack nicht durch. Hab ich bissel gezogen. Ganz leicht nur!“
Hätte er den großen Tennisrucksack vor der Türe stehen gelassen, hätte den flugs einer weggeklaut. Das liest man ja öfter.
Mein Pubertikel griente: „Aber ich war pünktlich! Kannste anrufen.“
Na, ein Gutes hat’s: Wenn mein Mann kein Fenster putzt, putz‘ ich erst recht keinen Boden!
Oberhausen baut. Wenn dafür Altbestand abgerissen wird, gefällt mir das sogar. An einem dieser schon ewig leerstehenden Häuser komme ich jeden Tag vorbei. Zusammen mit dem Geflügelkind, vor und nach dem Kindergarten.
Gestern – die sehr sportliche Mutter war mit dem Tandem angereist – fragt das kleine Mädchen: „Was wird hier gebaut?“
Mutter ist in Gedanken noch beim Job, weiß es außerdem nicht genau und muss zusätzlich über die gutgefüllte Kreuzung steuern. „’was Altersgerechtes.“
Erwartungsgemäß fragt das Kind: „Was ist das?“
Mutter konzentriert sich und landet im Leben: „Das ist ein Haus, wo alte Leute wohnen, die nicht mehr so gut laufen können.“
„Also solche wie du.“
Da bin ich fast vom Rad gefallen. „Hä?“
„Na, du läufst doch auch nicht viel. Entweder fährst du mit dem Auto oder du nimmst das Rad.“
„Das liegt daran, weil wir so weit weg wohnen.“
Das Geflügelkind lässt den Bewegungsstrang sausen und setzt neu an: „Doch, das ist für solche wie dich, weil du bist alt.“
Mutter bleibt die Spucke weg. Mehr als: „So’n Käse!“, kriege ich nicht über die Lippen.
Das kleine Kind guckt derweil in den Himmel und überlegt: „Oder bauen die das für solche wie den Papa?“
„Der Papa ist ebenfalls nicht alt!“
„Für wen denn dann? Jetzt sag doch mal! … Oma vielleicht?“
Noch ehe ich antworten kann, korrigiert sie sich: „Ne, das ist Blödsinn. Oma ist jünger als Papa.“
So langsam komme ich total aus dem Tritt. „Die Oma ist natürlich älter als der Papa!“
„Das kann nicht sein! Die ist doch viel kleiner. Außerdem hat sie weniger graue Haare.“
Wer jetzt meint, das war endlich alles: Nein, das Kind setzt noch eins drauf. „Für Opa?“
Gerade will ich antworten, dass auch der Opa so etwas noch lange nicht braucht, da fällt sie mir ins Wort: „Nein, für Opa nicht. Opa hat kaum graue Haare. Der kann nicht viel älter sein als ich!“
Ich habe dann angehalten und wir haben ein kurzes Picknick an der Hauptstraße eingelegt. Darüber entfiel ihr planmäßig die Fragerei. Vielleicht nehmen wir heute einen anderen Heimweg. Ich darf nicht vergessen, im Kindergarten nachzufragen, ob die der versehentlich was gegeben hatten …!
Mit Umziehen ist Familie Em durch, Hab und Gut grob verstaut – zur Belohnung und zu Entspannung der Füße verbringen die Eltern den Abend vor dem Fernseher. Ein Agenten-Thriller, welcher den Protagonisten gleich nach der ersten Werbepause auf einen Flug nach Südamerika schleust. Ohne Ticket, im Gepäckraum. Der lange Flug rausgeschnitten, nächste Sequenz Ankunft Airport. Das verschwitzte Servicepersonal trägt Knarren unter den Overalls und beschimpft sich in irgendeiner Sprache. Muss ja authentisch wirken. Der deutsche Zuschauer kriegt folgerichtig Untertitel eingeblendet. Frau Em beugt sich vor, kneift die Augen zusammen und fragt: „Hä?“
Herr Em beugt sich ebenfalls vor: „… wie spät ist es?“
Frau Em: „Das ist doch egal! Was steht da?“
„Ich habe Hunger.“
„Dann mach dir was! Ich kann den Scheiß da nicht lesen!“
Herr Em: „Willst du jetzt wissen, was da steht oder willst du weiter pöbeln?“
Was war geschehen? Der Bildschirm war einfach zu klein für Ems neues geräumiges Wohnzimmer. Das mit den Untertiteln ging weiter. Em wechselte das Programm. Gleicher Mist: Untertitel.
An diesem Abend beschloss Em: Ein Beamer muss her!
Weil er ein Mann der Tat, guckt er gleich bei eBay. Mann will ja erst mal ausprobieren. Dem Fernsehprogramm kann er sowieso nicht folgen, weil seine Frau immer wieder lamentiert. Sie wisse nicht, worum es ginge und Blabla. Weibergeschwätz eben.
Em ersteigert einen Beamer, das Ding kommt, Ems sind begeistert. Gucken ohne Leinwand auf der rosa Zimmerwand. Prima. Nur einen Nachteil hat die Neuanschaffung: Will ein Em eine DVD schauen, muss er die halbe Anlage abbauen, um ein paar Kabel umzustöpseln.
Em, schlau, wie er ist: „Wir brauchen einen Beamer der nächsten Generation!“ eBay, ZACK, alles in der gewohnten Geschwindigkeit.
Das Ding ist klobig, mächtig wuchtig und schwarz. Ems sind ein wenig überrascht. Am Abend versammeln sich die Großen zum Tatort-Gucken – Hoppala, lauter rosa Flecken im Bild!
Em: „Ganz klar, der ist schärfer, die Wandstruktur zeichnet sich ab. Wir brauchen eine Leinwand!“
Frau Em: „Nein, das will ich nicht, wie sieht das denn aus! Wie selten guckst du fernsehen und dann hängt hier ständig so ein Ding rum. Ich will das nicht!“
EM hört schlecht und so macht er, was er für richtig hält. Besorgt eine Leinwand mit breitem schwarzen Rand und mit Metallkasten. Sie soll sich ja zurückziehen können. Schraubt das Ding unter den Stuck, Frau Em schimpft. Allein Em lässt sich nicht beirren.
Das kleine Kind kommt ins Zimmer: „Papa, wieso hängst du die Markise ins Haus?“
Das große Kind kommt hinterher: „Oh, ist einer gestorben?“
Herr Em winkt ab. Lässt stattdessen die Jalousie herunter und zeigt auf das Sofa: „Bitte Platz zu nehmen, die Damen und der Herr!“
‚Sendung-mit-der-Maus‘ fängt an.
Herr Em: „Und? Super, nicht?“
Das kleine Kind: „Papa, warum haben die alle so rosa Flecken?“
Einer von Geflügelmädchens Freunden feiert heute seinen Fünften. Als ich des Jubilaren Mutter in der Garderobe eine Nachricht schrieb (schön altmodisch auf einem Zettel), fiel mir das hier wieder ein:
Letztens – ebenfalls Geburtstagsanlass – trafen sich die Kleinen auf einem Indoorspielplatz. Weil ich keine Zeit zum Bringen hatte, fuhr Hella bei ihrer Freundin Amelie mit. Das mit der Zeit geht nicht nur mir so, Amelies Mutter packt drei Zwerge ins Auto. Sie fahren los, es gießt aus Eimern. Hella und Aaron hinten, Amelie vorn neben der Mama. Auf der Hauptstraße sagt Hella zaghaft: „Mir ist heiß…“
Die Mama: „Dauert nicht lange, wir sind bald da.“ Sie legt eine Kinder-CD ein.
An der nächsten Kreuzung, Hella: „Wenn mir beim Autofahren so heiß ist, muss ich immer brechen…“
Amelie nickt: „Muss sie.“
Die Mutter kurbelt Fenster runter.
Aaron hinter ihr: „IGITT! Ich werd ganz nass!“
Mutter-Amelie kurbelt Fenster wieder Stück rauf.
Hellas Kopf färbt sich dunkler.
Amelie zu ihrer Mama: „Als wir zu Nadines Hochzeit fuhren, hat mir Hella Kartoffeln auf die Hose gebrochen. Hier, aufs Bein.“
Hella korrigiert: „Nudeln waren das.“
Amelie: „Stimmt. Mit Fleischbrocken.“
Aaron: „Ich erinnere mich. Möhren waren auch dabei.“
Hella: „Ich ess überhaupt keine Möhren! – Das waren Erbsen.“
Aaron: „Ist egal, auf alle Fälle war’s Gemüse.“
Amelie: „Ja.“
Hella: „Mir ist so fürchterlich heiß….“
Mama-Amelie kurbelt das Fenster wieder ein Stück runter.
Aaron: „Mach zu, guck doch, wie nass ich werd!“
Sie haben es tatsächlich geschafft, sauber ans Fahrtziel zu kommen. Amelies Mutter erzählte später: „Die Fahrt hat mich mehr gestresst als die letzte Inventur!“
Heute Nachmittag nimmt sie Hella wieder mit. Ich wünsche ihnen, dass es nicht regnet!
Schlacht ums Nachtmahl endlich ausgefochten: Mutter räumt den Tisch ab, weil ist ja meine Aufgabe. Da höre ich das Geflügelkind mit der Meersau verhandeln: „Du musst mir das geben, Eddy! Komm, gib’s her!“
… was kann die kleine Sau dem Kind geklaut haben?
„Eddy, zeig her! Ich mach das!“
Winzige Füßchen flitzen durchs Streu, während ich Käse in den Kühlschrank schichte.
„Was soll das, Eddy, will du das etwa behalten?“
Jetzt raschelt die geflochtene Bude. Aha, Eddy hat sich verzogen.
„Los, gib her, sonst hol ich die Mama!“
Ich horche auf. Statt mit dem Brotkorb in die Küchenzeile, biege ich ins Wohnzimmer ab. Die geflochtene Grasbude liegt auf dem Kopf und Eddy nimmt Reißaus.
Ich kann nichts Fremdartiges im Käfig entdecken. Dem Aufstand nach müsste es sich mindestens um ein Fillypferd handeln.
„Was ist hier los?“ Ich lasse mich neben dem Geflügelkind nieder.
„Guck doch!“
Ich sehe nix …
„Na hier!“ Ein kleiner Finger zeigt irgendwo in den Käfig.
„Geht’s genauer?“
„Da, am Fuß! Siehst du?“
Eddy steht mit den Vorderbeinchen im Körner-Napf, reckt sich zu mir und schnüffelt. (Vorhin habe ich Gurke geschnitten.) Und dann sehe ich es: Auf dem weißen Pfötchen funkelt ein schwarzer Punkt. Mit dem Fingernagel versuche ich, den Punkt wegzukratzen. Abgesehen davon, dass Eddy knurrend stiften geht, geschieht nichts. Der Punkt rührt sich nicht vom Fleck. Das lässt nur einen Schluss zu: Der Punkt ist eine Zecke.
„Sag ich doch!“ Das Kind nickt eifrig. „Aber wo hat er die her? Der geht doch nicht raus.“
„Haben wir sicher mit Wiese reingeschleppt …“
„Sehr richtig“, mischt sich der Pubertikel ein. „Zecken lauern im Gras, bis Blut vorbei kommt.“
Das kleine Mädchen guckt angewidert. Der Pubertikel feixt.
„Vielleicht kannst du ihr das etwas weniger schaurig erklären?!“
„Klar doch …“
Da steht das Geflügelmädchen auf, kuschelt sich an den großen Bruder – und ich gehe in meine Küche. Ein wenig wundert es mich, dass er nicht sofort anfängt zu reden. Muss sich wohl sammeln. Wird eben vernünftig, denke ich stolze Mutter und lächle. Fast in der Küche – Shit, Brotkorb neben dem Käfig vergessen! Gehe zurück: „….. und dann reißt die Zecke mit ihren Klauen die Haut auf und bohrt ihren Stachel ins Fleisch. Siehst du, so …“ Er stupst gegen das Ärmchen. Noch ehe ich den Pubertikel an seinen Löffeln ziehen kann, fragt das Geflügelkind gebannt: „Aber essen wollen die mich nicht?“
„Nein, nein, da brauchst du keine Angst haben! So ein futzelig kleiner Minipunkt frisst keinen Menschen. Der trinkt ein wenig Blut, wie eine Mücke. Mehr nicht.“
Das kleine Mädchen zieht das Hosenbein von einer Wade. „Guck, das war eine Mücke.“
Ich kann nichts erkennen, der Bruder auch nicht, aber das ist auch nicht wichtig.
„Bringst du mich ins Bett?“, fragt jetzt das kleine Mädchen und klettert auf des Bruders Rücken.
Als sie an mir vorbeischwanken, zische ich dem Pubertikel ins Ohr: „Wenn sie sich heute Nacht fürchtet, bring ich sie zu dir!“
Nachtrag: In der Nacht war es ruhig, keiner plärrte. Die Zecke war heute Morgen fort. Ich gehe davon aus, Eddy hat die Sache final gelöst.
[Der lyrische Mittwoch] von TEXTBASIS
Anke Müller im Interview
Letzte Nacht, es muss kurz nach Geisterstunde gewesen sein, stand plötzlich ein kurzes Gespenst in der Schlafkammer. Fahles Licht aus einem anderen Zimmer im Rücken, nur Umrisse waren zu erkennen. Das Hemdchen reichte fast bis zum Boden, die Härchen halblang und zerzaust. – Ich habe mich echt erschrocken.
Aber dann probierte ich es mit Totstellen. Funktionierte auch super, denn mein Mann hob seine Bettdecke an und sagte zu dem Ding: „Komm her, kuschel dich zu mir.“
Ich – weiterhin nicht da. Das sah das Ding wohl auch so und trampelte mir voll in die Rippen. Kaum war es da runter, zog so ein Hirni an meinem Kissen. Habe ich leise geknurrt, woraufhin von meinem Kissen abgelassen wurde.
Als die das neben mir endlich sortiert gekriegt hatten, beugte sich mein Mann zu mir: „Da drüben brennt noch Licht.“
„Stimmt“, sagte ich und drehte mich auf die andere Seite.
Mein Mann sank zurück in sein Kissen und begann augenblicklich ruhig und gleichmäßig zu atmen.
So, und dann ging das erst richtig los! Ich wollte gerade wieder einschlafen, rammt ein kleiner Fuß meinen Rücken. Ich sofort hellwach! Doch wer jetzt meint, das Fußding wurde zurückgezogen – von wegen! Ein zweites kleines Hammelbein bohrt sich unter meine Schulter.
Ich nehme also das Durcheinander und schiebe es dem Vater unter die Bettdecke. Immerhin war es dessen blöde Idee, das Gespenst ohne weitere Fragen ins Bett zu lassen. Ziehe mir die Decke erneut über die Ohren – RUMPS!
So geht das ein paar Mal. Immer energischer schiebe ich das Gebein unter des Vaters Decke. Und immer geschwinder finden die Beinchen zu mir zurück.
Gegen zwei Uhr langt es mir. Ich nehme das kleine Gespenst behutsam auf (man will ja nichts wegbrechen) und lege es schön bequem in meinem Bett zurecht. Da seufzt es zufrieden und ein Ärmchen schmiegt sich um meinen Hals.
Ich zog dann ein Zimmer weiter in ein freies Bett mit rosa Hello-Kitty-Bettwäsche. Auch das Licht löschte ich. Mein letzter Gedanke gegen 3 Uhr 15 galt dem Vater: Hoffentlich pennt der mindestens genauso schlecht wie ich!
Am Morgen fragte ich ihn: „Und, hast du gut geschlafen?“
„Selten so gut.“
Wider Plan hockte ich Freitagnachmittag mit einer Kindergartendelegation am Spielplatz. Von den herzigen Kleinen war durch den dicken Nebel, den gequirlter Sand in Trockenperioden erzeugt, nicht viel zu erkennen – da aber keiner wie angestochen MAMAAA brüllte und sich auch keiner beschwerte, müssen sie zufrieden gewesen sein.
Wir Großen fläzten auf zwei Bänken und nach kurzem Stuhlkreis über die Ableger und den Alltag, landete das Gespräch flugs bei den Gebrechen. Nun ist es so, dass ich das Altersmittel dieser Runde durchaus pusche. Da waren nicht mal alle Ü30. Aber zum einen begleiten manchmal auch Großeltern die StammhalterInnen, und im Übrigen habe ich ein Pubertikel. Das birgt deutlich mehr Stoff für Lamento als alle Krankheiten zusammen! So habe ich mich bei den Siechen auch schön rausgehalten und als die Küken von Rückenschmerzen klagten und Leid, das morgens ins linke Bein kraucht und in der folgenden Nacht ein Bein weiter zieht, nur zugehört. Der sehr junge Opa auf der ersten Bank feixte: „Was wisst ihr schon von Schmerzen!“ Das andere Ü40 war klettern gegangen.
Meine Lieben kamen dann auch schnell auf den Trichter, dass mehr Sport die Sache richten müsse, weil die Muskulatur et cetera. Da habe ich mich wieder rausgehalten, weil man ist ja durchaus altersweise und fragt sich immer öfter, wieso man’s im Kreuz kriegt, wo man doch fast täglich was rumsportelt.
Nehmen wir die Kaiserin Elisabeth-Sissy (die richtige, nicht Romy Schneider!): Die war völlig der Leibesertüchtigung ergeben. Trotzdem zwangen sie mit vierzig die kehrseitigen Leiden aus dem Sattel, woraufhin sie alles verkaufte. Pferde, Ställe und die Sättel auch.
Als ich Sonntag in später Frühe aus dem Bett sprang, knackte mein Rückwärtiger leicht und ich hatte Kreuz. War jedoch noch nicht schlimm und so ließ ich die Finger vom Kirschkernkissen. Montagfrüh bereute ich das und saß kuschelig bei 26 Grad Außentemperatur mit Heizkissen am Schreibtisch.
Früher Nachmittag – Mutters Aufwärmorgie hatte angeschlagen – will sie ihr kleines Mädchen mit dem Rad vom Kindergarten abholen. Auf zwei Drittel der Strecke macht es plötzlich PAFF! – hinterer Reifen platt. Nun besucht das Geflügel nicht etwa einen Kindergarten um die Ecke. Nein, nach Umzug mochte es gern im 14 km entfernten Kinderhort verbleiben.
Blick auf die Uhr, schnell kehrt gemacht und dann bin ich Kilometer für Kilometer immer fröhlich bergan heimgelatscht. So ein Tandem ist ein flinkes Geschoss – aber wehe, wenn es luftleer! Dann wird das Ross zu irgendetwas schwer beweglichem aus dem Straßenbau. Rüttelmaschine oder so.
Weil ich in unbekanntem Gebiet abkürzen wollte, beschritt ich eine langgezogene steile Anhöhe und stand auf einmal mitten auf dem Schulhof vom Pubertikel! Es ist jetzt nicht so, dass ich das Übel nicht bereits ein paar Meter vor dem Kamm befürchtete – immerhin hatte ich weiter unten ein paar Mädels nach eventuellen Treppen auf meinem Weg gefragt und die sprachen von einer Schule oben am Berg – aber was weiß denn ich, wieviele Schulen es in der Gegend gibt.
Es spangen auch genügend Halbwüchsige über das Gelände – die anderen saßen drin und sollten lernen. Taten sie aber nicht mehr, als ich an den Glasfronten vorbeiwanderte. Habe ich also nett gegrüßt und mich nochmals beglückwünscht, dass bei uns der Vater den Kontakt zur Schule hält. Und natürlich habe ich mir intensiv gewünscht, dass des Pubertikels Klasse zur anderen Seite raus im Unterricht hockte. Nur weil Lehrer einen nicht kennen, bedeutet das nicht Gleiches für Schüler.
Ich will jetzt nicht weiter jammern! Das siamesische Eisenpferd und ich erreichten nach einer Stunde den Stall. Heute habe ich saumäßig Kreuz und weil das nicht langt: Beine habe ich extra noch. Das Pferd, das ist bis auf Weiteres ein Intensivpflegefall – und der Pubertikel braucht mir nicht noch mal kommen, die Bahn sei ausgefallen, dessentwegen er nicht zu Fuß könne und dergleichen Blödsinn!
In letzter Zeit hatte Mensch ausführlich Gelegenheit, quer und ausgiebig über’s harsche Klima zu lamentieren. Von der überfälligen Eiszeit war zu lesen, Frau Holle bekam die Federpfühle angefackelt, Schneemänner wurden hinterrücks erstochen – gar lustige Bildchen kreisten in den sozialen Netzen. (Manchen von uns schien die Meckerei noch mehr zu reizen als das Wetter.)
Jetzt ist draußen jedenfalls eines klar: Natur macht Frühling! Bäume, Sträucher, Gräser, Blumen – schön bunt und schön pollig. Es gibt aber noch etwas, das der Frühling raustreibt: Sommerreifen aus den Garagen!
Ich habe jetzt auch welche. Da schaut Auto wieder nach Auto aus. Nur – fahren sollte es auch. Tut meiner aber nicht. Poltert sich ein. Friert wohl noch. Blieb mir nichts anderes übrig, als heute morgen beim Reifenhändler nach dem Rechten zu sehen. Der sagte dann auch gleich: „Au, au, lassen Sie den bloß hier!“
Klar, mache ich. Voller Terminplan, Fahrrad und ab Mittag Dauerregen. Total sportlicher Tag. Das Hellakind wird Augen machen, wenn sie nach dem Kindergartenjob 14 km durch Matsch und Modder mit mir heimstrampeln soll. Schutzblechlos. Da freut die sich ein Loch in den Bauch.
Aber egal, muss halt. Eben habe ich jedenfalls mein Auto in Broich getroffen. Wenn die so weit Probe fahren, kann es so schlimm nicht sein. Der Himmel hält auch, was der Wetterfrosch verspricht: Grautöne schieben sich wohlwollend ineinander. Dann will ich mal los – und das Kind kriegt die Taucherbrille auf!
Wer zu uns wollte, musste die letzten drei Wochen über einen Berg blauer Säcke steigen und ein Speißfass – die üppige Folge von Lenzrasur im Garten.
Nach der ersten Woche hatten sich meine Mitbewohner daran gewöhnt. Das Pubertikel nutzte den Haufen als Fahrradständer und seine Geflügelschwester zupfte, sobald Pubi den Platz freimachte, Stöckchen aus den Pedallöchern. Das Geäst trug sie zur Fußmatte, brach es zurecht und schichtete kleine Scheiterhaufen. War sie damit fertig, sorgte sie für hitziges Schneegestöber. Im Anschluss wollte sie immer gleich rein, das Laub im Kragen kratzte. Wäre es nach denen gegangen, hätten wir’s so gelassen.
Jetzt wohne ich aber auch hier! Wohin nun mit dem Zeug? Für Kompost war es zu holzig, auf Häckseln hatten die Jungs keine Lust. Und ich hatte keine auf den Mülheimer Recyclinghof!
Es ist nämlich so, dass dort Einheimische ihren Grünschnitt for free abliefern können. Doch als Frau Müller eines Tages auf die Rampe fuhr, lief das wie bei der Polizeikontrolle. Der Chef winkt raus:
„Tach“
„Hallo. Ich möchte Grünschnitt abgeben.“
„Machen Se dat, wo Se wechkommen! … wo liecht dat überhaupt?“ (angedeuteter Bückling zum Nummernschild)
„450 km von hier.“
„Bisse denn plemplem, und fährst dat Zeuch einmal quer durch et Land?!“
So schnell sind wir beim Du und hinter mir fangen sie an zu hupen.
„Ich wohne in Mülheim!“, sage ich höflich (ich will ja was) und krame nach meinem Ausweis.
„… und die Karre gehört deim Freund, schon klar. Soller dat Zeug nach sich entsorgen!“
Am Ende wurde ich meinen Gartenabfall zwar los – und ich musste mir nicht mal die Finger schmutzig machen – aber man will sich ja nicht immer unterhalten.
Was ist jetzt der Hintergrund?
In Oberhausen funktioniert Grünschnittabliefern nämlich nicht for free. Unsere Nachbarn müssen bei ihrem Wertstoffhof löhnen. Nicht viel – 1,50 EUR pro 120l-Sack – aber immerhin. Da kann einem schon der Gedanke kommen, nach Mülheim zu exportieren. Zumal sich das mit unserer Stadtgrenze mitunter fließend verhält. Erst gestern bin ich wieder in dem Winkel vorbei gekommen, wo das Ortsschild auf der Hälfte eines Gartenzauns steht. Apfelbaum und Beerengesträuch auf Mülheimer Territorium – die Kirsche und der Kartoffelacker zählen zu Oberhausen. Ich kenne die dort wohnen nicht, indes vermute ich, ihre Zugehörigkeit richtet sich danach, ob die gute Stube rechts oder links vom Schild. Von der Straße aus lässt sich das jedenfalls nicht beurteilen. Ligusterhecke. … oder soll ich doch mal schellen?
Dessen ungeachtet weiß ich dafür mittlerweile, wie ich den Rampendialog umgehen kann und mein Grünzeug noch dazu fast vor der Türe los werde! (Nein, ich bringe es nicht in den Wald!!)
Mülheim unterhält nämlich mobile Grünschnittcontainer! Die werden regelmäßig an exponierten Parkplätzen abgestellt. Terminplan und Standorte sind auf der Homepage der MEG einsehbar.
An einem dieser Auffangbehälter habe ich dann heute in der Früh den Weihnachtsmann getroffen. Graugrüne Tarnkleidung, weißer Bart – er wäre mir nicht aufgefallen, schleppte er nicht einen großen Sack. Wie er über die Straße wankte, dann über den Platz, das Gesicht schwitzig … Ohne Zweifel, sein Ziel war ebenfalls der Grünschnittcontainer.
Als ich mich in den fließenden Verkehr zurückreihte, wurde mir klar, warum er seine silberne Kutsche nebst Frau auf der anderen Straßenseite parkte.
Herzliche Grüße an der Stelle nach Oberhausen! 🙂
Jetzt weiß ich nicht: Fahre ich in die Waschanlage?
Meine Kollegin will sich trauen, hat sie verkündet. Sie müsse sich endlich wieder am Kackbraun erfreuen. Deswegen hätte sie den Wagen so bestellt. Soll ich nachziehen?
Also, das mit der Farbe ist mir egal. Meins ist nüchtern finster, wie ein Auto sein muss. Das sehe ich auch ohne Schaumwäsche. Nichtsdestotrotz war ich in diesem Jahr bereits zweimal beim Putzen! Blauer Himmel, die Straßen rappeltrocken, reih‘ ich mich in die Warteschlange vor der Nasszeile. Die Vögel brüllten lieblich – und am Tag darauf: Schnee! Das hätte ich mir sparen können.
Wetter wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts protokolliert. Am 22. Mai 1958 gab es den spätesten registrierten Schneefall. An dem Tag muss sowieso eine Menge los gewesen sein: Spatenanstich für den Dortmunder Fernsehturm; drei Wisente aus dem Münchener Tierpark in den westfälischen Wald umgesiedelt (der Stier hieß Hella); in Pforzheim demonstrierten Tausende gegen Atomwaffen und der Herr Busler vom TTV Großkreutz wurde geboren. (Wer das ist? Keine Ahnung. Kam im Netz bei Suchanfrage nach Datum.)
Ich will jedenfalls nicht Schuld sein, sollten morgen einem dem Grillwürschtel an der Zange festfrieren!
Nun habe ich noch nicht probiert, ob der Schneesturm auch losjault, wenn ich statt Waschanlage mit dem Eimer rausgehe. Da wo ich herkomme, ist Selberputzen streng verboten. Auf dem Land ist eh vieles verboten. Meine Freundin Jette spricht gerne von Kuhbläke (dt.: kleine Siedlung oder Dorf) oder Kaff, je nachdem, wie viel Sprechzeit der Kontext zulässt.
In Mülheim stört den Wagen von Hand durchzuwaschen jedenfalls keinen. Man soll von Motorwäsche absehen und seinem Putztrieb nicht in der Nähe von Gewässern frönen.
Auf dem eigenen Grundstück dürfen unsere Oberhausener Nachbarn ebenfalls wienern – allerdings nicht auf öffentlichem Platz. Ich habe mir das eben erklären lassen: Bei dem Verbot am Straßenrand zu schrubben, geht es um die Gefahr, wenn einer mit seinem Lappen am Bordstein rumspringt. Da reißt er die Türen auf, schmeißt den Eimer um – Mädels das Ganze vielleicht noch in kurzem Rock (Achja, sowas darf man ja nicht mehr thematisieren!)… Jedenfalls: ZACK, könnte es auf der Straße wo knallen.
Mit Umweltschutz hat das demnach nichts zu tun. Und weil man das Gesetz in den 1970er Jahren nicht mit zig Ausnahmen aufblähen wollte – „am Straßenrand nicht, dafür auf dem Parkplatz hinterm Stadion“ – hat man es allen einfach gemacht und gesagt: Geh‘ Waschanlage!
Wie oft waschen Sie denn so Ihren Wagen?
Ich glaube, ich lasse das mit dem Badetag, ich nehme das Fahrrad.
Wenn die Sonne untergeht, wandern amüsierwillige Männer und Frauen vom Land über die Chaussee…
Sie ist stärker, die Frau, deswegen schultert sie ihren Auserwählten. Aber was sucht sie heim, derweil sie zehn Amors übereinanderstapelt durch die Gegend buckelt? – Frauenmangel bei Kröterichs!
Das brave Krötenweib schleppt seinen Prinzen kilometerweit. Sie ist mit ihm auf dem Weg zum Tümpel ihrer Geburt. Der Marsch könnte weniger beschwerlich sein, entließe sie ihren aufgefädelten Nachwuchs in nähere Pfuhle. So ausgekocht sind allerdings nur vereinzelte Backfische.
Da die Kröten verständlicherweise anderen Verkehr als den auf der Straße im Kopf haben, regeln den letzteren Stadtverwaltung und Anwohner. Pünktlich, kurz vor sieben, geht der Schlagbaum runter. Und Frau Müller steht davor, weil sie ausnahmsweise aus der falschen Richtung zum Heimathafen will. Da dreht frau halt und fährt woanders lang. Aber nicht alle Wege führen heim.
Genau genommen muss man sich in Folge völkerwanderungsbedingt gesperrter Hauptstraße bei den Bessersituierten langschleichen. Die mögen aber den Durchgangsverkehr des gemeinen Volkes nicht und tun dies mit Durchfahrtverbotsschildern kund. Weil das gemeine Volk sich darum wenig schert – immerhin hat auch der Plebs ein Recht auf Feierabend – holen sich die Bessersituierten ab und an Hilfe von der Polizei.
Hier kommt jetzt der Punkt, wo mich verunsichert.
Ursprünglich langte:
Scheibe runterkurbeln
„Guten Abend. Hier dürfen Sie nicht durchfahren!“
„Oh, habe ich gar nicht gesehen… Kommt nicht wieder vor!“
„Dann gute Weiterfahrt.“
Scheibe hochkurbeln
Irgendwann muss das wem zu blöd geworden sein. Statt des lehrreichen Dialogs oblag einem jetzt bei Kontakt 15 EUR Wegzoll abzudrücken.
Ein gutes Argument. Dort fahre ich nicht mehr durch.
Ich bin aber dafür, wir vergelten! Wir könnten unsere Straße auch Anwohner-Frei machen. Noch besser: Wir führten das in ganz Mülheim ein, dann hätte sich das mit den grünen, gelben und roten Abziehbildern an der Windschutzscheibe auch erledigt!
Für das Feinstaubplakettenregulativ gibt es übrigens auch solche guten Argumente. Reist man nach Oberhausen ein und trägt das Ding im Geldbeutel am Mann, kostet das exakt 60 EUR plus eine Briefmarke für den Anhörungsbogen.
Da muss man reinschreiben, was man sich dabei gedacht hat. Dass einen das handschriftliche Kennzeichengeschmiere stört, zum Beispiel.
Und die Stellungnahme wird auch erwartet! Wer den Fragebogen jungfräulich in einem Ordner ablegt – weil er meint, die Sachlage sei klar und Fehler sei Fehler – erhält einen weiteren Bescheid für 25 EUR on top. Wegen Missachtung des Kommunikationswegs. Ja, liebe Leser, Lernen durch Auseinandersetzen!
(Es wäre sehr freundlich, sähen Sie davon ab, nachzufragen, wieso ich das weiß.)
Jedenfalls wird der Krötenumzug in diesem unberührten Frühjahr länger andauern. Und so nachts das Quecksilber auf unter 7 Grad schrumpft, bleiben die Kröten daheim. Viecher schimpfen halt auch auf’s Wetter. Drum Obacht wenn es dustert!
Ein kleines P.S. für Locationbewanderte, die stutzig macht, warum ich nicht einfach die paar hundert Meter weiter gefahren bin und dann abgebogen: Bin ich gestern auch! Aber die Baustellenzeit gilt es gleichwohl zu verdauen… 😉
Mein Kollege Klaus formulierte es artiger, aber im Kern sagte er, ich solle ihm nicht weiter mit meinen grauen Haaren auf den Zwirn gehen. Ich solle es in mein Blog wursten, da würde sich schon jemand finden. Leidensgeschichte, Handling und so.
Man muss wissen, bei meinem Kollegen wächst es oben schütter. Da macht er sich andere Gedanken – keine ums Färben. Trotzdem, ich weiß nicht, was er hat, ist ein wahrhaft interessantes Thema!
Es ist nämlich so, dass das Bleichmittel Wasserstoffperoxid für die altersweise Rübe verantwortlich ist. Beim Stoffwechsel entstehen überall im Körper kleine Mengen. Auch im Haar. Wenn im Alter der Körper mit dem Abbau nicht mehr so fix ist, behindert das die Bildung des Haarfarbpigments Melanin. Erst wird der Mensch grau auf dem Kopf, später weiß.
Aber schon die Römer wussten, der Farbe auf die Sprünge zu helfen. Henna färbt rot, Ziegenfett und Birkenasche blond, nur schwarz war etwas aufwendiger zu bekommen. Wer schwarzes Haarfärbemittel wünschte, musste das von langer Hand planen. Blutegel sammeln, zerdrücken und anschließend sechzig Tage lang in Wein und Essig einlegen.
Heute geht das einfacher. Die 70 Prozent von uns Frauen, die Haare färben (und die 3 Prozent von Euch Männern), gehen entweder zum Friseur (der kassiert dafür viel Geld, er kann sich selber Gedanken machen, wie er die Farbe kreiert) oder man wandert zum Drogeriemarkt des Vertrauens. Dort entscheidet man, ob man seine Nachbarn beunruhigen und 110 rufen lässt, weil die Farbe nach einmaligem Waschen wieder spurlos vom Kopf verschwindet; ob sie mehrere Wäschen halten soll; oder ob man die ständige Sauerei im Bad scheut und nur regelmäßig den Ansatz nachstreicht.
Mir ist das ja alles zu kompliziert. Meine Mutter verdient zwar ihr Geld mit Haareschneiden, aber als ich sie vor ein paar Jahren um Rat fragte – meine Grauhaarmaterie fasste eben Fuß – zeigte sich, dass wir nicht zusammenkämen. Meine Mutter verschönt tagsüber die Köpfe älterer Damen. Kurze dauergewellte Haare auf Lockenwicklern unter die Trockenhaube, Sie wissen schon. Oder sie betreut „frechen asymmetrischen Schnitte“ …
Ich glaube, ich stelle das Thema einfach zurück. Oder ich finde jemanden, den ich weiterhin mit meinen grauen Haaren vollquatschen kann.
Die Sonne kommt raus!
Spiegel!
Pinzette!
Die Osterferien waren noch keine zwei Stunden jung, als im Display einer von des Pubertikels Kumpeln angezeigt wurde. Gut gelaunt ging ich ran, ließ den anderen nicht zu Wort kommen (weil wir waren kurz vorm ersten Funkloch nach der Autobahn) und verwies ihn stattdessen auf die Mountainbikestrecke. Sagte der Kumpel, er wisse das, er sei ebenfalls dort und wir sollten bloß schnell kommen!
Vom ersten Funkloch bis zur Mountainbikestrecke kann man fast spucken.
Mein Mann sagte: „Sie haben dich angerufen und nicht den Krankenwagen, so schlimm kann es also nicht sein.“
Mein Pubertikelchen – sehr blass und sehr steif – er könne jetzt Saltos machen und ihm sei kalt. Er sprach leise und bewegte nur Füße und Mund. Blut lief nirgends raus, auch als mein Mann an ihm rumdrückte, spritzte nichts. Die Kumpel brachten die Ausrüstung den Berg runter und einer fragte, ob er das Dirt Bike zu uns nach Hause fahren solle. „Das mache ich schon“, bedankte ich mich und wünschte den Jungs einen schönen Nachmittag.
Für diejenigen, die kein Pubertikel oder sonstige fahrradverrückte Angehörige haben und sich fragen, weswegen die Kumpel feixten: Ein Dirt Bike ist ein stabiles Fahrrad mit kleinem Rahmen. Man macht damit Dirtjump (dt. „Schmutzsprung“) über Erdhügel. Weil der Sattel niedrig eingestellt ist, kann man sich mit den Knien die Ohren zuhalten.
Auf der Heimfahrt schwieg unser Pubertikelchen und saß weiterhin sehr aufrecht. Außerdem war er irgendwie langsam, erzählte mein Mann mir hinterher. Wer unser Pubertikel länger als zwei Tage kennt, weiß, dass da was nicht stimmt und so beschloss mein Mann, ins Krankenhaus zu fahren.
In den Gängen stellte das Pubertikelchen verwundert fest, dass er die Wegweiser nicht entziffern konnte. Da langten sie aber schon in der Aufnahme an. Eine Schwester schaute ihnen freundlich entgegen: „Fahrradunfall? – Dann setzten sie sich mal da hin.“ Meine Männer hatten die vollbesetzte Stuhlreihe mit den anderen, die wohl ebenfalls keinen Bock auf Ferien hatten, noch nicht erreicht, als die freundliche Schwester rief: „Nein, Sie gehen besser gleich zur Ambulanz durch! Warten Sie nicht bis jemand aufmacht, schellen Sie!“
Mein Mann fand das gut, immerhin war Freitag und er hatte jetzt Urlaub.
Den Arzt kannten sie noch gar nicht. Ansonsten ein Heimspiel: Fragebogen, Röntgen, Biegen, Drehen, Drücken – Schleudertrauma und vier Tage Bettruhe. Ohne TV, ohne Buch und ohne Computer. War aber nicht schlimm, unser Pubertikelchen wollte das auch nicht. Er schlief vier Tage. Bevor er sich niederlegte, sagte er noch, vom Biken wolle er nichts mehr hören.
Dass er das tatsächlich fast zwei Wochen durchhielt, lag nur daran, weil wir im Anschluss an sein Krankenlager endlich in die Osterferien fuhren.
Heute verleben wir den letzten Ferientag und man kann abschließend feststellen: Der Jung ist in allen Bereichen vollständig genesen und auch das Mundwerk ist intakt.
Käme das Pubertikel nach seiner Mutter, litten seine Erzeuger tierisch unter Langeweile. Nehmen wir zum Beispiel meinen heutigen Vormittag, der sich bereits gestern so einstielte: Auf den allerletzten Drücker steigt das Pubertikel früh in seine Treter, hat die Türklinke schon fast aus der Wand gerissen – fällt Mutter ein: „Ich komme erst nach 19.oo Uhr heim, hast du Schlüssel?“ Das Pubertikel sammelt sich: „…. nö. Ich nehm‘ deinen Bund!“ Im Flur wird hektisch geklimpert, der Schlüsselkorb kracht auf den Boden und der Jung will sich verdünnisieren. Das glauben Sie nicht, wie schnell ich an der Haustür war! „Nix da!“ Jetzt kann ich das brave Kind ja schlecht bis zum Dunkelwerden draußen stehen lassen – gut, es wär vielleicht eine Überlegung wert – aber es ist Winter. Nein, das tut man nicht! „Ich mach‘ meinen Hausschlüssel ab und deponier‘ ihn draußen, wenn ich gehe.“ (Klar, unter den Blumentopf neben der Türe, wo man sowas halt versteckt.)

Heute Morgen wusste ich das natürlich nicht mehr und wie ich vorhin heimkomme…….. Bin ich noch eine Runde durch Mülheim gegurkt: Schlüssel organisieren.
Passiert ist mir sowas ja schon mal: das Pubertikel noch ein herziges Minikerlchen, Freitagmittag und mein Mann übers Wochenende in Heidelberg. Null Schlüssel weit und breit – nicht mal einen Autoschlüssel – lag alles behütet im Haus. Nun war aber Sommer und beide Flügel des Doppelfensters zum Garten gekippt. – Wissen Sie was? Es ist easy, die Fenstergriffe von außen zu öffnen und einzusteigen! Das habe sogar ich beim ersten Anlauf und ohne kriminelle Energie geschafft.
Also, Leute, macht Eure Fenster zu, wenn Ihr geht!

Mein Geflügelkind feiert nachher Wiegenfest – was ein Stress.
Habe ich also, wie von der Jubilarin bestellt, extrem zuckerlastige Formgussartikel besorgt und dieses prasselige Kartoffelröstzeug. Fürs Alibi dazugepackt gibt es auch geschnittene Gurke, Möhrchen gestiftelt, futzelige Tomaten, Mandarinen und Apfelspalten. Das Grünzeug werden sie nicht wollen, aber mutter weiß ja, was sich gehört, wenn einem so viele StammhalterInnen anvertraut werden.
Dieser 6. Hellageburtstag ist genau jener Anlass, wo ich beim Pubertikel davon abkam, jemals wieder einen in den heimischen Wänden abzuhalten. Erklären brauche ich das nicht; Eltern fühlen, wovon ich rede. Großeltern sagen an der Stelle gerne, man müsse sich nur mehr bemühen, früher hätten sie auch zehn Kinder in der Wohnstube beschäftigt. „Im Winter, und da stand sogar noch der Weihnachtsbaum rum!“ Hut ab. – Ich lass‘ es trotzdem bleiben.
Heutzutage suche ich im Internet nach der Telefonnummer, reserviere einen Tisch; die schmücken den und ich bestücke die Stellfläche mit Knabbereien und Getränken. Der Obolus für diese Rundumbetreuung ist im Vergleich zu den Renovierungs- und Aufräumarbeiten, die eine solche Veranstaltung daheim vonnöten machte, ein Klacks.
Irgendwie freue ich mich auf nachher. Solche haushohen Klettermasten mit Polsterrutschen – in dem Alter finden die Wänster das noch richtig gut, wenn Muttern mitmacht.
Halten Sie mich hier mal nicht weiter auf – ich geh‘ jetzt spielen!
Nein, nicht ich – mein Mitbewohner Eddy ist der, der hickst. Das ist aber nicht weiter tragisch. Schluckauf wird meistens durch vorübergehende Überdehnung des Magens ausgelöst. Das kann passieren durch zu hastiges Essen, ‚Hoch die Tassen!‘, oder wenn sich einer mächtig fürchtet. Verhält sich bei den Schweinderln wie den Leuten. Es gibt aber auch Fälle, da dauert vorübergehend etwas länger. Die längste Heimsuchung durchlebte der Amerikaner Charles Osborne: Er begann 1922 zu hicksen. Alle zwei Sekunden, 43.200 Mal am Tag – 69 Jahre lang.
Für Meersau Eddy kann jedenfalls nur das mit dem gierigen Vertilgen zugetroffen haben. Der hat hier den Himmel in der Stube. Grausen kennt er nur, wenn die Familie Koffer packt und die Meersaureisekiste ins Blickfeld stellt. Außerdem sind das Schweinderl und ich vormittags allein daheim. Ich am Schreibtisch, er hinter seiner Bude und döst. (Keine Frage, nach Abzug der Wilden Horden am Morgen würde ich auch lieber Erholung suchen, bis die am Nachmittag auf dem Rückweg wieder durchkommen – aber Einer muss ja. Und ich rede hier nicht von Fußball.)
Bei Mäusen wurde letztens übrigens was Schönes entdeckt: Sie haben unter ihrem Pelzmantel Nervenzellen, die auf Streicheln mit wohligem Gefühl reagieren. Unter Meerschweinfell gibt es solche Nervenzellen bestimmt auch, da brauche ich keine Wissenschaftler für. Streichelt einer Eddy, fängt der an zu glucksen und zufrieden zu quietscheln. Ein wenig schaut er auch aus wie eine Maus – nur beleibter und ohne Schwanz.
Wie sich das mit den Empfindungsnerven der Menschen beim Streicheln verhält, wird noch untersucht.
Für den guten Zweck: Streichelprobanden im Dienste der Wissenschaft vor!
Aber fragen Sie mich nicht, wo man sich da melden muss.

Hilft nichts, ich werde zum Zahnarzt müssen…
Seit Jahresanfang prokrastiniere ich das schon und zweimal habe ich wegen Wetter abgesagt. Für morgen steht ein neuer Termin in meinem Kalender. Soll ich? Schnee läge genug…..
Für fast jeden Firlefanz gibt es ein Mittelchen zur heimischen Anwendung. Nehmen wir zum Beispiel meine Spüle. In der Adventszeit hatte ich ein Seminar. Bin spät dran, schnappe eine Tasse aus dem Schrank und ZACK: Rauscht mir das Ding ins Spülbecken. Als Erstes habe ich mal gebrüllt. Das widerum lockte trotz der frühen Stunde meine Mitbewohner an. Hellakind brach sofort in Tränen aus: „MEINE TASSE! MEINE LIEBSTE BÄRENTASSE!“ Das blöde Ding war heil, Spülbecken aufgeplatzt. Mein Mann sagte, ich müsse nicht so ein Spektakel veranstalten, wenn ich eine neue Küche wolle. Das Pubertikel feixte und wandte sich seinem Handy zu.
Am Nachmittag nahm ich mich der Sache an; am übernächsten lag ein Päckchen von einem Hersteller für Sanitärkeramik im Kasten. Da waren die so nett und haben mir einen Keramik-Reparaturstift geschenkt. Was red‘ ich – sogar zwei Stifte habe ich bekommen! Einen hellen und einen dunkleren, weil ich die genaue Farbe nicht angeben konnte. Nun denken Sie sicher, dass Frau Müller sich bereits zum Weihnachtsbraten über ihre frischrenovierte Spüle freute. Pustekuchen! Weil das Versiegelungszeugs einer vierundzwanzigstündigen Trockenzeit bedarf, steht es immer noch im Regal. Und ich gieße seitdem meine gekochten Nudeln und Kartoffel ins Kanal ab. – Aber hören wir vom Essen auf, wir waren doch bei den Zähnen!
Wollten Sie nicht auch schon immer wissen, wieviel Füllmaterial pro Mitmenschengebiss verbaut ist? Spricht man ja normalerweise nicht drüber. Ich auch nicht. Fragen Sie mich mal, wieviele Füllungen ich habe. Verrate ich nicht.
Aber ich weiß, wo es solche Zahlen gibt: 11,7 behandelte Zähne hat jeder von uns. Und 2,4 entfernte.

Als gestern Abend der fürs letzte Wochenende angekündigte Märzschneesturm losging, beschwerte sich meine Freundin Sandra, sie verstünde nicht, wieso sie um 7.oo Uhr morgens den Gehsteig wienern soll, wenn für Straßen was anderes gilt. Ich konnte das auch nicht beantworten. Aber ich sehe das auch nicht so eng. Ich würde den Teufel tun und mitten in der Nacht hinter irgendeinem Schieber herlaufen. Ganz gleich, ob wochentags Schneeräumpflicht von 7.oo – 20.oo Uhr gilt. „Du zählst nicht“, sagte daraufhin meine Freundin Sandra. „Leute mit Homeoffice halten den Rand.“
Hat sie natürlich recht. Am gefährlichsten ist es trotzdem im Haus. Haushaltsunfälle bringen jährlich mehr Leute unter die Erde als der Straßenverkehr. 2010 waren 7.533 Haushalts- und 3.648 Verkehrstote zu beklagen.
Homeoffice ist auf alle Fälle richtig gut. Ist ja auch zum Arbeiten da und nicht etwa zum Putzen.
Jedenfalls steht in der Mülheimer Straßenreinigungssatzung, dass die Schneeräumpflicht erst besteht, wenn es aufhört zu schneien. Dann ist doch alles fein – heute muss hier wohl keiner mehr den Besen schwingen.
(Im Übrigen wollte ich nur endlich das Foto rausziehen! 🙂

Sagen Sie, wo lagern Sie Ihren Kaffee?
Bis vor wenigen Wochen steckte ich meine Ersatzbohnen in den Kühlschrank. Meine Mutter stopft ihre ebenfalls dort rein, allein bei meiner Oma war es anders: Sie kaufte Tütchen. (Ging halt gerne einkaufen.)
Nun schaute ich letztens einen Katastrophenfilm. Ein Vulkan brach aus und drohte, ein schmuckes Kaff zu vernichten. – Wie hieß der Film noch gleich? … ist ja auch egal.
Jedenfalls braute die Bürgermeisterin des Kaffs großartigen Kaffee. Als sie ihre To-Go-Becher rumreicht und die Jungs des Forscherteams über die koffeinhaltigen Kreationen herfallen, flicht die Kaffeefee nebenher ein, dass Kaffeeläger nicht in den Kühlschrank gehören. Der größte Süchtel des Teams beschloss daraufhin sofort: Dieses Kaff gehört gerettet! – Und ich war verwirrt …
Die nächsten Einstellungen des Films haben mein Mann und ich nicht mitbekommen, weil ich die neuen Erkenntnisse mit ihm durchsprechen mochte. Er meinte, ich solle ihn in Ruhe lassen, er wolle den Film schauen. Mir war aber das mit der Kaffeelagerung wichtiger. Als er etwas lauter sagte, wir könnten uns gerne nach Ende des Films der Thematik annehmen, war der Vulkan schon am Spucken.
Die Bürgermeisterin hat übrigens Recht, ich habe mich informiert. Kaffee fühlt sich als Bohne und in seiner Originalverpackung wohl und er mag es gern finster und geruchsneutral. Temperaturschwankungen kann er wegen der sich bildenden Kondensflüssigkeit nicht leiden und den Gefrierschrank verachtet er. Überhaupt ist er gegen umfangreiche Vorratshaltung und im Gegensatz zu mir kein Freund des Knoblauchs.
Mein Kaffee wohnt jetzt im Schrank, gleich neben den Nudeln. Das hätte er auch schon früher haben können, hätte sich mal einer beschwert. Hat aber nicht. Liegt bestimmt daran, weil wir den Kaffee total mit Milch verwässern … Da fällt mir ein, ich muss meine Mutter anrufen, sie soll ihren Kaffee freilassen! Eilig ist es aber auch hier nicht, eine geschmackliche Beeinflussung ihres erhitzten, leicht hellbraun eingefärbten Leitungswassers steht eher nicht zu hoffen …
In dieser Woche habe ich abends Termine. Also bringt mein Mann seine Tochter selber ins Bett. Wie die Woche voranschreitet, wird er nachlässiger.
Bei kleinen Kindern macht es durchaus Sinn (so das Bett nicht über eine integrierte Auffangeinrichtung verfügt) einen Stuhl vorzustellen. Den Stuhl hat mein Mann wohl gestern Abend vergessen…
Jedenfalls war es kurz vor zwei, als es nebenan gewaltig donnerte! Sie wissen schon, wenn ein Sack Zement zu Boden fällt. Ich fuhr hoch! – … Stille. Gerade war ich mir sicher: kein Fremder im Haus – als ein Zimmer weiter die Sirene angeknipst wurde. Hören Sie mir auf…
Als ich wieder ins Bett stieg, hatte mein Mann sich noch nicht einmal bewegt. Eingerollt lag er auf der Seite.
Heute Morgen sagte er: „Was eine himmlische Ruhe. Ich habe saugut geschlafen!“

Mein Schreibprogramm streikt! Verflixt und zugenäht!
Viel zu tun und das Klapperding nimmt frei.
Was mache ich denn jetzt?
Kaffeeholen habe ich schon probiert. Hat sich nichts getan. Ich soll meinen Administrator immer noch fragen. (Ja, mache ich, wenn er heim kommt!)
Sie haben zu tun, das verstehe ich. Und ich? Ich könnte jetzt Däumchen drehen…………… oder ich bringe das mit den Visitenkarten hinter mich. – Ja, gute Idee, das mache ich jetzt!
Herzlichen Dank für das Brainstorming, liebe Leser! 🙂
Erster Blinzler heute Morgen aus dem Fenster: Lebensbäume, Schnee und Lichtschlauchreh – alles in gewohnter Ordnung. Fast!
Vor dem Reh liegt ein Osterei! Ein gelbes. Wie kommt das Ei aufs Dach??
Es ist so: Die letzten zwei Monate ärgere ich mich, weil mein Mann so eilig den Weihnachtsbaum rausgestellt hat. Er hat sich voll durch den Abfallkalender unter Druck setzen lassen. Wäre doch urgemütlich: Schneegestöber und vorm Fenster der Baum! – Das Reh hat mein Mann ja auch noch nicht vom Dach geholt. Ich meine sowieso, den Rest des Jahres kann er es ruhig dort lassen. 270 Tage bis Totensonntag und er würde wieder raufkraxeln, Adventszeug aufbauen und so.
Aber egal was das Ei auf dem Dach will – mich beschäftigt seit heute Morgen nun die Frage: Wann bammelt man seine Dekoeier in den Vorgarten? So einen kuscheligen Karnickel auf der Fensterbank – zu meinem Haushalt zählen Leute, die hätten nichts dagegen. Bei meinen Nachbarn ist jedenfalls nichts zu sehen und meine Mutter weiß es auch nicht. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich habe das Internet befragt. Und dort entdeckte ich einen schönen Streit. Von: „Häng, wenn dir danach ist!“, über: „Häng, wenn du im Laden den ersten Schokohasen triffst!“, bis zu: „Ostersonntag und keinen Tag früher!“. Weil die Passionszeit, also die Leidenszeit, bis Sonntag dauert und erst zur Auferstehung die Eier – na, hängen eben. Das mit den Schokohasen im Laden gefällt mir besonders. Nehmen wir mal Weihnachten! Da ist es so: Man kommt vom Strandurlaub, will zum ersten Mal den Kühlschrank nachfüllen – und Zack, ist der Kassenbereich des Supermarktes mit Dominosteinen und Nikoläusen gepflastert. Danach werden kurz Silvesterraketen in die Regale geräumt – und seit Neujahr lagern dort die Osterhohlkörper.
Was mache ich jetzt mit meinen Eiern?
Ich mach‘ es einfach wie immer: Irgendwann beuge ich mich dem Druck der Kinder. Und so lange bleibt alles gut bewahrt im Keller.
Mein Mann hat Grippeschutz. Macht er schon jahrelang. Da reisen welche mit Gummihandschuhen und vielen Köfferchen in seine Firma und dann wird im Akkord gepikt. Nur wer will natürlich!
Mein Mann findet das gut. Und genauso lange versucht er schon, mich zu überzeugen. – Ich will aber nicht!
Ich habe schon deshalb noch nie gewollt, weil er sich die Dröhnung immer Freitag verpassen lässt. Das Wochenende laboriert er, schleppt sich von Liege- zu Sitzgelegenheit und wieder zurück und will nicht mal zum Fußball. Montagmorgen ist es durchgearbeitet und er geht voll Elan zurück in die Arbeit.
In diesem Jahr hat es ihn aber richtig gestreckt! Freitag das Dope, Samstag in die Herbstferien (über’s Jahr war ihm das mit der Nebenwirkung entfallen), Sonntag legt er sich nieder…
Drei Wochen hat es gedauert, bis er wieder der Alte war. Davon mehr als eine Woche Bettruhe. Fieber, Schmerz, Rotz und Leid – Männer halt.
Wie jedes Jahr fragte ich ihn während seiner Siechphase, ob er den Blödsinn mit der Grippeschutzimpfung im nächsten Jahr wieder machen wolle. Diesmal hat er verneint.
Bin gespannt, ob er sich im Herbst daran erinnert!
Morgens in Wedau von der A3 zu fahren, das macht richtig Bock! Mindestens einmal die Woche ist was los. Wollen Sie wissen, was es heute war?
Die Schilder sind weg! – Schilder? Diese gelben, die an einem Ende spitz zulaufen und die Richtung weisen. Nach Mülheim ging es rechts – gut, das tut es immer noch – Duisburger blinken links. Beide Schilder verschwunden. Ich frage mich nicht, was man mit solchen Riesenschildern will. Alles lässt sich irgendwie gebrauchen. Hätte ich gewusst, dass sie heute weg sind, hätte ich gestern genau hingeguckt. So schätze ich, ein Schild wird wohl fünfzig mal einsfünfundsiebzig gewesen sein. Demnach kosten beide ungefähr 300 Euro.
Wir brauchen dort im Wald auch keine neuen Schilder! Mülheim rechts und Duisburg links. Ist doch ganz einfach.
Was macht man mit denen, wenn sie hin sind?
Erst war der Hype grandios: Schmeißt die Glühlampen raus! Spart Energie! Schlagt den steigenden Strompreisen ein Schnippchen! – Bissel Köder für’s Gewissen, bisschen mehr für die Geldkatze; sowas funktioniert immer. Und außerdem halten die Sparlampen länger und so weiter und so weiter. Ich gebe zu, ich habe auch begeistert mitgemacht.
Nun läuft das aber schon ein paar Jahre und siehe da: Die Dinger gehen genauso schnell kaputt wie die Vorgänger. Sie riechen chemisch, wenn man nahe am Licht sitzt; es gibt genug zu lesen von Gefahren für Leib und Leben – und am Ende der wider Erwarten kurzen Lebensdauer: Wohin damit?
In jeder Energiesparlampe befinden sich ungefähr 2,8 Milligramm Quecksilber. Stürzt eine eingeschaltete Lampe und zerbirst, hilft nur schnelles Fenster-Aufreißen und den Raum für mindestens eine Stunde zu verlassen. Weniger Quecksilber verteilt sich, wenn ausgeschaltete Energiesparlampen zerklirren. Auf keinen Fall den Staubsauger verwenden! Da wird das Quecksilber erst richtig in die Raumluft gepustet. Der Verbraucherschutz rät: Die Reste mit Pappdeckeln aufsammeln, feucht nachwischen; anschließend alles in eine Tüte knoten und als deklarierten Sondermüll im Schadstoffhof abgeben.
Bei den geplätteten Energiesparlampen in meinem Haushalt sind allerdings fast alle Lampenkörper heil. Die wollten einfach nicht mehr. Nun könnte ich sie zwar weiter daheim horten (wir sind sogar schon mit denen umgezogen) aber es wird Frühling! Habe ich also fündig gegoogelt: Unter www.lightcycle.de lässt sich nach Postleitzahl die nächstgelegene Sammelstelle ermitteln. Für mich ist das ein Baumarkt. Deren Sammelplatz kenne ich bereits. In der Elektroabteilung steht ein 1,40 m hoher Pappkarton. Wie beim Briefkasten wirft man seine defekten Lampen oben durch den Schlitz…
Ich versuche morgen die zweite Empfehlung!
Am Wochenende habe ich richtig was verbaselt!
Das Hellamädchen war zum Geburtstag eingeladen. Den Termin wusste ich bestimmt schon einen Monat früher. Habe ihn ordentlich in meinem Planer notiert – und was da steht, das mache ich auch! Wie ich Sonntag das glitzernde Mädchen ins Auto stecke, blitzt mir das erste schwache Licht, dass wir den 10. haben könnten – die Party hingegen, so meine ich mich plötzlich zu erinnern, auf den 9. gesetzt ist…. Nun waren wir spät dran und Handy habe ich sowieso nie dabei. Auf dem Parkplatz war es dann klar, nicht ein bekanntes Auto…
Vor lauter Entsetzen hat das Hellamädchen auf dem Heimweg nicht einmal gezetert. Und Muttern war, ob des schlechten Gewissens und der Arbeit an einer Strategie zur Wiedergutmachung, auch eher schweigsam. Womit klebt frau jetzt ein Trostpflaster? Haben Sie da eine Idee? Die Naheliegendste, eine Fastfoodkette aufzusuchen, kam mir erst Anfang der Woche.
Mein Lastenausgleich war jedenfalls auch nicht schlecht: Mutter und Kind bastelten ein Vogelhaus aus Pappe; es gelang uns endlich, aus einem dieser langen Luftballons einen Hund zu formen und zum Schluss faltete sie mir Origami-Herzchen.
Vor Sonntag habe ich mich nur ein einziges Mal im Tag vertan! Das ist jetzt siebzehn Jahre her. Ein Vorstellungsgespräch mit 600 km Anreise. Da war ich aber einen Tag zu früh dran. Die nahmen mich dann fast drei Stunden in die Mangel. Den Job habe ich trotzdem nicht gekriegt. Komisch 🙂
Fahre ich gestern Morgen in Wedau von der Autobahn ab: Stau!
Acht Uhr, kein Schnee, kein Regen, was soll das?
Langsam schleicht sich’s vor zur Ampel. Und da sehe ich es: Fein mit Hütchen und Bauzaun abgesperrt, fünf Männer und ein Baustellenfahrzeug – kein Erdrutsch, nein: Da wird die Straßenlaterne wieder hingestellt!
Der Laterne ist es so ergangen wie vielen Laternen: Einer hat sie umgenietet. Mir ist immer noch unklar, wie dem das gelungen ist! Bürgersteig mehr als zwanzig Zentimeter hoch. Brückengeländer und Buschwerk machen einen unversehrten Eindruck. Jedenfalls grüßte die Laterne eine Woche im spitzen Winkel gen Mülheim. Ich habe das zum Anlass genommen, mich der Lancierung der Geschicke der gekeulten Laternen anzunehmen! – Das Mülheimer Stadtgebiet illuminieren exakt 13.863 Laternen. Circa 70 von ihnen ereilt jährlich das Schicksal. Das ist immerhin jede einhundertachtundneunzigste. RWE kümmert sich dann darum, dass die Trauerzeit kurz und fix Ersatz hochgezogen wird. Der übrigens, sofern sich der Verursacher nicht feststellen lässt, ungefähr 1.300 EUR aus dem Stadtsäckel jätet.
Aber passen Sie auf, wie gefährlich man hingegen als Straßenlaterne in Oberhausen lebt! Unsere Nachbarn haben zwar mehr Laternen, nämlich knapp 20.300 – aber dort wird bereits jede sechsundneunzigsten Lampe über den Haufen gefahren! Allein 210 neue Laternengräber im letzten Jahr.
Und was machen wir jetzt damit?
Laternen können gerne nach Mülheim ins Exil kommen. Speziell bei mir in der Straße ist es im Dustern ganz schön finster.
Karneval! Die einen leben ihn aus, die anderen stöhnen: Geh-Mir-fort! Zu welcher Gruppe gehören Sie?
Ich paddele irgendwo dazwischen. Wenn was los ist, mache ich mit – wenn mich keiner in den Hintern tritt, ist es auch gut.
Bei kleinen Kindern ist das schwarz-weiß. Sie lieben – oder sie verweigern. Mein Hellakind ist heute Prinzessin. Rosa mit Glitzertand und Plüsch…. eine Prüfung für ihre Mutter. Aber ist egal, ich muss ja nicht so rumlaufen. Als ich sie heute im Kindergarten ablieferte, tobte dort der Hofstaat von Ludwig XIV. Sie wissen schon, der Sonnenkönig von Frankreich, der mit dem Zwanzigtausendmann-Hofstaat und den prunkvollen Festen, der als Vierjähriger den Thron bestieg. An der Tür riss ein Nachwuchslöwe die Prinzessin von den Füßen, als er panisch vor einem Räuber davonlief. Der ließ jedoch schnell von dem Tier ab, weil ihn eine dicke Hummel verfolgte und ihm das Messer abnahm. Beim Schuheausziehen hockte sich eine Zigeunerin daneben und prüfte mit den Zähnen der Prinzessin Geschmeide. In der Küche ackerten die Mägde – und im Gruppenraum dann eine Herde ebenfalls rosafarbener Prinzessinnen, die von einer Hexe in Schach gehalten wurden. Nur der Feuerwehrmann gab mir zu denken, er muss sich in der Zeit vertan haben.
Ach, ich möchte auch noch einmal in den Kindergarten. Da gehst du nachmittags heim und früh wieder hin – und dazwischen hast du Freizeit.
Letzten Samstag war ich auf einer Veranstaltung, drinnen wurde geraucht.
Ich hatte ganz vergessen, wie es ist, an der Bar auf die Hände der Nachbarn zu achten. Wenn einer die Fluppe abspreizt und ausschweifend gestikuliert – nicht blöd vorsichtig zu sein.
Ich hatte mir jedenfalls den Skalp einer Untoten besorgt. Weißgepuderte, aufgetürmte Korkenzieherlocken an gestrickter Ersatzkopfhaut. Feuerfest, stand auf der Verpackung. Getestet habe ich es nicht, weil kaufen Sie mal Samstag Abend eine neue Frisur! Während Sie noch durch die Stadt tigern, schiebe ich Ihnen ein paar Infos auf den Monitor: 27 Prozent unserer Mitbürger schmauchten im letzten Jahr. Im Schnitt quarzte jeder von ihnen 6.045 Kippen. Mit solchen Zahlen kann sowieso keiner was anfangen, deshalb runtergebrochen auf einen Tag: 16,6 Ziggies pro Lunge.
Nichtraucher werden statistisch übrigens unterschieden in solche, die nie geraucht haben (54%) und Ex-Raucher (19%). Ich gehöre zur letzteren Gruppe. Schon ewig her. Gute fünfzehn Jahre. Und dabei wollte ich damals nicht mal aufhören!
Eines Tages stoppte mein Boss smoking. Am folgenden Tag war er zickig. Am übernächsten legte er mir wortlos ein Buch auf den Schreibtisch: Allan Carr, „Endlich Nichtraucher!“ Und noch einen Tag drauf hatte ich Grippe. Die war so vollendet – ich konnte nicht mal rauchen. Aufstehen ging auch nicht; aber das Buch lag auf meinem Nachttisch. Da habe ich es halt irgendwann gelesen…
Allan Carr hat weitere Rauchabschwörer verfasst: „Endlich Nichtraucher – für Frauen“, weil die ja anders ticken; „Endlich Nichtraucher – der Ratgeber für Eltern“, weil Jugendliche erst recht… – Lassen wir das! Dann noch eins für Lesemuffel und eins für solche, die trotz bester Vorsätze irgendwann rückfällig werden.
Allan Carr lebt leider nicht mehr. Er ist 2006 gestorben. 23 Jahre nach seiner letzten Zigarette – an Lungenkrebs.
Kennen Sie das: Es ist Nachmittag und dem Job ist es völlig gleich, dass diese Tageszeit einem Zwerg gehört?
Was tut man in so einem Fall?
Die blödeste Idee wäre, den Job abzulehnen. Also organisiert man. Man gibt das Kind – im vorliegende Fall das Hellamädchen – nach dem Kindergarten bei einer Kumpelin ab – oder man nimmt die Kumpelin mit nach Hause. (So man über ein Großelterngeflecht verfügt, braucht man hier nicht weiterlesen!) Während der Heimfahrt legt man eine Kinder-CD ein, schaltet auf Durchzug, und beginnt im Kopf ein Konzept zu entwerfen. Über kurz oder lang erreicht man den Heimathafen.
Normalerweise läuft das dann so: Gastkind im Haus und das eigene Kind vergisst, dass es eine Mutter hat. Also, so ganz vergisst es das nicht. In geregelten Abständen findet es die Frage nach einem weiteren Eis angebracht. Dies verlangt aber nicht viel Bohei. Ein bestimmtes „Nein!“ und man hat wieder seine Ruhe. Letztens jedoch – Und ich hatte wirklich Stress! – da lief gar nichts! Im Zwei-Minuten-Takt wurden mir Dinge berichtet und die sollte ich mir auf der Stelle ansehen! Hungrig waren sie auch ständig, aber dann doch nicht – sogar Gemüse wollten sie. Hauptsache ich verließ meinen Schreibtisch und lief ein wenig herum. Irgendwann kamen sie nicht mehr. Himmlische Ruhe. Endlich.
Was meinen Sie, wie ich aufgesprungen bin, als plötzlich zwei kleine Mädchen neben mir flüsterten, das Klo sei so voll!
Ich kenne mich in meinem Badezimmer aus, deshalb wusste ich: Unter dem Haufen Papier in der Ecke ist das Klo! Das hatte ich auch nicht falsch in Erinnerung, denn als ich zwei Armladungen blassblauer Wölkchen in den Mülleimer gestopft hatte, stand sie vor mir: die Schüssel. Müttern ist klar, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Kloschüssel war jedenfalls randvoll Knüllpapier.
„Was ist denn hier los?“ Die Frage musste erlaubt sein. Erst konnten sie sich die Geschichte nicht erklären. Logisch. Das hätten sie so vorgefunden und hätten sich auch gewundert. Und ich sollte mal den großen Bruder fragen.
Half ja nichts, ich zog Gummihandschuhe über und fischte ein paar triefenden Wolken heraus. Dabei habe ich die Hella kurz an den Osterhasen erinnert, was wiederum ihrem Gedächtnis auf die Sprünge half. Die Mädels waren – wie das bei Frauen gerne so ist – gemeinsam auf dem Klo. Darüber traten Schwierigkeiten beim Treffen auf. Weil Mädels von Natur aus ordentlich sind, befassten sie sich mit der Schweinerei. Ausgiebig. Klar.
Ich bin mir nicht sicher, wieviele Rollen Klopapier dabei draufgegangen sind – aber ich weiß, dass eine 4-köpfige Familie in der Woche vier Rollen benötigt.
Glauben Sie es mir, meine Hand hat gezittert, als ich den Spülknopf drückte….
Die ganze letzte Woche habe ich mich gefreut: ENDLICH ALT GENUG FÜR DALLAS! Kein Matriarchat mehr – nur mein Mann wollte zuerst nicht.
Ich sage es gleich: Wir haben nicht bis Ende geguckt.
Die Menge eruptiv gestreuter männlicher und weiblicher Vornamen überforderten uns. Also konzentrierten wir uns auf die Bilder. Im Brautshop bekam mein Mann einen Lachflash. Es gefiel ihm, wie Sue Ellen und Bobbys Frau das Hochzeitskleid erspähten.
Ab elf meinte mein Mann, er könne auch schlafen gehen. Aber weil man nicht vorschnell urteilen soll…….
23:14 Uhr wurde es ihm endgültig zu viel. In dem Moment, als Christopher John Ross in die Erdbeerbowle schubste, wurde es bei uns duster.
Jetzt kann ich jedenfalls mitreden. Schlimm war es also nicht, dass meine Mutter mich vor 25 Jahren ins Bett gesteckt hat. Und wissen Sie, was ich jetzt mache?
Ich rufe meine Mama an und sage ihr das!
Aber, wie ich die kenne, wird sie geguckt haben… Und zwar bis Ende.
Da gibt es etwas, das möchte ich hier breittreten, bevor es zu spät ist!
Vor zwei Wochen, als ich ein paar Tage auf meinem verschneiten Berg im Exil verbrachte, musste ich jeden Tag Schlitten fahren. Schlittenfahrenmüssen, weil Hella war ebenfalls hier festgeschmiedet. Wegen ihr waren wir überhaupt im Exil. Aber egal. Jedenfalls war es mächtig kalt und Muttern, ganz typisch Frau, hat mörderisch an die Flossen gefroren. Da denkt frau sich nichts bei, weil frau kennt das ja. – Denkste! Auf einer Tour durch den heimischen Mischwald ist mir der kleinen Finger der rechten Hand erfroren. Das klingt jetzt wie Fischstäbchen, aber, keine Sorge, alles noch dran. Lediglich temporär optisch und funktional etwas eingeschränkt. Ich habe nur Erfrierungen 1. Grades. Und die kriegt man sogar relativ fix! Finger, Zehen, Nase und Ohren sind besonders gefährdet, wegen der großen Oberfläche und der schlechten Blutversorgung. Bei besonderer Kälte schrumpeln sich dort die Blutgefäße zusammen, was die Blutzufuhr verlangsamt und somit den Wärmefluß erst beeinträchtigt und später einstellt. Von solchen lokalen Erfrierungen merkt man erst mal nichts. Lediglich anhaltende Gefühllosigkeit deutet darauf hin. Erste Hilfe verlangt jedenfalls schnelles Auftauen! Unterwegs sollte man die Hände in die Achselhöhle stecken oder an den Oberschenkeln erwärmen. (Wobei, wer wird so blöd sein, wenn ihm eh schon kalt ist, die Jacke aufzuratschen…) Ich halte es mehr mit dem zweiten Tipp: Schnell nach Hause und in maximal 40 Grad heißem Wasser auftauen. Auf keinen Fall jedoch, wie man früher riet, die erfrorenen Gliedmaßen mit Schnee abreiben! Ach ja, ein weiterer Punkt aus dem Erste-Hilfe-Katalog bei Erfrierungen gefällt den meisten sicher auch: Trinkt Alkohol! Wirkt gefäßerweiternd, das ist wichtig, damit die Blutzirkulation wieder in Gang kommt.
Nun fragen Sie sich vielleicht: Hat sie heute, am ersten meteorologischen Frühlingstag, kein besseres Thema gefunden?
Nö, hat sie nicht. Stellen Sie sich mal vor, ich käme Ihnen in den Sommerferien mit der Frostbeulengeschichte!
Montag ist kein Termin zum guten Zulesen, ich weiß. Deshalb nur was Kurzes: Mein Ginster blüht sich tot! Ginster? Grünzeug für draußen. Blüht gelb, selten rot, ist ein Schmetterlingsblütler und gibt es als Bodenrumkriecher, stachelig wehrhaften Busch oder als Heckengesträuch. Er hat es auf 90 Arten gebracht. Gehört übrigens auch zu den Plagen, so man die Neuseeländer fragt. Aber zurück zu meinem verwirrten Ginster!
Seit einem Dreivierteljahr geht das jetzt: Mein Ginster blüht und leuchtet und schert sich einen Dreck um’s Wetter. Pünktlich im letzten Frühjahr sprossen die ersten gelben Blüten. (Regulär darf er von Mai bis Juli.) Den Sommer über und den Herbst verhielt er sich annähernd artgerecht, weil da fällt es keinem auf, wenn ein grüner Busch mit gelbem Blütenschmuck dasteht. Aber seit Dezember – ich mag gar nicht hingucken! Ich fange an zu zittern, wenn ich die zarten Blüten im eisigen Wind schlottern sehe. Vorn an den Blütenspitzen lässt sich gut erkennen, wie der Frost seit Tagen hineinbeißt. Ganz weiß sind sie geworden und knittrig. Aber der Ginster wird nicht schlau! Unbeirrt schießt er täglich neue Blütenfräuleins durch sein Rutenwerk. Ziemlich hirnrissig, jetzt im Januar. Heute wird er wohl auch nicht damit aufhören, weil lohnt sich ja nicht mehr, wenn ab morgen die Bienen kommen. 13 Grad, Leute, schreibt der Wetterlurch für Mülheim! Zieht Euch warm an!
So eine Meersau ist echt total verfressen!
Zwei Handvoll Viech – was mag so ein kleiner Braten wiegen?
Eben nachgeschlagen: 1.300 g ungefähr das ausgewachsene Männchen. Am Tag verschnurpselt so ein Meersauherr 300 g Gemüse. Möhrchen und dergleichen Zeug. Der Jung haut sich also 25 Prozent seines Körpergewichts durch die Futterluke rein. Solche Dimension auf Menschen übertragen – aber hallo!
Der einheimische männliche Mensch wiegt 82,4 kg und ist 1,78 m groß. 25 Prozent Nahrungsaufnahme würden für diesen Durchschnittsmann 20 kg zum Zerkauen bedeuten.
Zerkauen, und – na gut. Jedenfalls mag ich mir das gar nicht vorstellen! Allein der Einkaufsstress an Weihnachten. Nehmen wir an, Sie haben zwei dieser ausgewachsenen Männer daheim. Hotel Mama, oder so etwas. Im Jahre 2017 fällt Heiligabend auf einen Sonntag. Sie ziehen also am Samstag vor Weihnachten los: Feiertagseinkäufe besorgen. – Stopp! Ganz die Frauen unterschlagen! – Deutschen Frauen, die im Schnitt 1,65 m groß sind, zeigt die Waage 67,5 kg. Nach der 25-Prozent-Regel bräuchten sie 17 kg Essen am Tag. Möhrchen, versteht sich.
Für diese arbeitnehmerfreundlich fallenden Weihnachtsfeiertage benötigten Sie und Ihre Familie also genau 228 kg Möhrchen. Zur besseren Verdeutlichung entspricht das übrigens dem Gewicht eines halben Rindviechs.
Aber die ganze Rechnerei hier ist sowieso Blödsinn! Weil Meerschweinderl haben ein ganz anderes Verdauungssystem als Menschen. Meerschweinchen, die ursprünglich in Südamerika beheimatet sind und vermutlich von spanischen Seefahrern übers Meer nach Europa mitgebracht wurden, haben nämlich einen sogenannten Stopfdarm. Wenn oben reingestopft – wird unten rausgedrückt. Und zwar fast alles.
Viel Schnee: Das kann man mögen oder man lässt es bleiben. Mir gefällt das! Ich war die ganze letzte Woche im Winterurlaub. Daheim, wohlgemerkt. Ich bin im Wald herumgelaufen, war jeden Tag Schlitten fahren, bin meiner Bürgerspflicht nachgekommen und habe das Forstamt zu einem Bruchast über einem Hohlweg gelotst, und ich habe eine Menge Schnee geräumt. Nur eines, das habe ich immer noch nicht getan! Und glaubt man den Männern, die man dieser Tage an Knüppelfeuern und Glühweineimern trifft, so gehört das zu einem gescheiten Winter dazu!
Nun mögen sich weibliche Leser berechtigt fragen: Was, zur Hölle, muss man im Winter gemacht haben? Außer saumäßig frieren?
Driften, meine Damen! Wir reden von Autos. Driften oder Sliden (engl. to slide für rutschen) ist eine Fahrtechnik, um zum Beispiel schneller Kurven nehmen zu können. (Das sind diejenigen, trifft man ihre quietschenden Reifen im Straßenverkehr, hinter denen man Scheibenwischer macht. Zivilisiertere Zeitgenossen lassen sich vielleicht nur zu einem missbilligenden Kopfschütteln hinreißen.) Jedenfalls gibt es vier Möglichkeiten, Drifts auszulösen. Am leichtesten geht es mit der Handbremse, habe ich mir sagen lassen. Sie fahren mit guter Geschwindigkeit in eine Kurve. Sobald Sie in die Kurve einlenken, ziehen Sie an der Handbremse. Dadurch übersteuert das Heck und bricht aus. Jetzt schnell einen Gang runterschalten, Gas geben und entgegen der Richtung lenken, in welche das Auto wegfliegt.
Theoretisch klingt das einfach….. „Musst du nachts auf einem großen Parkplatz üben!“, haben die Jungs gesagt.
„Aber bleib‘ nicht länger, als bis einer die Polizei ruft!“ – „Oder übst halt erst mal auf der Playstation….“
Ach ja, eins noch! Drift stoppen geht wie jedes Ende: Fuß vom Gas.
Solche Montage zählen zu den allerbesten Arbeitstagen: entweder Pause wegen schmerzender Kinderohren – oder Wetter. Wenn uns früh kein Auto weckt, sondern die 7Uhr-Glocken den ersten aus dem Schlaf dröhnen, dann kann nur mächtig Schnee liegen.
Natürlich kann man sich jetzt unerschrocken in den Verkehr stürzen, man kann mit vielen anderen armen Schweinen auf der A3 parken und irgendwann im Laufe des späten Vormittags das Lager auf die A40 verlegen – oder man lässt das und macht einfach Homeoffice. Bei mir liegt der Fall klar: Ich wähle den Ort mit der größeren Beinfreiheit. Nützt mir aber auch nichts – oder nimmt wer Hella?
Es ist immer das Gleiche: Irgendwann kriegt mein Kaffee Beine!
Wobei – so richtig logisch ist das nicht. In jeden deutschen Erwachsenenkopf werden durchschnittliche 160 Liter Kaffee pro Jahr gekippt. Das geschieht mit Hilfe von 4 gefüllten Tassen am Tag. Andere Studien reden zwar nur von 150 Litern Durchflussmenge – was eine jährliche Trinkdifferenz von einem großen Wassereimer bedeutet – aber das ist egal: Tranken die Probanden eben aus kleineren Tassen.
Was hat jetzt der Pro-Kopf-Verbrauch mit meinem verschwundenen Kaffee zu tun, fragen Sie sich?
Sehr viel! Hier im Haus halten sich derzeit nur zwei kleine Jungmenschen auf und ein dreiviertelgroßer. Fische und Meersau Eddy zählen sowieso nicht. Der einzige über 18-Jährige hier bin ich. Ich höre jetzt auch auf zu suchen. Wenn mein Kaffee wieder auftaucht, macht er sowieso nur noch schön.
Seit einer Weile haben wir Dielenboden.
So ein Dielenboden ist schon was Schönes. Farbkontraste in der Wohnung stimmen, beim Heimkommen kann man länger nach seinen Hauspantoffeln suchen und man kann sich zum Vorlesen auf den Boden fläzen, ohne gleich hektisch nach einem Kissen zu rufen.
Am Montag saß ich zum ersten Mal in 2013 am Schreibtisch, als sich, ebenfalls zum ersten Mal in diesem Jahr, die Sonne blicken ließ. Die tiefen Kratzfurchen von Hellas Blechautos leuchteten.
Chefprokrastiniererin Müller beschloss spontan, den Dielenboden zu behandeln. Mit Bohnerwachs, oder sowas………. Gibt es überhaupt noch Bohnerwachs?
In so einem Fall kann man seine Mutter fragen – wenn man aber genau weiß, dass die keinen Dielenboden hat, bemüht man halt das Internet.
Geben Sie doch mal bei Google „Bohnerwachs“ ein!
Ein Drittel der Treffer landet hier: „Wichsmädel – Das beste und sparsamste Bohnerwachs“. Da hockt eine verschwitze Dame im Scherenschnitt-Design auf allen Vieren. Also Bitte! Aber ich schweife ab.
In einem Forum fand ich den Hinweis, dass sich leichte Kratzer auf Möbeln mit Möbelpolitur beseitigen lassen.
Möbelpolitur, genau!
Politur also großzügig über den Küchenboden gekippt, die Flüssigkeit schön breit geschmiert – Kratzer weg, Fußboden poliert. Man kann sich fast drin spiegeln.
Auf alle Fälle habe ich jetzt den Fotoapparat hier liegen. Lange kann das nicht mehr dauern…
Es ist schon nicht einfach, mit einem Pubertierenden.
Mein Großer wird in einer Woche vierzehn. Pickel, den großen Rand, alles andere als Schule im Kopf und wahnsinnig verpeilt.
Eine wahre Freude für seine Mutter.
Heute morgen zum Beispiel, hat er völlig vergessen zu frühstücken.
Komme ich gerade nach hause, steht seine Trinkflasche noch auf der Anrichte. Klar, er hat ja nur Sport und fühlt ständig den großen
Durst der ganzen Sahara-Wüste in seinem Bohnenstangenkörperchen.
Schaue ich in den Kühlschrank: Pausenbrot liegt auch noch drin.
Nun könnte ich mich zwar aufregen, oder sorgen, weil das arme Kind bis halb zwei total schwindelig zerhungert sein wird – aber von wegen!
Ich nehme jetzt seine Brotbüchse und setze mich an den Schreibtisch.
Ein Brot mit Schinken und eins mit Mett. Lecker!
Meine Nachbarin fragte, wie es im Zirkus war.
Was für ein Zirkus? Soviel Theater hatten wir doch gar nicht!
Na, die Karten, die sie uns in den Briefkasten gelegt hat, die meint sie.
Ich runzele die Stirn. In meinem Briefkasten war nix außer Rechungen und Werbung.
Und die Werbung, die pfeife ich immer unbesehen ins Altpapier. Außer vor Weihnachten.
Da hatte ich so viel zu tun, da habe ich sie sofort in die Mülltonne gesteckt. Erst recht ungeöffnet.
Also schalte ich die Außenbeleuchtung ein und wühle im Müll…..
Nix, keine Zirkuskarten.
Ach, ich brauche auch keinen Zirkus – daheim kann ich den auf Socken erleben!